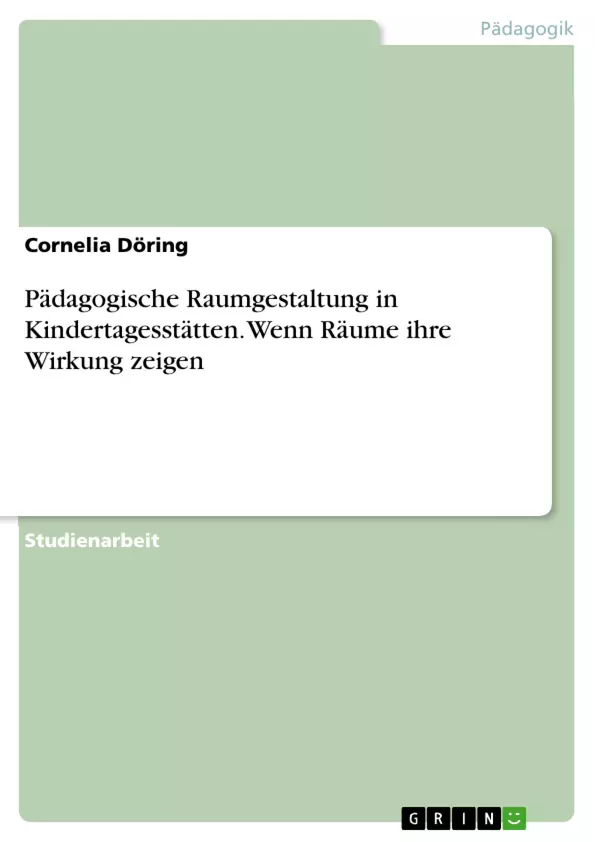„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“ (Maria Montessori)
Das bedeutet, dass Kinder mit ihrer Umgebung in Einklang stehen müssen, um sich frei entfalten und entwickeln zu können. Dafür benötigen Kinder, egal welchen Alters, eine anregende, vorbereite und atmosphärische Umgebung, die nicht nur rein aus Materialien besteht. In der Annahme, dass Kinder mit dem täglichen Besuch die Kindertagesstätte als Kinderzimmer sehen und nicht in erster Linie als Bildungsort, ist es umso wichtiger, dass die Räumlichkeiten Anreize bieten, die Welt zu entdecken und auf eigene Weise Erfahrungen zu sammeln. Zudem gewinnt die Raumgestaltung in der heutigen Zeit immer mehr an Relevanz, da Kindertagesstätten ganzheitlich als Bildungsstätte agieren und der Raum durch seine Wirkungsweise als miterziehendes Objekt verstanden wird.
Um ein Gefühl für die oben angeschnittene Thematik zu erhalten, beschäftigt sich diese Arbeit mit Raumkonzepten bzw. Raumgestaltung von Kindertagesstätten. Dabei geht die Autorin der zentralen Frage nach, wie sich die Raumgestaltung auf das Kind auswirkt und welche Rolle die pädagogische Fachkraft dabei einnimmt.
Im ersten Teil der Arbeit werden Bildungsräume unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Bedeutsamkeit näher beleuchtet. Anschließend wird ein Blick auf die Raumgestaltung der pädagogischen Ansätze nach „Reggio“ und „Offene Arbeit“ gewährt, um die Vielfältigkeit und Priorität darzustellen. Der Hauptteil der Hausarbeit setzt sich mit den Wirkungsfaktoren einer entwicklungsfördernden Raumgestaltung auseinander, um zum Schluss auf die Bedeutung und Wirkung von Räumen für bzw. auf das Kind einzugehen und die Rolle der pädagogischen Fachkraft zu reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bildungsräume von pädagogischer Bedeutsamkeit
- 3. Raumgestaltung pädagogischer Ansätze
- 3.1. Reggio-Pädagogik
- 3.1.1. Bild vom Kind
- 3.1.2. Raumgestaltung
- 3.1.3. Rolle der pädagogischen Fachkraft
- 3.2. Offene Arbeit
- 3.2.1. Bild vom Kind
- 3.2.2. Raumgestaltung
- 3.2.3. Rolle der pädagogischen Fachkraft
- 3.1. Reggio-Pädagogik
- 4. Wirkungsfaktoren einer entwicklungsfördernden Raumgestaltung
- 4.1. Akustik
- 4.2. Licht
- 4.3. Farbe
- 4.4. Material
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Raumgestaltung in Kindertagesstätten auf die kindliche Entwicklung. Ziel ist es, die Bedeutung von Raumkonzepten für den Bildungsprozess zu beleuchten und die Rolle der pädagogischen Fachkraft zu definieren.
- Bedeutung von Bildungsräumen für die frühkindliche Entwicklung
- Raumgestaltungsansätze nach Reggio und in der Offenen Arbeit
- Wirkungsfaktoren einer entwicklungsfördernden Raumgestaltung (Akustik, Licht, Farbe, Material)
- Einfluss der Raumgestaltung auf die Selbstständigkeit und den Selbstbildungsprozess des Kindes
- Rolle der pädagogischen Fachkraft in der Gestaltung und Nutzung der Räume
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Raumgestaltung in Kindertagesstätten ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss der Raumgestaltung auf das Kind und die Rolle der pädagogischen Fachkraft in den Mittelpunkt. Sie betont die Bedeutung von anregenden und entwicklungsfördernden Räumen für die kindliche Entwicklung und Selbstentfaltung, in denen die Einrichtung nicht nur als Aufenthaltsort, sondern als Bildungsstätte verstanden wird. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik der Untersuchung.
2. Bildungsräume von pädagogischer Bedeutsamkeit: Dieses Kapitel betont die Relevanz von Bildungsräumen für die frühkindliche Entwicklung. Es wird hervorgehoben, dass pädagogisch gestaltete Räume den Bedürfnissen der Kinder entsprechen und positiv auf deren Handlungen einwirken müssen. Die Grundbedürfnisse des Kindes, die Umwelt zu verstehen und eigene Grenzen kennenzulernen, stehen im Fokus. Das Kapitel argumentiert für Funktionsräume und Lernwerkstätten, die den Selbstbildungsprozess, die Selbstständigkeit und die Wahlmöglichkeiten der Kinder unterstützen, ohne sie dabei zu stark einzuschränken. Die Gestaltung dieser Räume sollte sinnlich-ästhetisch-emotionale Erfahrungen anregen.
3. Raumgestaltung pädagogischer Ansätze: Dieses Kapitel vergleicht die Raumgestaltungsansätze der Reggio-Pädagogik und der Offenen Arbeit. Es wird das jeweilige Bild vom Kind und die Rolle der pädagogischen Fachkraft in beiden Ansätzen beleuchtet. In der Reggio-Pädagogik wird der Raum als „dritter Erzieher“ verstanden, der als Impulsgeber und Kommunikationsmöglichkeit dient. Die „Piazza“ als zentraler Ort der Einrichtung wird beschrieben. Die Offene Arbeit wird ebenfalls im Hinblick auf ihre räumlichen Implikationen diskutiert, aber der Text liefert dazu keine weiteren Details im Auszug.
4. Wirkungsfaktoren einer entwicklungsfördernden Raumgestaltung: Der vierte Kapitelteil untersucht die Wirkungsfaktoren von Akustik, Licht, Farbe und Material auf die kindliche Entwicklung. Es wird detailliert auf die Bedeutung jedes dieser Faktoren für ein anregendes und kindgerechtes Raumklima eingegangen, wobei leider im Auszug keine expliziten Beschreibungen der einzelnen Faktoren enthalten sind.
Schlüsselwörter
Raumgestaltung, Kindertagesstätte, frühkindliche Entwicklung, Reggio-Pädagogik, Offene Arbeit, Bildungsraum, Selbstbildungsprozess, pädagogische Fachkraft, Akustik, Licht, Farbe, Material.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Raumgestaltung in Kindertagesstätten"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Raumgestaltung in Kindertagesstätten auf die kindliche Entwicklung. Sie beleuchtet die Bedeutung verschiedener Raumkonzepte für den Bildungsprozess und definiert die Rolle der pädagogischen Fachkraft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von Bildungsräumen für die frühkindliche Entwicklung, Raumgestaltungsansätze nach Reggio und in der Offenen Arbeit, Wirkungsfaktoren einer entwicklungsfördernden Raumgestaltung (Akustik, Licht, Farbe, Material), den Einfluss der Raumgestaltung auf die Selbstständigkeit und den Selbstbildungsprozess des Kindes sowie die Rolle der pädagogischen Fachkraft in der Gestaltung und Nutzung der Räume.
Welche Raumgestaltungsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Raumgestaltungsansätze der Reggio-Pädagogik und der Offenen Arbeit. Dabei werden das jeweilige Bild vom Kind und die Rolle der pädagogischen Fachkraft in beiden Ansätzen beleuchtet. Der Raum in der Reggio-Pädagogik wird als „dritter Erzieher“ beschrieben, während die Offene Arbeit hinsichtlich ihrer räumlichen Implikationen diskutiert wird (jedoch ohne detaillierte Beschreibung im vorliegenden Auszug).
Welche Wirkungsfaktoren der Raumgestaltung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Wirkungsfaktoren Akustik, Licht, Farbe und Material auf die kindliche Entwicklung. Obwohl im vorliegenden Auszug keine detaillierten Beschreibungen der einzelnen Faktoren enthalten sind, wird ihre Bedeutung für ein anregendes und kindgerechtes Raumklima hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die pädagogische Fachkraft?
Die Rolle der pädagogischen Fachkraft in der Gestaltung und Nutzung der Räume wird als zentraler Aspekt betrachtet. Sie wird in Bezug auf beide besprochenen pädagogischen Ansätze (Reggio-Pädagogik und Offene Arbeit) untersucht und ihre Bedeutung für den Bildungsprozess hervorgehoben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Bildungsräumen, Raumgestaltungsansätzen (Reggio-Pädagogik und Offene Arbeit), Wirkungsfaktoren der Raumgestaltung, sowie eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter erleichtern die Navigation.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung von Raumkonzepten für den Bildungsprozess in Kindertagesstätten zu beleuchten und die Rolle der pädagogischen Fachkraft in diesem Kontext zu definieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Raumgestaltung, Kindertagesstätte, frühkindliche Entwicklung, Reggio-Pädagogik, Offene Arbeit, Bildungsraum, Selbstbildungsprozess, pädagogische Fachkraft, Akustik, Licht, Farbe, Material.
- Arbeit zitieren
- Cornelia Döring (Autor:in), 2013, Pädagogische Raumgestaltung in Kindertagesstätten. Wenn Räume ihre Wirkung zeigen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/303992