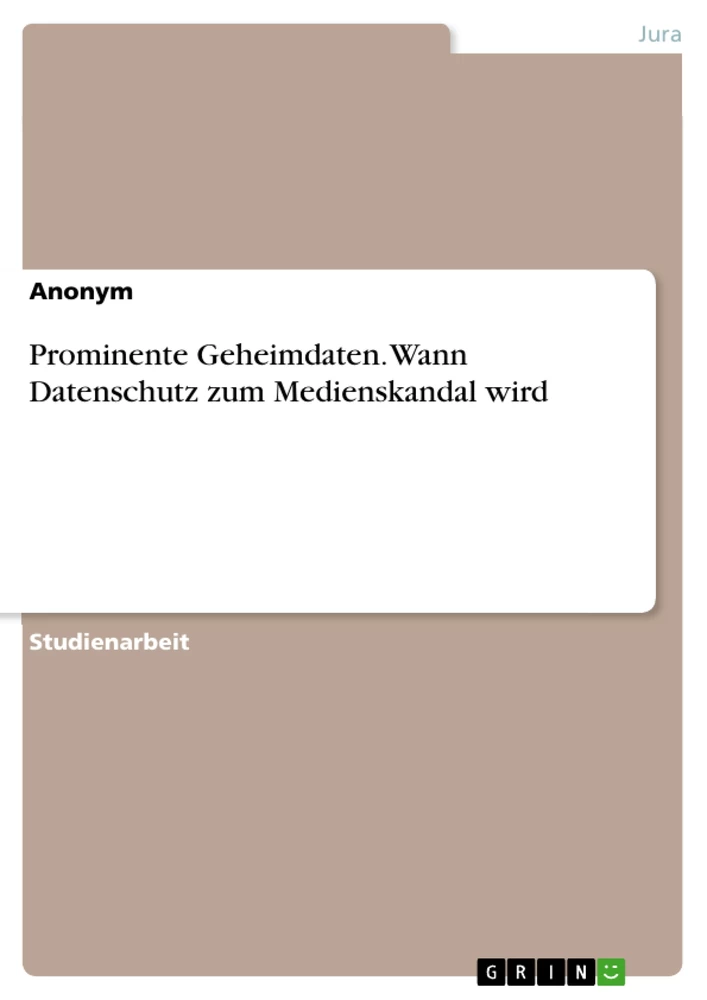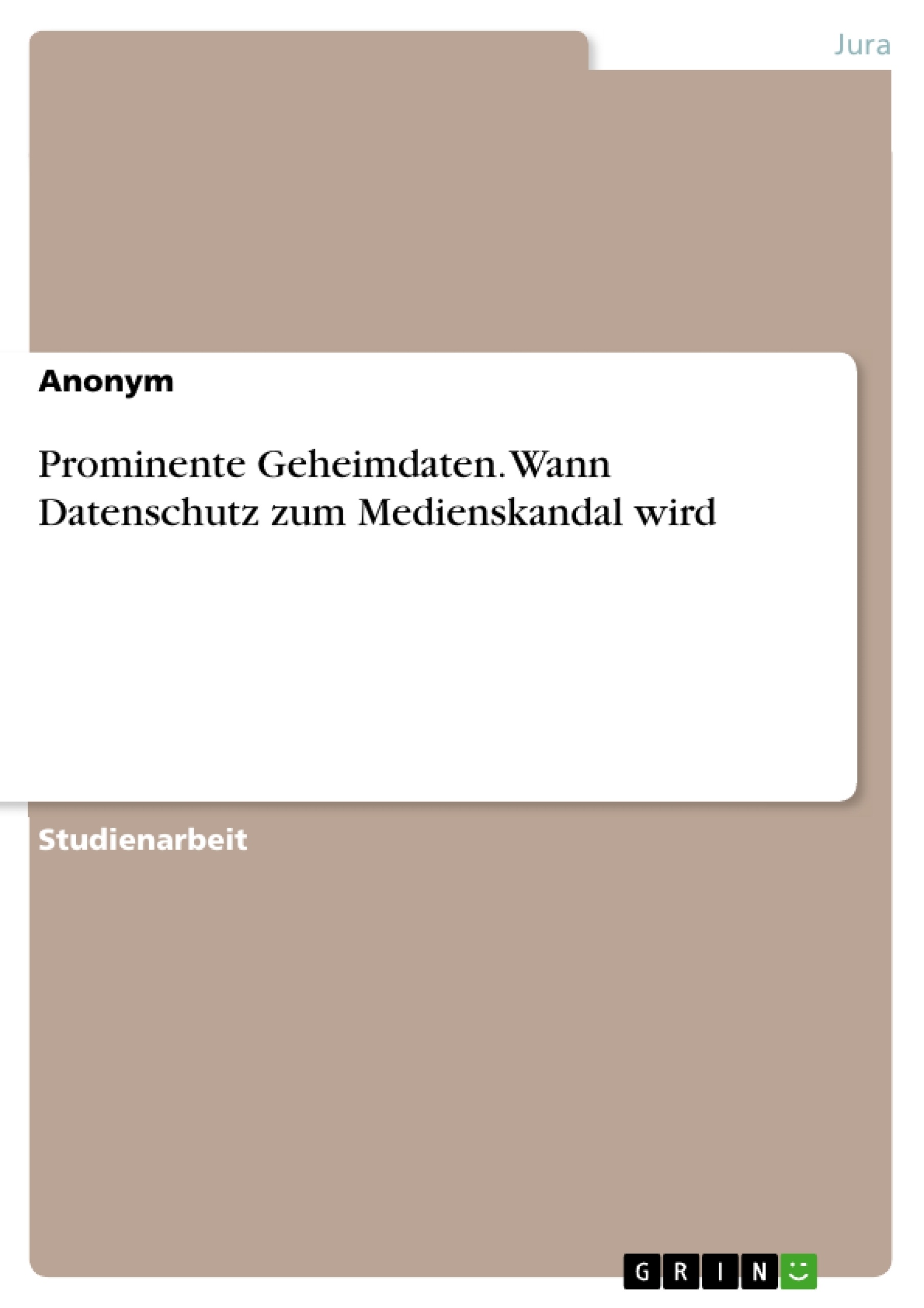Diese Arbeit versucht zu ergründen, unter welchen Voraussetzungen das abstrakte Thema "Datensicherheit" zum Skandal werden kann und welche Aspekte dafür eine besonders wichtige Rolle spielen. Um eine einheitliche Struktur und eine höhere Plastizität zu erzielen, werden sämtliche Überlegungen am Beispiel des NSA-Skandals illustriert. Schließlich wird versucht zu erörtern, ob und weshalb eine Skandalisierung des Datenmissbrauchs dem Datenschutz zum Vorteil gereichen könnte.
"Sicherheit ist ein Supergrundrecht." Mit diesem Ausspruch betonte der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich nach einer Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags zum US-Überwachungsprogramm PRISM unmissverständlich seinen Standpunkt zum selbigen Thema.
Die Dramatik des Begriffs „Supergrundrecht“ kann beinahe als Metapher für den Medienskandal gesehen werden, der sich besonders seit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden im Juni 2013 um das Thema Datenschutz entwickelt hat. Das Dilemma Freiheit versus Sicherheit wird zur zentralen Fragestellung in einem Konflikt, der auch in den Medien ausgetragen wird. Durch den NSA-Skandal und die damit verbundene publizistische Aufarbeitung und öffentliche Diskussion hat das Thema Datensicherheit in Deutschland neue Dimensionen erreicht und wurde zum vieldiskutierten, sozialen Problem.
Inhaltsverzeichnis
- Datenschutz in den Medien und der Öffentlichkeit
- Begriffsbestimmungen
- Bisheriger Forschungsstand
- Die Nachrichtenwerttheorie am Beispiel der NSA-Affäre
- Nachrichtenfaktoren im NSA-Skandal
- Erklärungsansatz für Interessensschwankungen
- Skandalaspekte der NSA-Affäre
- Definition und Charakteristika des „Skandals“
- Phasen des Skandals
- Chancen der Skandalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der medialen und öffentlichen Rezeption des Themas Datenschutz im Kontext der NSA-Affäre. Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die Datenschutz für die Medien und somit für die Öffentlichkeit interessant machen, und zu untersuchen, unter welchen Aspekten dieses Thema schließlich zum Skandal wird.
- Die Rolle der Nachrichtenwerttheorie bei der medialen Berichterstattung über Datenschutz
- Die Bedeutung von Skandalisierungsprozessen für die öffentliche Wahrnehmung von Datenschutz
- Die Auswirkungen der NSA-Affäre auf die Debatte um Datenschutz in Deutschland
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Skandalisierung im Kampf für mehr Datenschutz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff Datenschutz und seiner Bedeutung in den Medien und der Öffentlichkeit. Es werden verschiedene Definitionen des Begriffs erörtert und der bisherige Forschungsstand zum Thema Datenschutz in den Medien beleuchtet.
Im zweiten Kapitel wird die Nachrichtenwerttheorie am Beispiel der NSA-Affäre untersucht. Es werden die Nachrichtenfaktoren analysiert, die den Skandal für die Medien interessant gemacht haben, und es wird ein Erklärungsansatz für die Schwankungen des öffentlichen Interesses an dem Thema Datenschutz entwickelt.
Das dritte Kapitel widmet sich den Skandalaspekten der NSA-Affäre. Es werden die Definition und die Charakteristika des „Skandals“ erörtert und die verschiedenen Phasen des Skandals analysiert.
Schlüsselwörter
Datenschutz, NSA-Affäre, Nachrichtenwerttheorie, Skandalisierung, Medien, Öffentlichkeit, Whistleblower, Edward Snowden, PRISM, Überwachung, Sicherheit, Freiheit, Persönlichkeitsrechte, Google-Trends, Threema, OpenSSL, „Heartbleed“, „Recht auf Vergessen“, Interessensschwankungen, Medienrezeption.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Prominente Geheimdaten. Wann Datenschutz zum Medienskandal wird, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/302330