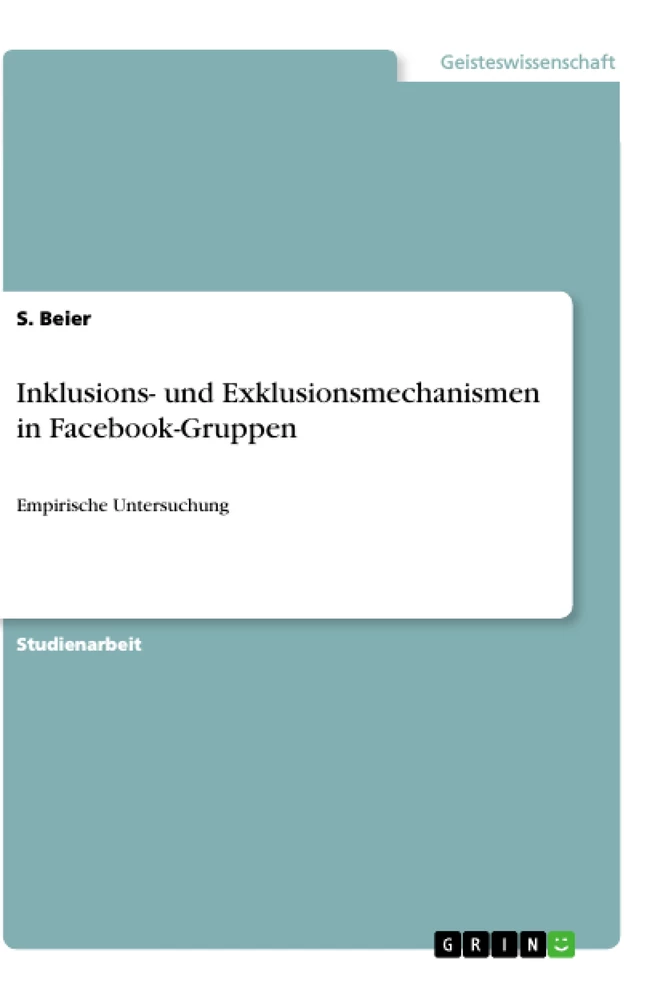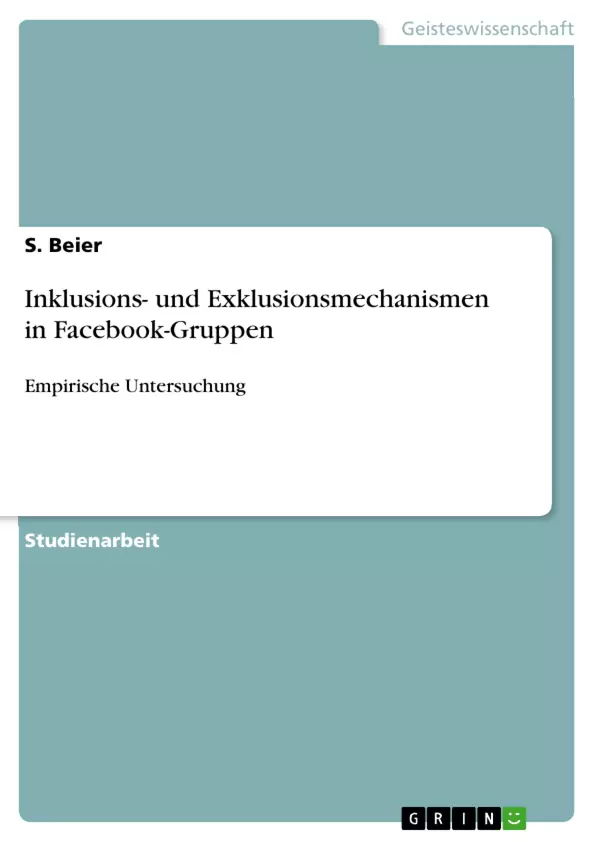In der Literatur lassen sich bereits einige Werke zum Thema Inklusion und Exklusion in virtuellen Gruppen finden, zu nennen ist hier vor allem der Soziologe Udo Thiedeke, auf dessen Werke sich ein Großteil des theoretischen Hintergrunds der vorliegenden Arbeit beziehen wird. Seine Untersuchungen verweisen vor allem auf Chatrooms, Foren und Spieleumgebungen.
Im Zuge der Etablierung des Web 2.0 sind jedoch digitale Soziale Netzwerke (Social Network Sites) populär geworden und in das wissenschaftliche Blickfeld gerückt. Es besteht daher Forschungsbedarf zur – nicht nur – soziologischen Untersuchung von Facebook-Gruppen. Während das Internet eigentlich eine scheinbar unendliche Offenheit symbolisiert und einen Ausweg aus der sozialen Kontrolle in der „realen Welt“ verspricht, so bilden sich insbesondere auf Facebook und speziell in dessen Gruppen Instanzen, die für Inklusion und Exklusion sorgen. Die beiden Fragestellungen, die sich daran anschließen, lauten:
F1: Welche Besonderheiten in Bezug auf Inklusion und Exklusion lassen sich für Gruppen auf Facebook ausmachen?
F2: Inwiefern sind die Inklusions- und Exklusionsmechanismen in Facebook-Gruppen vergleichbar mit denen aus anderen virtuellen Gruppen?
Es erscheint sinnvoll, sich zunächst mit den Logiken virtueller Gruppen zu beschäftigen und sie mit realweltlichen Gruppen zu vergleichen, wobei ein besonderer Blick auf Inklusions- und Exklusionsleistungen der virtuellen Gruppe gelegt wird (vgl. Kap. 2). Auf diesem theoretischen Ideengerüst baut dann der empirische Teil der vorliegenden Arbeit auf, indem anfänglich explorativ der Forschungsraum erkundet wird, anschließend eine Sammlung, Bearbeitung und Ordnung von hauptsächlich qualitativen Daten erfolgt und diese letztlich im Hinblick auf die Theorie ausgewertet werden (vgl. Kap. 3). Eine Herausarbeitung der wichtigsten Erkenntnisse der empirischen Arbeit schärft schlussendlich den Blick zur prägnanten Beantwortung der Forschungsfragen (vgl. Kap. 4).
Inhaltsverzeichnis
- I Abbildungsverzeichnis
- II Tabellenverzeichnis
- III Vorbemerkungen
- 1 Einleitung und Einordnung des Themas
- 1.1 Themenwahl und Einordnung in die Soziologie
- 1.2 Forschungsstand, Fragestellungen und Aufbau der Arbeit
- 2 Inklusion und Exklusion innerhalb virtueller Gruppen
- 2.1 Soziale Gruppen
- 2.2 Virtuelle Gruppen
- 2.3 Inklusion und Exklusion
- 3 Qualitative Erforschung von Bildertauschgruppen auf Facebook
- 3.1 Interviews mit Facebook-Freunden über die Funktionen von Facebook-Gruppen
- 3.2 Beobachtungen von Bildertauschgruppen mit (multi-)nationalen Schwerpunkten bei Facebook
- 3.3 Interview mit einem Gruppenadministrator bei Facebook
- 4 Zusammenfassung und Fazit: Inklusions- und Exklusionsmechanismen in Facebook-Gruppen
- IV Literaturverzeichnis
- V Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Inklusions- und Exklusionsmechanismen in Facebook-Gruppen und analysiert, wie diese Prozesse im Kontext der digitalen Kommunikation ablaufen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie soziale Normen und Regeln in virtuellen Gruppen entstehen und wie diese die Teilhabe und den Ausschluss von Mitgliedern beeinflussen.
- Soziale Normen und Regeln in virtuellen Gruppen
- Inklusions- und Exklusionsmechanismen in Facebook-Gruppen
- Die Rolle von Gruppenadministratoren bei der Gestaltung von Inklusion und Exklusion
- Die Auswirkungen von Inklusion und Exklusion auf die Kommunikation und das Gemeinschaftsgefühl in Facebook-Gruppen
- Die Bedeutung von Facebook-Gruppen für die soziale Interaktion und die Bildung von Gemeinschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz der Forschung zu Inklusion und Exklusion in virtuellen Gruppen im Kontext der Soziologie. Es werden die Forschungslücken und Fragestellungen der Arbeit vorgestellt sowie der Aufbau erläutert.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der theoretischen Einordnung von Inklusion und Exklusion innerhalb sozialer und virtueller Gruppen. Es werden die Besonderheiten von virtuellen Gruppen im Vergleich zu traditionellen sozialen Gruppen herausgestellt.
Kapitel 3 präsentiert die qualitative Forschungsergebnisse, die auf Beobachtungen von Bildertauschgruppen auf Facebook sowie Interviews mit Facebook-Nutzern und einem Gruppenadministrator basieren. Es werden die verschiedenen Mechanismen der Inklusion und Exklusion in Facebook-Gruppen anhand von konkreten Beispielen aus der empirischen Forschung beleuchtet.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit zu den Inklusions- und Exklusionsmechanismen in Facebook-Gruppen. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse der Forschung dargestellt und die Bedeutung der Ergebnisse für die Soziologie und die Praxis der digitalen Kommunikation diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Inklusion und Exklusion in Facebook-Gruppen, soziale Normen und Regeln in virtuellen Gruppen, die Rolle von Gruppenadministratoren, digitale Kommunikation, qualitative Forschung, empirische Studien, soziale Interaktion und Gemeinschaftsbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Inklusions- und Exklusionsmechanismen?
Dies sind soziale Prozesse, die bestimmen, wer Teil einer Gruppe sein darf (Inklusion) und wer ausgeschlossen wird (Exklusion).
Welche Rolle spielen Administratoren in Facebook-Gruppen?
Administratoren agieren als Instanzen der sozialen Kontrolle. Sie setzen Regeln durch und entscheiden maßgeblich über die Aufnahme oder den Ausschluss von Mitgliedern.
Wie unterscheiden sich virtuelle Gruppen von realweltlichen Gruppen?
Virtuelle Gruppen bieten oft eine scheinbare Offenheit, unterliegen aber spezifischen digitalen Dynamiken und Kontrollmechanismen des Web 2.0.
Was wurde in der empirischen Untersuchung analysiert?
Die Arbeit untersuchte qualitativ Bildertauschgruppen auf Facebook durch Beobachtungen und Interviews mit Nutzern und Administratoren.
Führen Facebook-Gruppen zu mehr sozialer Freiheit?
Obwohl das Internet Freiheit verspricht, bilden sich in Facebook-Gruppen oft strenge soziale Normen, die eine starke soziale Kontrolle ausüben.
- Quote paper
- S. Beier (Author), 2015, Inklusions- und Exklusionsmechanismen in Facebook-Gruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/301931