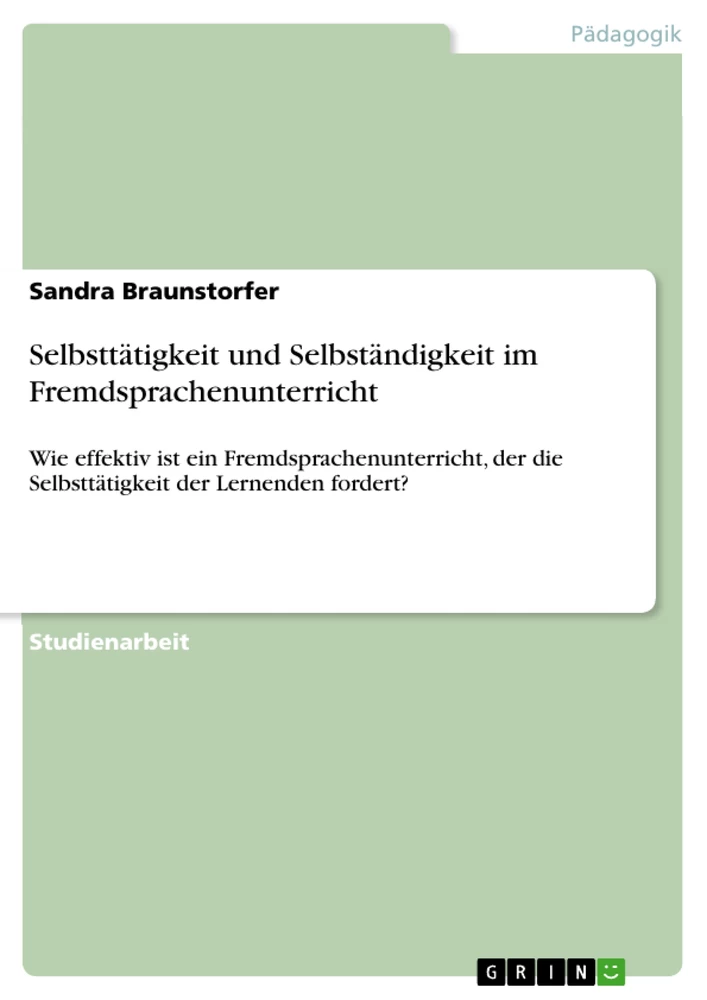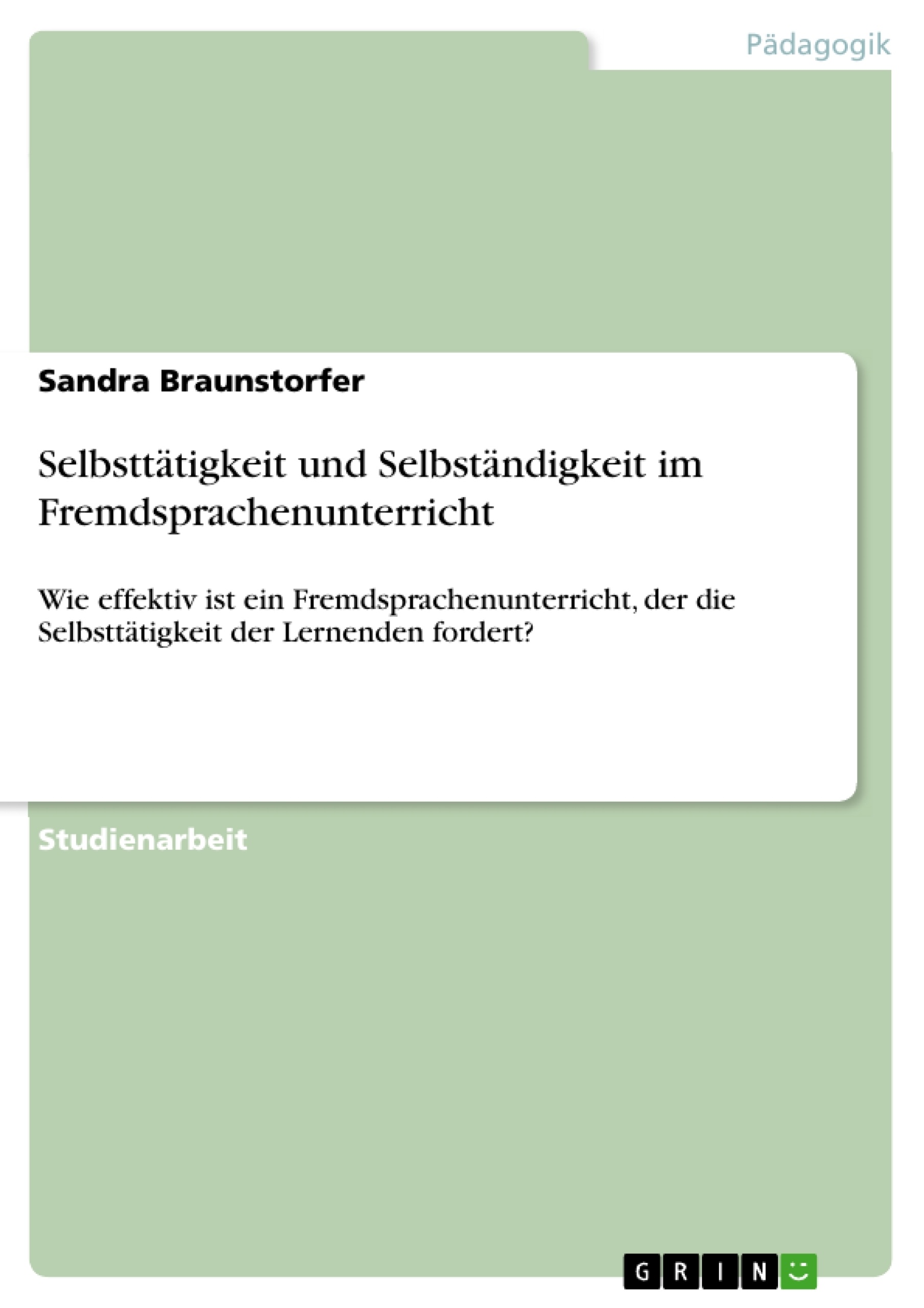Wie effektiv ist ein Fremdsprachenunterricht, der die Selbsttätigkeit der Lernenden fordert?
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie sich selbsttätiges Lernen im Fremdsprachenunterricht legitimiert, wie dies umgesetzt werden kann und welche Effekte sich im Vergleich zu einem vom Lehrenden gesteuerten Unterricht ergeben.
Diesbezüglich können jedoch weder ein Medium noch eine Skala vorgestellt werden, die in der Lage wären, die Effektivität von Unterricht zu messen. Vielmehr wird auf wissenschaftliche Befunde zurückgegriffen, die den Erfolg eines Fremdsprachenunterrichts, bei dem sich die Lernenden aktiv am Lehr- und Lernprozess beteiligen, überprüfen. Es wird immer wieder ein Vergleich zwischen traditionellen Lernformen, die lange Zeit dem pädagogischen Konsens angehörten, und neuen Lernformen angestellt, die eigenständiges Arbeiten fördern.
Was ist überhaupt ein effektiver Fremdsprachenunterricht? Effektivität bezieht sich hier auf einen für alle Beteiligten erfolgreichen Prozess: Die Lernenden lenken ihre Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand und lassen sich nicht ablenken. Das Gelernte wird behalten und nicht nur im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert. Lernen wird dabei nicht als Last, sondern als gewinnbringendes Handeln betrachtet.
Viele Lehrende übernehmen Unterrichtsformen, in denen sie sich selbst zurücknehmen und die Lernenden aktivieren. Andere hingegen zögern, da sie befürchten, die Lernenden würden überfordert. Sie haben sich mit folgenden Fragestellungen auseinanderzusetzen:
Ist ein offener Unterricht effektiver?
Können Lernende überhaupt etwas lernen, wenn sie selbst tätig sind? Wie können sie eine Sprache lernen, wenn der Lehrende den Lehrprozess den Lernenden überlässt?
Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen?
Welche Aufgabe hat dann der Lehrende im Fremdsprachenunterricht noch?
Wie kann das Sprachenlernen in solch einem Unterricht bewertet werden?
Diese Fragen sollen im Laufe dieser Arbeit weitestgehend beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Die Forschungsfrage
- 2.0 Legitimation von selbsttätigen Lernformen im Fremdsprachenunterricht
- 2.1 Selbsttätigkeit und Selbständigkeit - was ist der Unterschied?
- 2.2 Kindheit im Wandel
- 2.3 Selbsttätiges Lernen unter lerntheoretischer Perspektive
- 2.4 Empfehlungen des Europarats zur Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht
- 3.0 Selbständigkeit durch Selbsttätigkeit: Methodische Umsetzung im Fremdsprachenunterricht
- 3.1 Die Vermittlung von Lernstrategien als Teil des Fremdsprachenunterrichts
- 3.2 Selbständiges und handlungsorientiertes Lernen in Lernszenarien
- 4.0 Ausblick
- 5.0 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Effektivität selbsttätigen Lernens im Fremdsprachenunterricht. Sie beleuchtet die Legitimation solcher Lernformen, deren methodische Umsetzung und den Vergleich zu lehrerzentrierten Ansätzen. Die Arbeit verzichtet auf die Messung der Effektivität mittels eines spezifischen Mediums oder einer Skala, sondern greift auf wissenschaftliche Befunde zurück, um den Erfolg aktiv beteiligter Lernender zu überprüfen.
- Legitimation selbsttätiger Lernformen im Fremdsprachenunterricht
- Methodische Umsetzung selbsttätigen Lernens im Fremdsprachenunterricht
- Vergleich selbsttätigen Lernens mit lehrerzentrierten Unterrichtsformen
- Der Unterschied zwischen Selbsttätigkeit und Selbständigkeit
- Lernerautonomie und deren Bedeutung im Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Die Forschungsfrage: Dieses Kapitel führt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ein: Wie effektiv ist ein Fremdsprachenunterricht, der die Selbsttätigkeit der Lernenden fordert? Es wird der Begriff "effektiver Fremdsprachenunterricht" definiert und die Schwierigkeiten bei dessen Messung angesprochen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich traditioneller und neuer Lernformen, die eigenständiges Arbeiten fördern. Die Arbeit stellt die zentralen Fragen, die im weiteren Verlauf behandelt werden, vor und skizziert den methodischen Ansatz.
2.0 Legitimation von selbsttätigen Lernformen im Fremdsprachenunterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Fundierung selbsttätigen Lernens. Zunächst wird eine klare Unterscheidung zwischen Selbsttätigkeit und Selbständigkeit getroffen. Der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf das Lernen wird beleuchtet, gefolgt von einer Erörterung der konstruktivistischen Lerntheorie. Schließlich werden die Empfehlungen des Europarats zur Förderung der Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht präsentiert, die die Grundlage für die Argumentation der Arbeit bilden. Das Kapitel etabliert somit den theoretischen Rahmen für die Untersuchung der Effektivität selbsttätigen Lernens.
3.0 Selbständigkeit durch Selbsttätigkeit: Methodische Umsetzung im Fremdsprachenunterricht: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die praktische Umsetzung selbsttätigen Lernens im Fremdsprachenunterricht. Es werden methodische Ansätze diskutiert, insbesondere die Vermittlung von Lernstrategien und die Gestaltung handlungsorientierter Lernszenarien. Das Kapitel zeigt konkrete Wege auf, wie Lehrende Selbsttätigkeit fördern und gleichzeitig die Selbständigkeit der Lernenden unterstützen können. Die verschiedenen Methoden werden im Kontext des Fremdsprachenunterrichts erläutert und ihre Bedeutung für den Lernerfolg hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Selbsttätigkeit, Selbständigkeit, Lernerautonomie, Fremdsprachenunterricht, Lerntheorie, Konstruktivismus, Lernstrategien, Handlungsorientierung, Effektivität, Lehrerrolle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Selbsttätiges Lernen im Fremdsprachenunterricht
Was ist das zentrale Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Effektivität selbsttätigen Lernens im Fremdsprachenunterricht. Sie beleuchtet die Legitimation solcher Lernformen, deren methodische Umsetzung und den Vergleich zu lehrerzentrierten Ansätzen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich traditioneller und neuer Lernformen, die eigenständiges Arbeiten fördern.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie effektiv ist ein Fremdsprachenunterricht, der die Selbsttätigkeit der Lernenden fordert? Die Arbeit konzentriert sich auf den Vergleich traditioneller und neuer Lernformen und definiert den Begriff "effektiver Fremdsprachenunterricht".
Wie wird die Effektivität selbsttätigen Lernens untersucht?
Die Arbeit verzichtet auf die Messung der Effektivität mittels eines spezifischen Mediums oder einer Skala. Stattdessen greift sie auf wissenschaftliche Befunde zurück, um den Erfolg aktiv beteiligter Lernender zu überprüfen und den theoretischen Rahmen zu etablieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Legitimation selbsttätiger Lernformen, methodische Umsetzung im Fremdsprachenunterricht, Vergleich mit lehrerzentrierten Formen, Unterscheidung zwischen Selbsttätigkeit und Selbständigkeit, sowie die Bedeutung der Lernerautonomie.
Wie wird der Unterschied zwischen Selbsttätigkeit und Selbständigkeit definiert?
Die Arbeit definiert klar den Unterschied zwischen Selbsttätigkeit und Selbständigkeit. Dieser Aspekt wird im Kapitel 2.0 ausführlich behandelt und bildet die Grundlage für das Verständnis der methodischen Umsetzung.
Welche Rolle spielt die Lerntheorie?
Die konstruktivistische Lerntheorie wird herangezogen, um die Legitimation selbsttätigen Lernens zu untermauern und den theoretischen Rahmen der Arbeit zu bilden. Der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf das Lernen wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche methodischen Ansätze werden für selbsttätiges Lernen im Fremdsprachenunterricht diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Vermittlung von Lernstrategien und die Gestaltung handlungsorientierter Lernszenarien als methodische Ansätze zur Förderung der Selbsttätigkeit und Unterstützung der Selbständigkeit der Lernenden.
Welche Empfehlungen des Europarats werden berücksichtigt?
Die Empfehlungen des Europarats zur Förderung der Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht bilden eine wichtige Grundlage für die Argumentation der Arbeit.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Die Forschungsfrage, Legitimation selbsttätiger Lernformen, Methodische Umsetzung, Ausblick und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbsttätigkeit, Selbständigkeit, Lernerautonomie, Fremdsprachenunterricht, Lerntheorie, Konstruktivismus, Lernstrategien, Handlungsorientierung, Effektivität, Lehrerrolle.
- Quote paper
- Sandra Braunstorfer (Author), 2015, Selbsttätigkeit und Selbständigkeit im Fremdsprachenunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/301840