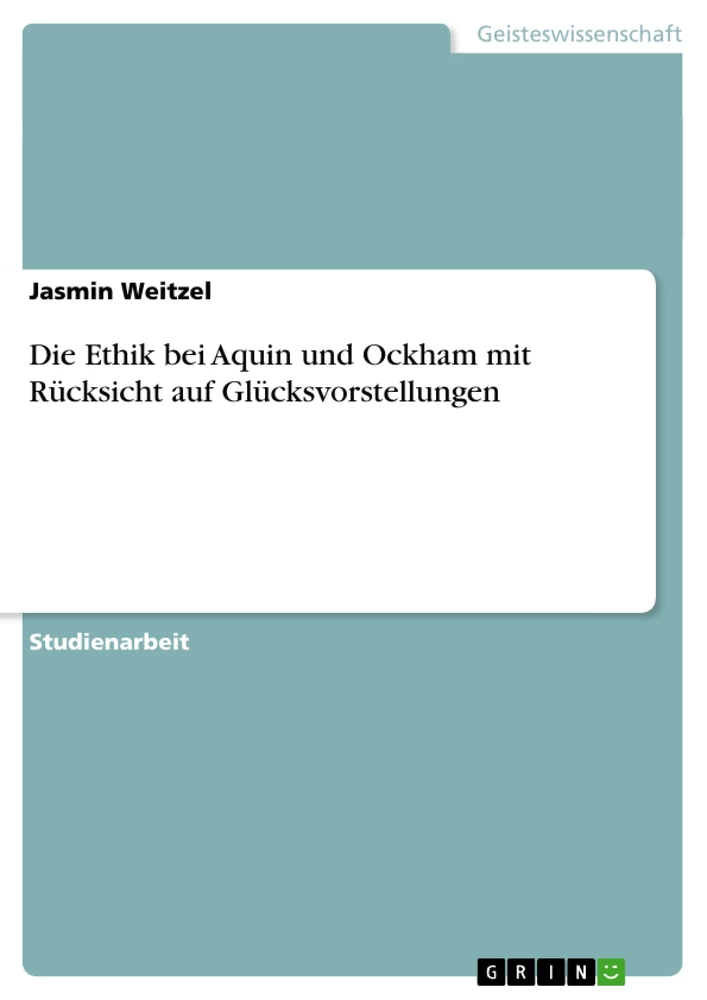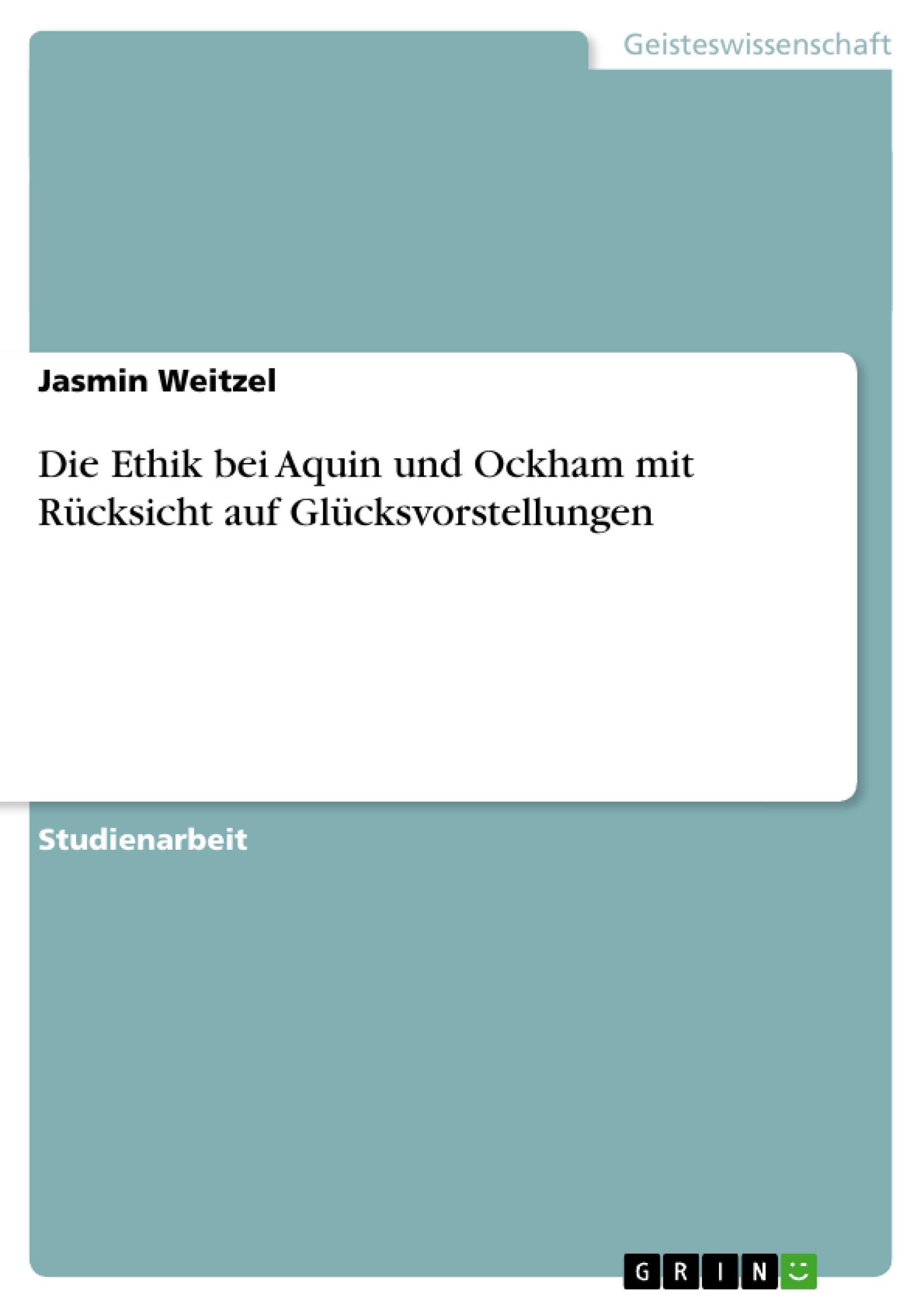Zu Beginn unserer Betrachtungen steht die Karolingische Renaissance durch Karl den Großen (742-814). 787 verfügt Karl der Große in der „Epistula Litteris Colendis“ die Einrichtung von Schulen an allen Klöstern und Domstiften. Dies ist eine wichtige Grundlage, damit sich Philosophen (Theologen) wie Aquin und Ockham überhaupt herausbilden können. An den Schulen können Geistliche und einflussreiche Laien die „artes magicae“ (die sieben dunklen Künste), die „artes liberales“ (die sieben freien Künste) und die „artes mechanicae“ (die sieben Künste des Handwerks) studieren. Die sieben dunklen Künste haben auch den Beinamen „die Verbotenen“. Die Studenten lernen hier die Künste der „geomantia“ (Erde), der „hydromantia“ (Wasser), der „aeromantia“ (Luft), der „pyromantia“ (Feuer), der „nigramantia“ (Dunkel), der „chiromantia“ (Hand) und der „spatulamantia“ (Schulterblatt“ kennen. Die sieben freien Künste untergliedern sich in die „artes reales“ (Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie) und die „artes formales“ (Grammatik, Rhetorik, Dialektik). Die sieben Künste des Handwerks tragen auch den Beinamen „die Geschmähten“. Die Studenten lernen hier „lanificium“ (Wollarbeit), „armatura“ (Waffenbau), „navigatio“ (Handel), „agricultura“ (Ackerbau), „venatio“ (Jagd), „medicina“ (Medizin) und „theatrica“ (Schauspiel) kennen und nutzen.
Die Scholastik beginnt im 8. und 9. Jahrhundert mit der Vorscholastik. Ein wichtiger vorscholastischer Denker ist Johannes Scotus Eriugena (810-877). Aus der Vorscholastik entwickelt sich zum einen die Mystik mit Bernhard von Clairvaux (1090/91-1154) und die Frühscholastik (10-12 Jh.) mit Denkern wie Anselm von Canterbury (1033-1109), Petrus Abaelard (1079-1142) und Rocellinus (1050-1124). Der Vorscholastik folgt die Hochscholastik im 13. Jh. Wichtige Denker sind hier Bonaventura (1221-1274), Meister Eckhart (1260-1327), Dante (1265-1321) und Roger Bacon (1215-1295). Außerdem die Denker, welche von Ockham unter „via antiqua“ eingestuft werden wie Albertus Magnus (1193-1280), welcher auch Lehrer von Aquin war, Thomas von Aquin (1225-1274) und Johannes Duns Scotus (1265-1308). Aquin versucht als einer der Ersten die wissenschaftliche Lehre Aristoteles’ (Naturwissenschaft) mit dem christlichen Glauben zu verbinden. Dadurch kann im 19. Jh. der „Neuthomismus“ entstehen. Man kann sagen, dass die Lehre von Thomas von Aquin zur „Philosophie“ der katholischen Kirche wird.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ethik im lateinischen Mittelalter
- 1.2 Glück(seligkeit) im Mittelalter
- 1.2.1 Glück
- 1.2.2 Glückseligkeit
- 2. Thomas von Aquin
- 2.1 Kurzbiographie
- 2.2 Zur Ethik
- 2.2.1 Der Begriff der Person
- 2.2.2 Die Tugenden
- 2.2.3 Die Vernunft
- 2.2.4 Die Gesetze
- 2.3 Glückseligkeit
- 3. William von Ockham
- 3.1 Kurzbiographie
- 3.2 Zur Ethik
- 3.2.1 Praxis und praktische Philosophie
- 3.2.2 Handlungen
- 3.2.3 Recta Ratio und das Gute
- 3.2.4 Über die Freiheit des Willens
- 3.2.5 Die Tugendlehre
- 3.3 Rückschlüsse auf das Glück
- 4. Die Glücksvorstellungen im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethischen Konzepte von Thomas von Aquin und William von Ockham, insbesondere im Hinblick auf ihre jeweiligen Glücksvorstellungen. Sie beleuchtet die Entwicklung der Ethik und des Glücksbegriffs im mittelalterlichen Kontext und vergleicht die Ansätze beider Denker.
- Ethik im lateinischen Mittelalter
- Der Glücksbegriff bei Thomas von Aquin
- Der Glücksbegriff bei William von Ockham
- Vergleich der ethischen Systeme von Aquin und Ockham
- Der Einfluss der Scholastik auf die Entwicklung der Ethik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der Scholastik, beginnend mit der karolingischen Renaissance und der Etablierung von Schulen. Sie beschreibt die Entwicklung der Scholastik von der Vorscholastik über die Hochscholastik bis zur Spätscholastik und ordnet Aquin und Ockham innerhalb dieses Entwicklungsbogens ein. Die Bedeutung der „artes liberales“ und „artes mechanicae“ für die intellektuelle Entwicklung dieser Epoche wird hervorgehoben. Anschließend werden die Begriffe Ethik und Glückseligkeit im mittelalterlichen Kontext definiert und differenziert, um die Grundlage für die anschließende Analyse der ethischen Systeme von Aquin und Ockham zu schaffen.
2. Thomas von Aquin: Dieses Kapitel bietet zunächst eine kurze Biografie Thomas von Aquins, die seine Herkunft, seine Ausbildung und seinen Eintritt in den Dominikanerorden beleuchtet. Der Hauptteil befasst sich mit Aquins Ethik, einschließlich seiner Konzepte von Person, Tugend, Vernunft und Gesetz. Seine Glücksvorstellung wird dargestellt, wobei die Rolle der göttlichen Gnade und die Frage nach dem Anspruch jedes Menschen auf ein glückseliges Leben im Mittelpunkt stehen. Der Einfluss von Aristoteles auf Aquins Denken wird dabei berücksichtigt. Das Kapitel beleuchtet Aquins Versuch, aristotelische Naturwissenschaft und christlichen Glauben zu vereinen, und die daraus resultierende Bedeutung für den Neuthomismus.
3. William von Ockham: Dieses Kapitel beginnt mit einer kurzen Biografie von William von Ockham und positioniert ihn in der Spätscholastik als Vertreter der „via moderna“. Es analysiert seine ethische Position, die sich in den Bereichen Praxis und praktische Philosophie, Handlungen, Recta Ratio und das Gute, Willensfreiheit und Tugendlehre manifestiert. Das Kapitel beleuchtet Ockhams „Ökonomieprinzip“ (Ockhams Rasiermesser) und untersucht, welche Schlussfolgerungen sich aus seinen ethischen Überlegungen für seine Glücksvorstellungen ziehen lassen. Die Unterschiede zu Aquins Ansatz werden subtil angedeutet, um den Vergleich im folgenden Kapitel vorzubereiten.
Schlüsselwörter
Thomas von Aquin, William von Ockham, Scholastik, Ethik, Glückseligkeit, Tugend, Vernunft, Gesetz, göttliche Gnade, „via antiqua“, „via moderna“, Ökonomieprinzip (Ockhams Rasiermesser), Aristoteles, christlicher Glaube, mittelalterliche Philosophie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Ethische Konzepte und Glücksvorstellungen bei Thomas von Aquin und William von Ockham
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text analysiert die ethischen Konzepte von Thomas von Aquin und William von Ockham, insbesondere im Hinblick auf ihre jeweiligen Glücksvorstellungen. Er beleuchtet die Entwicklung der Ethik und des Glücksbegriffs im mittelalterlichen Kontext und vergleicht die Ansätze beider Denker. Der Text bietet einen umfassenden Überblick, inklusive Einleitung, Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Ethik im lateinischen Mittelalter, der Glücksbegriff bei Thomas von Aquin und William von Ockham, ein Vergleich ihrer ethischen Systeme, der Einfluss der Scholastik auf die Ethikentwicklung und die Einordnung von Aquin und Ockham in den Kontext der scholastischen Philosophie (via antiqua und via moderna).
Wer sind die wichtigsten Figuren im Text?
Die Hauptfiguren sind Thomas von Aquin und William von Ockham, zwei bedeutende Denker des Mittelalters, deren ethische Positionen und Glücksvorstellungen im Detail untersucht werden. Der Text bezieht sich auch auf Aristoteles, dessen Einfluss auf Aquins Denken hervorgehoben wird.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist strukturiert in einer Einleitung, die den historischen Kontext und die Definitionen wichtiger Begriffe (Ethik, Glückseligkeit) liefert. Es folgen Kapitel über Thomas von Aquin (inklusive Biografie, Ethik, Glücksvorstellung und dem Einfluss des Aristoteles) und William von Ockham (inklusive Biografie, Ethik, Glücksvorstellung und seines Ökonomieprinzips). Ein abschließendes Kapitel vergleicht die Glücksvorstellungen beider Denker. Zusätzlich enthält der Text ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Aspekte der Ethik von Thomas von Aquin werden behandelt?
Der Text behandelt Aquins Konzepte von Person, Tugend, Vernunft und Gesetz, sowie seine Glücksvorstellung, die Rolle der göttlichen Gnade und den Versuch, aristotelische Naturwissenschaft und christlichen Glauben zu vereinen.
Welche Aspekte der Ethik von William von Ockham werden behandelt?
Der Text analysiert Ockhams ethische Positionen in Bezug auf Praxis und praktische Philosophie, Handlungen, Recta Ratio und das Gute, Willensfreiheit und Tugendlehre. Besondere Aufmerksamkeit wird seinem Ökonomieprinzip (Ockhams Rasiermesser) gewidmet.
Wie werden die ethischen Systeme von Aquin und Ockham verglichen?
Der Text vergleicht die ethischen Systeme beider Denker, insbesondere ihre unterschiedlichen Glücksvorstellungen. Die Unterschiede zwischen der „via antiqua“ (Aquin) und der „via moderna“ (Ockham) werden subtil angedeutet und bilden einen Schwerpunkt des Vergleichs.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Thomas von Aquin, William von Ockham, Scholastik, Ethik, Glückseligkeit, Tugend, Vernunft, Gesetz, göttliche Gnade, „via antiqua“, „via moderna“, Ökonomieprinzip (Ockhams Rasiermesser), Aristoteles, christlicher Glaube und mittelalterliche Philosophie.
- Quote paper
- Jasmin Weitzel (Author), 2004, Die Ethik bei Aquin und Ockham mit Rücksicht auf Glücksvorstellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/30037