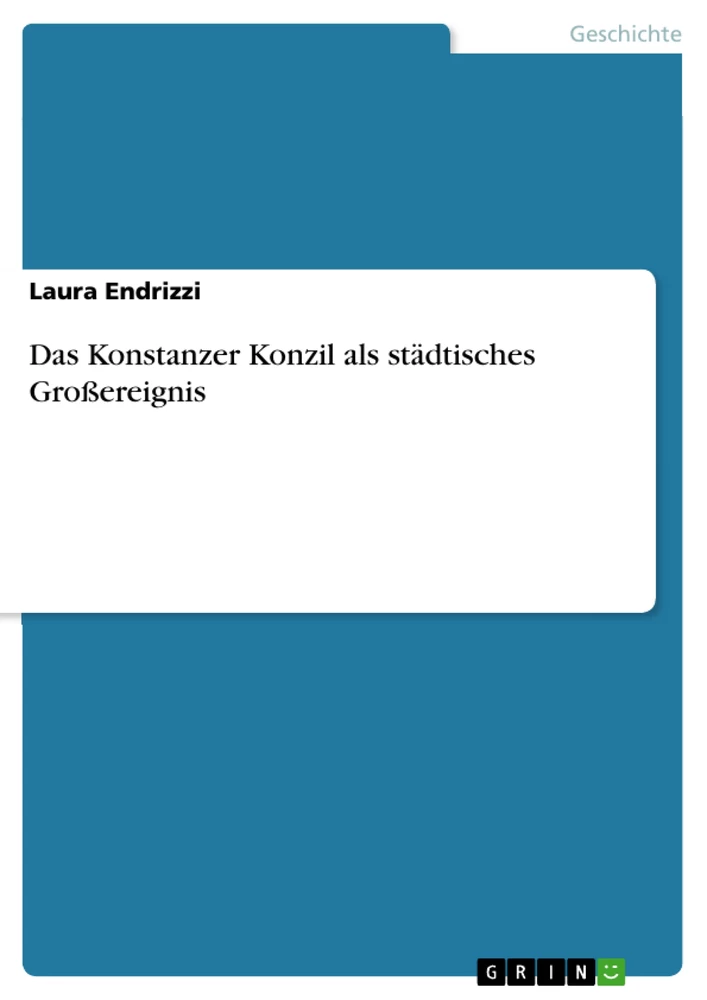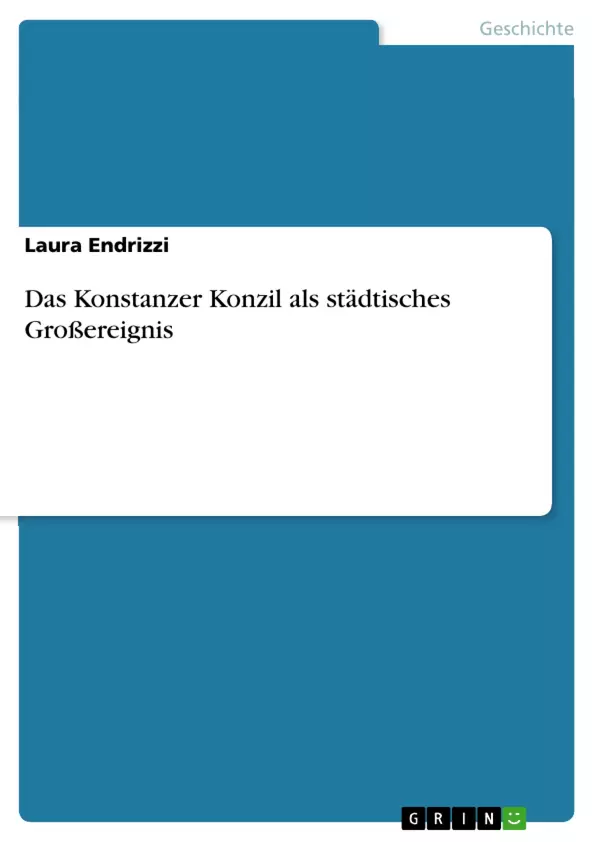Das Konzil zu Konstanz wurde 1414 einberufen, um schwere Missstände in der Kirche zu beseitigen. Besonders galt es, das seit 1378 bestehende Schisma zu beenden und so die Einheit der Katholischen Kirche wieder herzustellen. Alle früheren Versuche, diesen unwürdigen Zustand zu beenden, waren fehlgeschlagen, weil sowohl der römische Papst als auch der Gegenpapst in Avignon davon überzeugt waren, ihr Amt zu Recht auszuüben.
Der letzte Versuch der Kardinäle, beide Päpste abzusetzen und einen neuen zu wählen hatte dazu geführt, dass es seit 1409 nunmehr drei Päpste gab, die alle drei davon ausgingen, dass sie das alleinige rechtmäßige Oberhaupt der Christenheit waren. 1414 waren das der aus Venedig stammende und in Rom gewählte Gregor XII., der Spanier Benedikt XII. in Avignon, und, als Nachfolger des in Pisa gewählten Papstes, der Neapolitaner Johannes XXIII.
Jeder dieser drei Amtsinhaber hatte seine Anhänger und Verteidiger, nationale Interessen spielten dabei eine große Rolle. Der deutsche König und spätere Kaiser Sigismund setzte sich energisch für eine Lösung des Konfliktes ein. Er wollte einen neutralen Tagungsort auf deutschem Boden und bestimmte Konstanz zum Ort des Konzils, gegen den Wunsch Johannes des XXIII., der ein Treffen in Italien vorgezogen hätte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Aufgabe des Konzils und Standortwahl
- Hauptteil: Das Konzil als städtisches Großereignis
- Ist der Begriff „städtisches Großereignis“ für das Konzil von Konstanz zutreffend?
- Die Chronik Ulrichs von Richental
- Arbeitsplätze für Fremde
- Höchstpreise für Unterkunft und Verpflegung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzil von Konstanz (1414-1418) unter dem Aspekt seiner städtischen Dimension. Sie analysiert, inwiefern sich das Konzil als ein städtisches Großereignis verstehen lässt und welche Auswirkungen es auf die Stadt Konstanz hatte.
- Das Konzil als städtisches Großereignis im Sinne von Veränderungen und Unterbrechungen des historischen Zeitkontinuums
- Die Rolle der Stadt Konstanz als Versorgungsorgan und der Einfluss des Konzils auf die städtische Infrastruktur
- Die Bedeutung der Chronik Ulrichs von Richental für die Rezeption des Konzils als städtisches Großereignis
- Die Auswirkungen des Konzils auf die städtische Wirtschaft und die Lebensbedingungen der Konstanzer Bevölkerung
- Die Bedeutung des Bischofsstuhls von Konstanz für die Wahl der Stadt als Tagungsort
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Aufgabe des Konzils und Standortwahl
Die Einleitung stellt die Aufgabe des Konzils von Konstanz dar, nämlich die Beendigung des großen Kirchenstreits (Schisma) und die Wiederherstellung der Einheit der Katholischen Kirche. Die Wahl von Konstanz als Tagungsort wird erläutert, wobei die geografische Lage und die Infrastruktur der Stadt als entscheidende Faktoren hervorgehoben werden.
Hauptteil: Das Konzil von Konstanz als städtisches Großereignis
Ist der Begriff „städtisches Großereignis“ für das Konzil von Konstanz zutreffend?
Dieses Kapitel untersucht, ob das Konzil von Konstanz als ein städtisches Großereignis betrachtet werden kann. Der Autor analysiert den Begriff des „städtischen Großereignisses“ und zeigt auf, wie das Konzil die Stadt Konstanz in ihren Alltag und ihre Strukturen einbezog.
Die Chronik Ulrichs von Richental
Der Abschnitt beleuchtet die Chronik von Ulrich von Richental als wichtige Quelle für die Rezeption des Konzils. Die Chronik beschreibt die Ereignisse des Konzils aus der Perspektive der Konstanzer Bürgerschaft und beleuchtet die Auswirkungen des Konzils auf das Alltagsleben der Stadt.
Arbeitsplätze für Fremde
Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen des Konzils auf die städtische Wirtschaft. Es wird gezeigt, wie das Konzil zu einer Steigerung der Arbeitskräfte und der wirtschaftlichen Aktivität in Konstanz führte.
Höchstpreise für Unterkunft und Verpflegung
Der Abschnitt analysiert die Auswirkungen des Konzils auf die Lebenshaltungskosten in Konstanz. Es wird gezeigt, wie das Konzil zu einer starken Nachfrage nach Unterkünften und Lebensmitteln führte, was zu Preissteigerungen führte.
Schlüsselwörter
Konzil von Konstanz, städtisches Großereignis, Chronik Ulrichs von Richental, Kirchenstreit, Schisma, Einheit der Katholischen Kirche, Infrastruktur, Wirtschaft, Lebensbedingungen, Preissteigerungen, Bischofstadt, Konstanz.
Häufig gestellte Fragen
Warum fand das Konzil ausgerechnet in Konstanz statt?
Konstanz lag verkehrsgünstig auf deutschem Boden, verfügte über die nötige Infrastruktur zur Versorgung tausender Gäste und war ein neutraler Tagungsort.
Was war die Hauptaufgabe des Konzils von Konstanz?
Die Beendigung des Abendländischen Schismas, also die Überwindung der Spaltung der Kirche, in der es zeitweise drei Päpste gleichzeitig gab.
Wer war Ulrich von Richental?
Ein Konstanzer Bürger, dessen Chronik eine der wichtigsten Quellen für das Alltagsleben und die Organisation während des Konzils darstellt.
Wie wirkte sich das Konzil auf die Preise in der Stadt aus?
Durch die enorme Nachfrage nach Unterkunft und Verpflegung stiegen die Preise massiv an, was die Einführung von Höchstpreisen erforderlich machte.
Warum wird das Konzil als „städtisches Großereignis“ bezeichnet?
Weil es das normale Zeitkontinuum der Stadt unterbrach, tausende Fremde Arbeitsplätze schufen und die gesamte städtische Wirtschaft für Jahre dominierte.
- Arbeit zitieren
- Laura Endrizzi (Autor:in), 2012, Das Konstanzer Konzil als städtisches Großereignis, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/298414