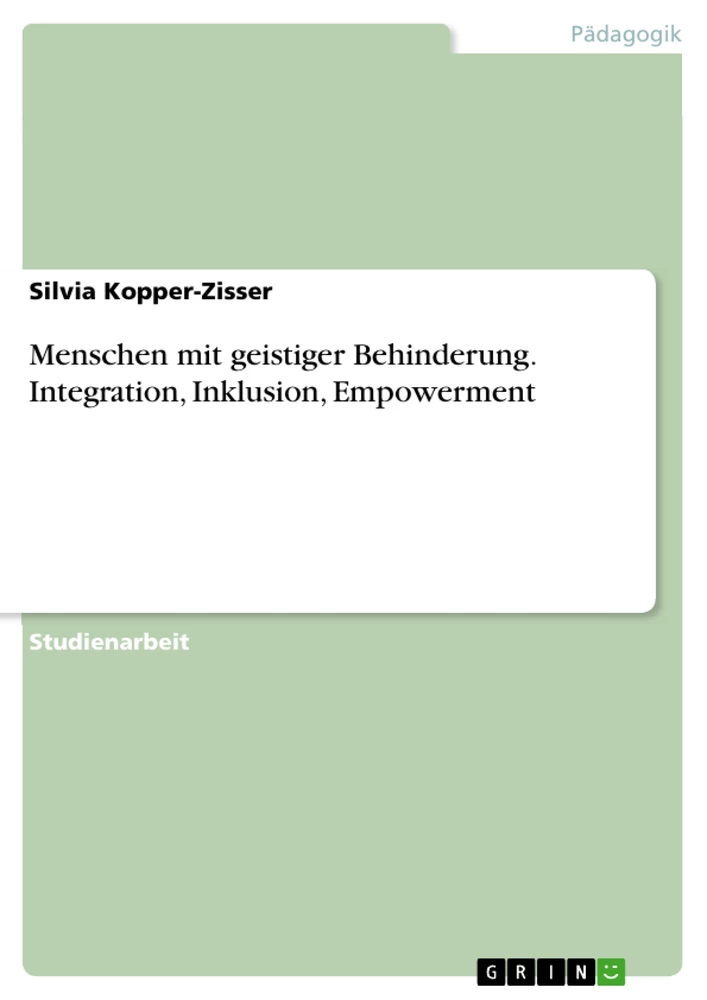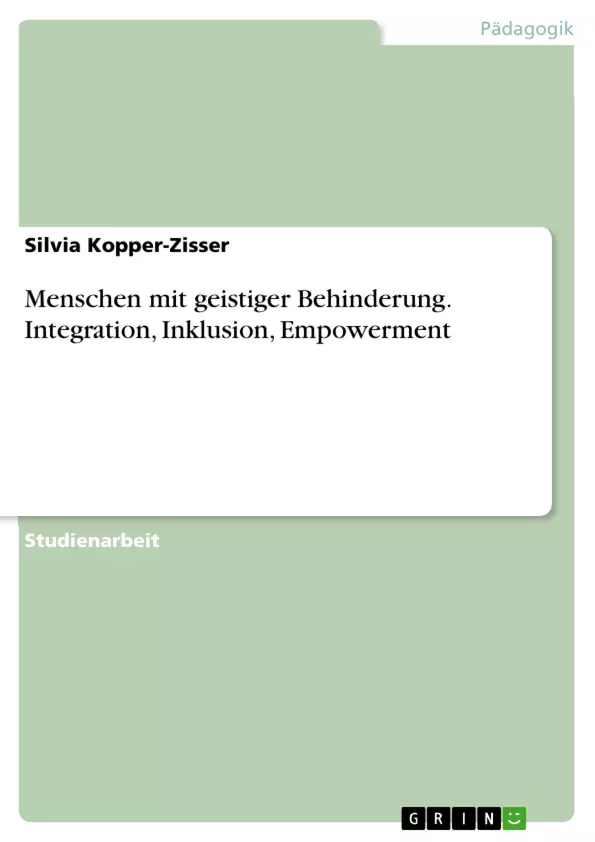Schon seit Jahrtausenden werden Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt, stigmatisiert und sogar bekämpft. Ebenso Menschen mit geistiger Behinderung, die oft noch als „anders“, als nicht „normal“ angesehen werden. „Normale“ Menschen werden zwar im Allgemeinen für dieses Thema sensibilisiert, aber dies führt häufig nur zu einer Schein-Akzeptanz. Deshalb schien es nötig, im Laufe der letzten Jahre die Konzepte Integration, Inklusion und Empowerment zu entwickeln, um Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu ermutigen, sich selbst, ihrer Fähigkeiten und ihrer Fertigkeiten bewusst zu werden, um sie zum Einsatz kommen zu lassen.
Es wird davon ausgegangen, dass die historische Sichtweise der Gesellschaft die Grundlage für die derzeitige Wahrnehmung bildet. Dies bietet die Möglichkeit, sich der Folgen für die heutige Sichtweise bewusst zu werden und aufzuzeigen, wie sehr sich Vorurteile bezüglich Menschen mit Behinderungen im Laufe der Jahrhunderte fixieren konnten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Menschen mit Behinderung - historisch
- Historische Entwicklung
- Sozialdarwinismus
- Eugenik
- Rassenhygiene
- Nachkriegszeit
- Der Begriff Behinderung
- Organisationen
- Menschen mit geistiger Behinderung oder Menschen mit Lernschwierigkeiten?
- Soziologischer Zugang der Begriffsfindung
- Ausgrenzung, Diskriminierung, Stigmatisierung
- Pränatale Diagnostik und Schwangerschaftsabbruch
- Diskriminierung
- Stigmatisierung
- Integration, Inklusion und Empowerment
- Integration
- Inklusion
- Empowerment - Selbstbestimmung
- Das Empowerment-Konzept
- Ethische Aspekte
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Konzepten Integration, Inklusion und Empowerment im Kontext von Menschen mit geistiger Behinderung. Sie analysiert die historische Entwicklung der Sichtweise auf Menschen mit Behinderung, untersucht verschiedene Begriffsdefinitionen und beleuchtet die Herausforderungen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung.
- Die historische Entwicklung der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung
- Die Definitionen und Relevanz der Begriffe Integration, Inklusion und Empowerment
- Die Auswirkungen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung auf Menschen mit geistiger Behinderung
- Ethische Aspekte im Zusammenhang mit Menschen mit geistiger Behinderung
- Der Beitrag der Konzepte Integration, Inklusion und Empowerment zur Überwindung von Stigmatisierung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Sichtweise auf Menschen mit Behinderung, beginnend mit dem alten Ägypten und dem Mittelalter. Er zeigt auf, wie Menschen mit Behinderungen oft als göttlich beschützt, als sündhaft oder als "anders" angesehen wurden.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Begriffsdefinitionen von Behinderung diskutiert, um zu verdeutlichen, wie stark diese Begriffe von Ausgrenzung, Diskriminierung und Klassifizierung geprägt sind.
Kapitel 3 behandelt die Begriffe Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung, die das Leben von Menschen mit Behinderung maßgeblich beeinflussen.
Kapitel 4 stellt die Konzepte Integration, Inklusion und Empowerment als Lösungsansätze vor, die zum Ziel haben, Menschen mit geistiger Behinderung zu ermächtigen und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern.
Im fünften Kapitel werden kurz ethische Aspekte im Zusammenhang mit Menschen mit geistiger Behinderung beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Integration, Inklusion, Empowerment, Menschen mit geistiger Behinderung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Stigmatisierung, historische Entwicklung, Sozialdarwinismus, Eugenik, Rassenhygiene, Selbstbestimmung und ethische Aspekte.
- Quote paper
- Silvia Kopper-Zisser (Author), 2014, Menschen mit geistiger Behinderung. Integration, Inklusion, Empowerment, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/296276