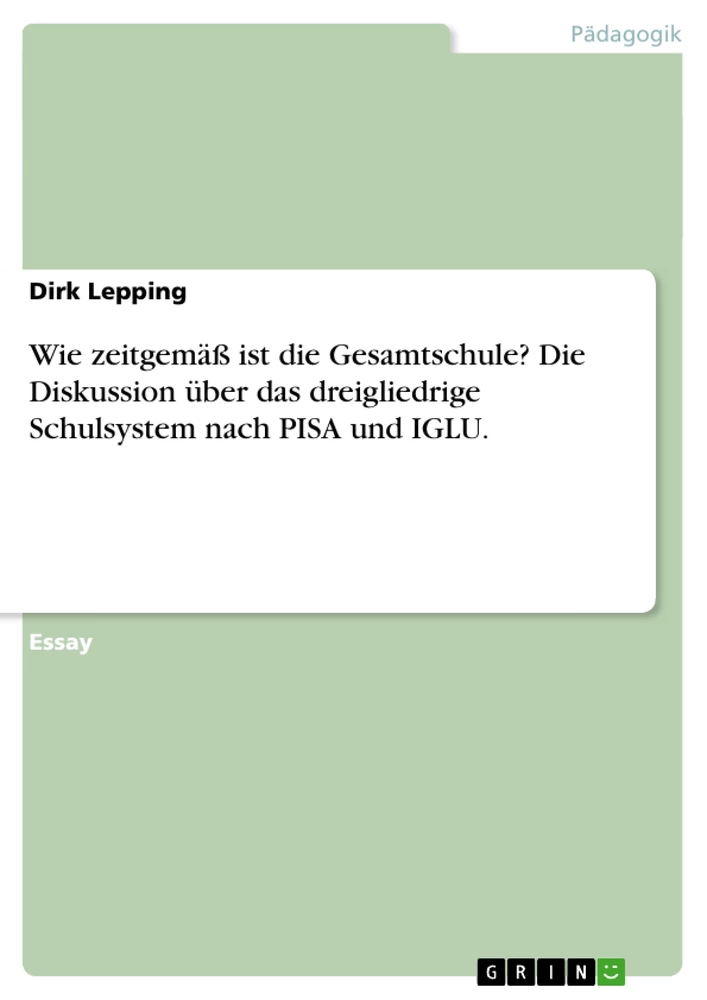Im Jahre 1964 sorgte Georg Picht mit seiner Aussage über die „Deutsche Bildungskatastrophe“ für Alarmstimmung und brachte die Bildungspolitik ganz oben auf die politische Agenda. Eine ähnliche Situation finden wir momentan vor. Die PISA-Studie 2000 hatte Deutschland eindeutig vor Augen geführt, dass das deutsche Bildungssystem in der Krise steckt. Deutschland, das wie kaum ein anderes Land in der Welt auf sein Humanvermögen angewiesen ist, hinkte im weltweiten Vergleich schulischer Leistung hinter den Besten her. Der Wandel der außerschulischen Erziehungsbedingungen und die zukünftigen Bildungs- und Qualifikationsanforderungen stellen veränderte Herausforderungen an schulische Bildungs- und Erziehungsprozesse, denen die deutsche Halbtagsschule mit ihrer gegenwärtigen institutionellen, dreigliedrigen Struktur nicht mehr gewachsen zu sein scheint. Die Bekanntgabe der desaströsen Ergebnisse für Deutschlands Schüler und der mangelnden Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems lösten eine bundesweite, häufig wenig faktenorientierte Debatte um den Stand des deutschen Bildungssystems aus, die unter dem Begriff „PISA-Schock“ subsummiert werden kann. Folge des „PISA-Schocks“ waren zahllose Reformvorschläge, von denen jedoch die meisten zu kurz griffen, weil sie weder die Struktur noch die innere Gestaltung der Schulen im Kern berührten. Die eigentliche Kernfrage der Diskussion war jedoch, welche Reformen am deutschen Schulsystem sich objektiv aus den PISA-Ergebnissen ableiten ließen. Eine der zentralen Fragen war das Für und Wider des dreigliedrigen Schulsystems in Kontrast zu integrativen Schulsystemen. Diese Kontroverse ist gerade deshalb so brisant, weil beide Seiten starke Argumente vorbringen. Neben der Einführung integrierter Schulsysteme, wie der Gesamtschule oder der „Mittelschule“, spielen aber auch die Forderungen nach mehr ganztägiger Schulbetreuung und einer Verlängerung der Grundschulzeit eine wichtige Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- PISA
- Einwände gegen das dreigliedrige Schulsystem
- Reformvorschläge
- Gesamtschule
- Zweigliedriges Schulsystem als Kompromiss?
- Verlängerte Grundschule
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Zeitgemäßheit des deutschen dreigliedrigen Schulsystems im Kontext der PISA-Ergebnisse. Er analysiert die Kritik am bestehenden System, insbesondere die frühe Selektion und die mangelnde soziale Integration, sowie die Forderungen nach Reformen. Die Bedeutung von Gesamtschulen und anderen alternativen Schulformen wird im Hinblick auf die Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit und des Leistungsspiegels diskutiert.
- Kritik am dreigliedrigen Schulsystem
- Frühe Selektion und soziale Ungleichheit
- Mangelnde Anwendungskompetenzen und Integration
- Reformvorschläge: Gesamtschule, zweigliedriges System, verlängerte Grundschule
- Bildungsökonomische und pädagogische Aspekte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text führt in das Thema ein und stellt den Zusammenhang zwischen der PISA-Studie und der Diskussion über die Reform des deutschen Bildungssystems dar.
- PISA: Diese Kapitel bietet einen Überblick über die zentralen Ergebnisse der PISA-Studie und deren Bedeutung für die deutsche Bildungslandschaft.
- Einwände gegen das dreigliedrige Schulsystem: Dieser Abschnitt analysiert die Kritikpunkte am deutschen dreigliedrigen Schulsystem, insbesondere die Folgen der frühen Selektion und die mangelnde Durchlässigkeit.
- Reformvorschläge: Dieser Teil des Textes erörtert verschiedene Reformvorschläge, die im Zuge der PISA-Diskussion diskutiert wurden, mit einem Schwerpunkt auf der Gesamtschule.
Schlüsselwörter
Dreigliedriges Schulsystem, PISA-Studie, Gesamtschule, soziale Ungleichheit, Bildungsreform, frühe Selektion, Anwendungskompetenzen, Bildungsökonomie, pädagogische Aspekte, Chancengleichheit.
- Arbeit zitieren
- Dirk Lepping (Autor:in), 2004, Wie zeitgemäß ist die Gesamtschule? Die Diskussion über das dreigliedrige Schulsystem nach PISA und IGLU., München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/29452