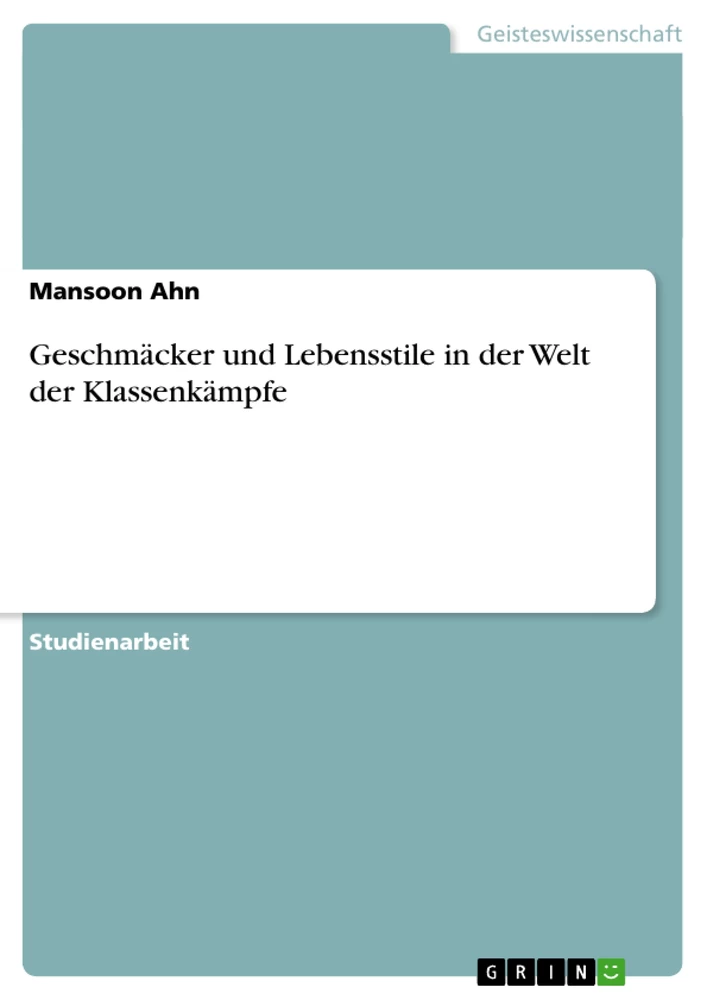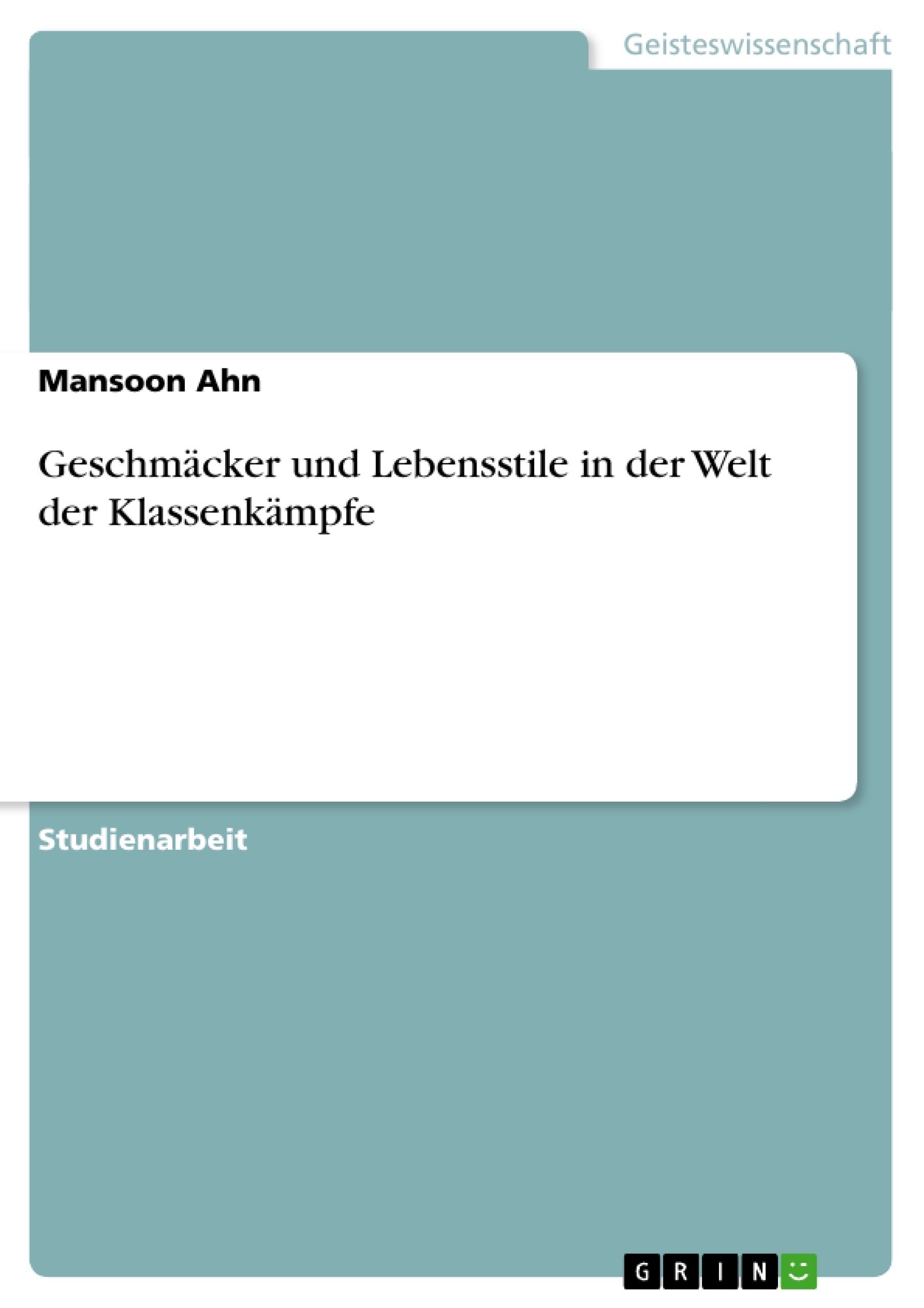Bourdieus Konzeption geht von der Annahme aus, dass die verschiedenen Lebensstile vor allem Ausdruck verschiedener Klassenzugehörigkeiten sind und die „Geschmäcker“ und Lebensstile mit der Klassenzugehörigkeit korrelieren. Um diese Korrelation zwischen den Geschmäckern und Lebensstilen mit der Klassenzugehörigkeit zu erfassen, wird diese Arbeit wie folgt aufgebaut: Zunächst wird Bourdieus These im Vergleich zu zwei anderen Thesen von Beck und Schulz diskutiert. Als Kultursoziologe beschäftigt sich Bourdieu mit der subjektiven Alltagpraxis konkreter Individuen, die er jedoch ausschließlich als Repräsentantinnen und Repräsentanten einer Gruppe mit bestimmten sozioökonomischen Merkmalen versteht. Er bindet objektive Strukturen immer an die Alltagspraxis zurück. Bourdieu hat daher den Versuch in seiner Habitustheorie unternommen, die herkömmliche Sozialstrukturanalyse mit den verschiedenartigen Lebensstilen zu kombinieren. Dabei richtet er seine Aufmerksamkeit vor allem auf die drei Geschmacks-Dimensionen, die mit entsprechenden sozialen Räumen bzw. Klassenzugehörigkeiten verbunden sind. Als Unterscheidungskriterium für die Klassenzugehörigkeit dient hierbei der Besitz der Kapitalformen des kulturellen Kapitals, d.h. der Schulausbildung, und des sozialen Kapitals, der förderlichen Beziehungen, überlagert das ökonomische Kapital. In diesem Sinne wird anschließend die Kultursoziologie Bourdieus dargestellt. Dieser Schritt ist in drei Teile Struktur, Habitus und Praxis/Geschmack aufgeteilt. Struktur-Habitus-Praxis ist die allgemeine Formel, die Bourdieu unterschiedslos auf alle Gesellschaftstypen anwendet. In einem letzten Schritt wird über die Schlussfolgerung der These Bourdieus und deren Kritik diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. EINSTIEG
- III. DIE KULTURSOZIOLOGIE BOURDIEUS
- 3.1. Struktur
- 3.1.1 Kapitalsorten
- a) Ökonomisches Kapital (die grundlegende Kapitalsorte)
- b) Soziales Kapital
- c) Kulturelles Kapital
- 1) Inkorporiertes Kulturkapital
- 2) Objektiviertes Kulturkapital
- 3) Institutionalisiertes Kulturkapital
- 3.1.2 Dimension
- 3.1.1 Kapitalsorten
- 3.2. Habitus
- 3.3. Praxis/Geschmack
- 3.3.1 Der legitime Geschmack
- 3.3.2 Der mittlere Geschmack
- 3.3.3 Der populäre Geschmack
- 3.1. Struktur
- 4. ZUSAMMENFASSUNG
- 5. LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Bourdieus Theorie der Distinktion und deren Anwendung auf Geschmäcker und Lebensstile in einer Klassengesellschaft. Ziel ist es, die Grundzüge dieser Theorie darzustellen und ihren Beitrag zur soziokulturellen Klassentheorie zu beleuchten.
- Das Konzept des kulturellen Kapitals und seine verschiedenen Formen
- Der Habitus als Verkörperung der sozialen Prägung und sein Einfluss auf den Geschmack
- Die Rolle von Geschmack und Lebensstil als Mittel der Distinktion und Reproduktion von Klassenstrukturen
- Die Kritik an der traditionellen Klassenanalyse und die Integration von Lebensstilen in die Soziologie
- Die Auseinandersetzung mit alternativen Theorien zur Erklärung sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert den Hintergrund der Analyse von Geschmäckern und Lebensstilen im Kontext der Klassenkämpfe. Bourdieus „Die feinen Unterschiede“ wird als zentrales Werk vorgestellt, das eine empirisch und theoretisch fundierte Untersuchung der Klassendifferenzierung durch Geschmack und Lebensstil bietet. Es wird die These Bourdieus erläutert, dass Geschmack nicht individuell, sondern sozial determiniert ist und als Mittel der Abgrenzung und Distinktion dient. Die Rezeption Bourdieus in der westdeutschen Soziologie wird kurz beleuchtet, sowie sein Interesse am Zusammenhang von Kultur, Herrschaft und sozialer Ungleichheit.
2. Einstieg
Dieses Kapitel vergleicht die Theorien von Bourdieu mit denen von Beck und Schulze im Hinblick auf die gesellschaftlichen Veränderungen und die Interpretation der Ungleichheit in modernen Gesellschaften. Beck argumentiert, dass soziale Unterschiede an Relevanz verlieren und individuelle Präferenzen an Bedeutung gewinnen, während Schulze von einer „Erlebnisgesellschaft“ spricht, in der verschiedene Milieus mit unterschiedlichen Lebensstilen existieren. Bourdieu hingegen betont die Persistenz der Klassengesellschaft, in der Lebensstile Ausdruck von Klassenzugehörigkeiten sind und als Mittel des Kampfes dienen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter und Themen: Geschmack, Lebensstil, Klassengesellschaft, Distinktion, kulturelles Kapital, Habitus, Pierre Bourdieu, Sozialstruktur, Kultursoziologie, Klassenkampf, Sozialer Raum.
- Arbeit zitieren
- MA. Mansoon Ahn (Autor:in), 1998, Geschmäcker und Lebensstile in der Welt der Klassenkämpfe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/29342