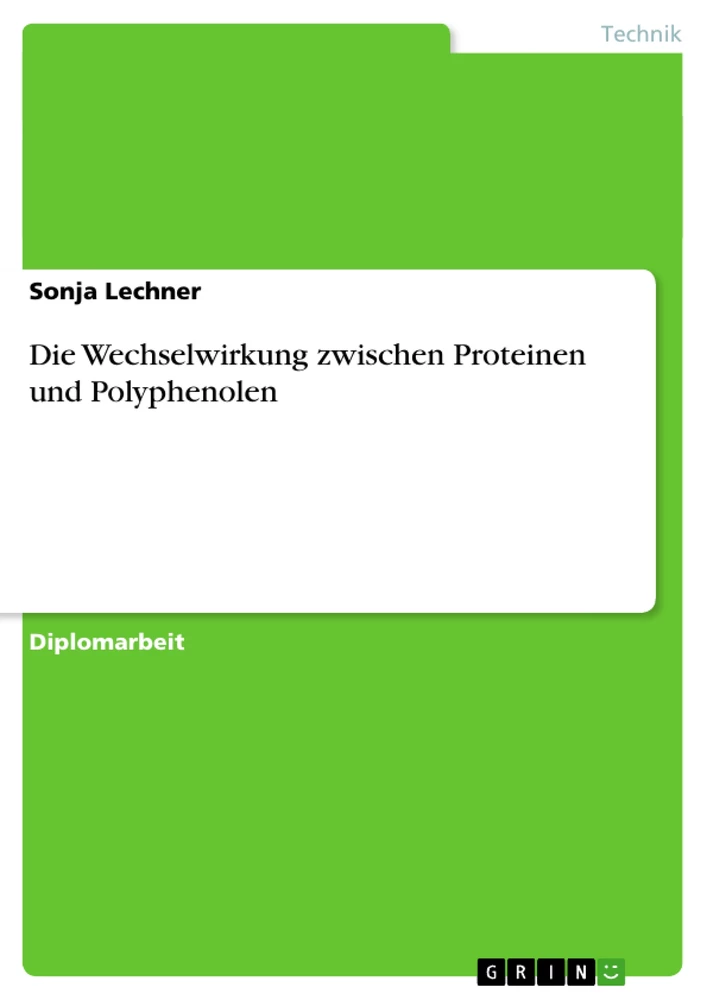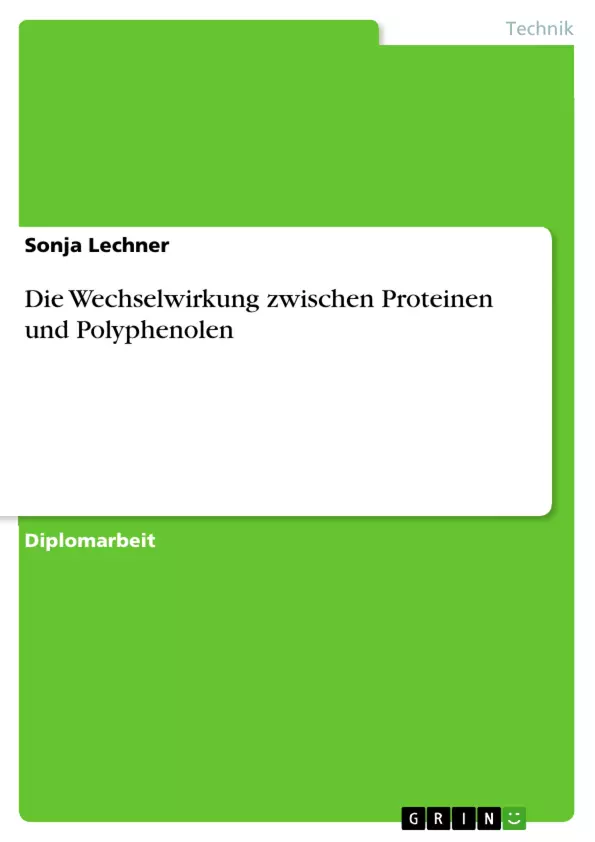Primäre Pflanzenstoffe (z.B Kohlenhydrate) als auch Sekundäre Pflanzenstoffe (z.B Polyphenole) sind für die Ernährung des Menschen von großer Bedeutung. Die Sekundären Pflanzenstoffe spielten lange Zeit neben den Vitaminen und Mineralstoffen eine untergeordnete Rolle. Erst jetzt erkennt man die Wichtigkeit der sekundären Pflanzenstoffe indem man ihnen gesundheitsfördernde Eigenschaften und Schutzfunktionen zuschreibt. Zum Beispiel hemmen Polyphenole das Wachstum von Bakterien und Viren und schützen den Körper vor freien Radikalen.
Weit über 250 epidemiologische Studien belegen, dass ein hoher Gemüse- und Obstverbrauch sich auf viele Zivilisationskrankheiten positiv auswirkt. Dabei wurden die Essgewohnheiten von 265.118 Japanern überprüft. Die Studien ergaben eine Verringerung der Lebenserwartung von Rauchern um ca. 5 Jahre. Bei Studienteilnehmern die rauchten, regelmäßig Alkohol tranken und sich fleischreich und gemüsearm ernährten, lag die Lebenserwartung ca. 10 Jahre unter dem Durchschnitt. Die Krebs- oder Herzerkrankungen waren in dieser Gruppe deutlich erhöht.
Ein möglicher Gründe für die vorbeugende Wirkung von Obst und Gemüse ist vermutlich die Tatsache, das sekundäre Pflanzenstoffe freie Radikale fangen und diese unschädlich machen.
Freie Radikale sind instabile hochreaktive Atome oder Verbindungen, die mit
organischen Molekülen der Zelle reagieren und sie so funktionsuntüchtig machen.
Das Charakteristikum aller freien Radikale ist, dass sie ein ungepaartes Elektron
besitzen oder ihnen eines fehlt. Sie versuchen überzählige Elektronen los zu werden
oder eines einzufangen, den nur eine gerade Anzahl von Elektronen bewirkt einen
stabilen Zustand. Ein einsames Elektron ohne Partner bedeutet eine hohe
Reaktionsbereitschaft und ein aggressives Verhalten gegenüber anderen Molekülen.
Trifft ein freies Radikal auf eine organische Verbindung (z.B ungesättigte Fettsäuren)
wird es versuchen ein Elektron aufzunehmen oder abzugeben. Der unvollständige,
ungerade Elektronenzustand des freien Radikals wird auf ungesättigte Fettsäuren
übertragen. Die ungesättigte Fettsäure wird selbst zum Radikal. Die Aufgabe, z.B als Baustein der Zellmembran für einen stabilen Schutz nach außen zu wirken, geht verloren. Die ungesättigte Fettsäure versucht wieder ein Elektron aufzunehmen um wieder einen stabilen Zustand zu erreichen. So kommt eine Kettenreaktion zustande.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 POLYPHENOLE
- 1.1.1 BIOVERFÜGBARKEIT UND STOFFWECHSEL
- 1.1.2 ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
- 1.2 PROTEINE
- 1.2.1 PROTEINFÄLLUNG
- 1.2.2 PROTEINDENATURIERUNG
- 1.2.3 LYSOZYM
- 1.1 POLYPHENOLE
- 2. ZIEL DER DIPLOMARBEIT
- 3 MATERIAL UND METHODE
- 3.1 MATERIALIEN
- 3.2 METHODEN
- 3.2.1 CHROMATOGRAPHIE
- 3.2.2 HPLC (HIGH PRESSURE LIQUID CHROMATOGRAPHY)
- 3.2.3 MASSENSPEKTROMETER (MS)
- 4 VERSUCHSBESCHREIBUNG
- 5 ERGEBNISSE UND DISKUSSION
- 5.1 FRAGESTELLUNGEN
- 5.2 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
- 6. LITERATUR
- 7. ANHANG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Polyphenolen. Das Hauptziel besteht darin, die Auswirkungen verschiedener Polyphenole auf die Struktur und Funktion von Proteinen zu analysieren. Dies geschieht durch experimentelle Untersuchungen unter verschiedenen Temperaturbedingungen.
- Einfluss von Polyphenolen auf Proteine
- Untersuchung der Proteinstrukturveränderungen
- Einfluss der Temperatur auf die Protein-Polyphenol-Wechselwirkung
- Anwendung chromatographischer und elektrophoretischer Methoden
- Vergleich mit bestehenden Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in die Welt der Polyphenole und Proteine. Es beleuchtet die Bedeutung der Bioverfügbarkeit und des Stoffwechsels von Polyphenolen und deren Rolle in der Ernährungsphysiologie. Im Proteine-Abschnitt werden grundlegende Konzepte wie Proteinfällung und -denaturierung erläutert, wobei Lysozym als Beispielprotein vorgestellt wird. Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein für die experimentellen Untersuchungen der Diplomarbeit und definiert den Kontext der Forschung.
3 MATERIAL UND METHODE: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Materialien und Methoden, die in der Diplomarbeit verwendet wurden. Es spezifiziert die verwendeten Chemikalien und Geräte, einschließlich der HPLC- und Massenspektrometrie-Methoden. Die detaillierte Beschreibung der Methoden ermöglicht die Reproduzierbarkeit der Experimente und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Die präzise Darstellung der Methoden ist essentiell für die wissenschaftliche Validität der Arbeit.
4 VERSUCHSBESCHREIBUNG: Dieses Kapitel dokumentiert die verschiedenen experimentellen Ansätze, die zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Quercetin (einem Polyphenol) und verschiedenen Proteinen (Lysozym, BSA, Hämoglobin) bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt wurden. Es beschreibt die detaillierte Vorgehensweise bei jedem Ansatz, inklusive der Probenvorbereitung und der angewendeten analytischen Methoden. Die verschiedenen Ansätze zielen darauf ab, die Komplexität der Protein-Polyphenol-Wechselwirkung unter verschiedenen Bedingungen zu untersuchen und ein umfassendes Bild der Interaktionen zu gewinnen. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte erlaubt es anderen Forschern, die Experimente zu reproduzieren und die Ergebnisse zu verifizieren. Das Kapitel beschreibt auch Gegenproben, um die erhaltenen Resultate zu validieren und Artefakte auszuschließen. Es schließt mit einer Überprüfung einer bestehenden Methode von Harshadrai M. Rawel et al. (2000) ab.
5 ERGEBNISSE UND DISKUSSION: Dieses Kapitel präsentiert und diskutiert die Ergebnisse der durchgeführten Experimente. Es wird eine detaillierte Zusammenfassung der erhaltenen Daten geliefert, die mit den theoretischen Grundlagen aus dem einleitenden Kapitel in Beziehung gesetzt werden. Die Diskussion der Ergebnisse zielt darauf ab, die gewonnenen Erkenntnisse zu interpretieren und mögliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien und der kritische Bezug zu den angewendeten Methoden ergänzen die Diskussion.
Schlüsselwörter
Polyphenole, Proteine, Wechselwirkung, Lysozym, BSA, Hämoglobin, Quercetin, HPLC, Massenspektrometrie, Gelelektrophorese, Proteindenaturierung, Proteinstruktur, Temperatur, Ernährungsphysiologie.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Wechselwirkung zwischen Proteinen und Polyphenolen
Was ist das Hauptthema dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Polyphenolen, insbesondere den Einfluss verschiedener Polyphenole auf die Struktur und Funktion von Proteinen unter verschiedenen Temperaturbedingungen.
Welche Polyphenole und Proteine wurden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Polyphenol Quercetin und die Proteine Lysozym, BSA (Rinderserumalbumin) und Hämoglobin.
Welche Methoden wurden verwendet?
Es wurden chromatographische und elektrophoretische Methoden eingesetzt, insbesondere HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) und Massenspektrometrie. Die Arbeit beschreibt detailliert die angewendeten Methoden, um die Reproduzierbarkeit der Experimente zu gewährleisten.
Welche Kapitel umfasst die Diplomarbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (mit Unterkapiteln zu Polyphenolen und Proteinen), Ziel der Diplomarbeit, Material und Methode, Versuchsbeschreibung, Ergebnisse und Diskussion, Literaturverzeichnis und Anhang. Die Einleitung bietet einen umfassenden Überblick über Polyphenole und Proteine, inklusive ihrer Bioverfügbarkeit, Stoffwechsels und der Bedeutung in der Ernährungsphysiologie. Das Kapitel "Material und Methode" beschreibt detailliert die verwendeten Materialien und Methoden, einschließlich HPLC und Massenspektrometrie. Das Kapitel "Versuchsbeschreibung" dokumentiert die experimentellen Ansätze zur Untersuchung der Protein-Polyphenol-Wechselwirkung unter verschiedenen Temperaturbedingungen. Das Kapitel "Ergebnisse und Diskussion" präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der Experimente, inklusive eines Vergleichs mit bestehenden Studien.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die konkreten Ergebnisse sind nicht im Preview enthalten, aber das Kapitel "Ergebnisse und Diskussion" präsentiert und interpretiert die Daten, die aus den Experimenten zur Wechselwirkung zwischen Quercetin und verschiedenen Proteinen unter unterschiedlichen Temperaturen gewonnen wurden. Es wird ein Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien durchgeführt.
Welche Temperaturbedingungen wurden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Protein-Polyphenol-Wechselwirkung unter verschiedenen Temperaturbedingungen, die genauen Bedingungen sind jedoch nicht im Preview spezifiziert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Polyphenole, Proteine, Wechselwirkung, Lysozym, BSA, Hämoglobin, Quercetin, HPLC, Massenspektrometrie, Gelelektrophorese, Proteindenaturierung, Proteinstruktur, Temperatur, Ernährungsphysiologie.
Welche Bedeutung hat die Arbeit für die Forschung?
Die Arbeit liefert neue Erkenntnisse über die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Polyphenolen, was für die Ernährungsphysiologie und die Entwicklung neuer Technologien relevant sein kann. Die detaillierte Beschreibung der Methoden ermöglicht die Reproduzierbarkeit der Experimente und trägt somit zum Fortschritt der Forschung bei.
Gibt es einen Vergleich mit bestehenden Methoden?
Ja, die Arbeit vergleicht die eigenen Ergebnisse mit bestehenden Methoden, insbesondere mit einer Methode von Harshadrai M. Rawel et al. (2000).
- Quote paper
- Sonja Lechner (Author), 2004, Die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Polyphenolen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/29224