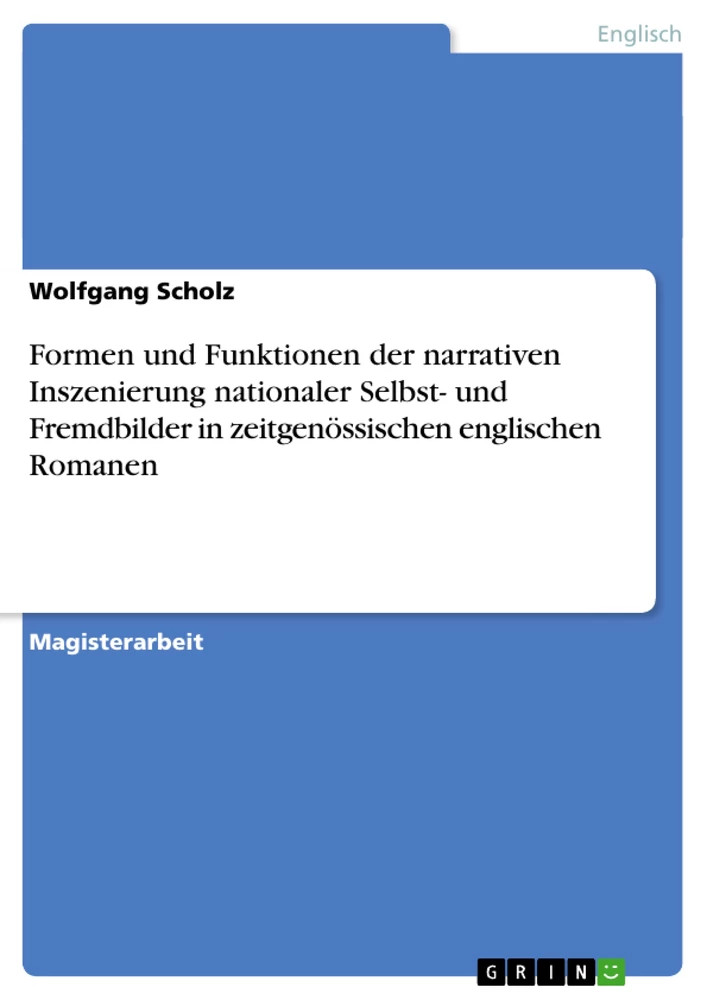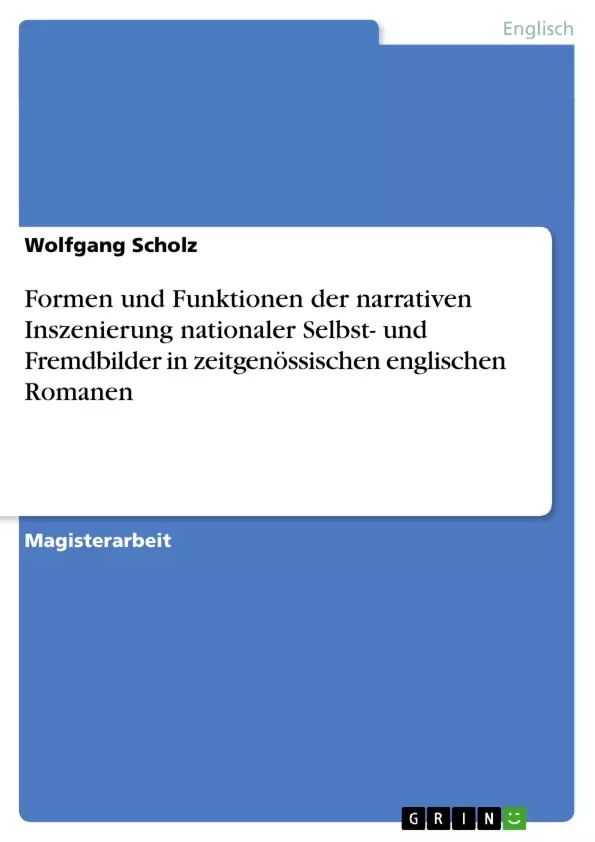Einleitung
Im Herbst 1973 beschwerte sich der deutsche Botschafter in London bei einem Presseempfang inoffiziell über die Masse an alten Kriegsfilmen und die damit verbundene Darstellung der Deutschen im britischen Fernsehen (vgl. Wocker 1976: 3). In Deutschland herrschte zu dieser Zeit eine rege Diskussion über die Wahrnehmung der Bundesrepublik in den britischen Medien. „Die BBC hält sich die Nazis warm“ (zitiert nach Wocker 1976: 5) titelte damals Die Welt. Bemängelt wurde vor allem, daß BBC und ITV neben diesen „Zweckproduktionen der 40er Jahre […], die sich über die Propagandastücke der Nazis kaum merklich erhoben“ (ebd. 1976: 9) auch noch Eigenproduktionen herstellten, die das Dritte Reich zum Thema hatten. In den Nachrichtenredaktionen der Sender hingegen erschienen nur verhältnismäßig wenige Berichte über Westdeutschland. Obwohl sich Teile der deutschen Öffentlichkeit schon in den 1970er Jahren über die Darstellung ihrer Nation in den britischen Medien erregten, hat sich bis zum heutigen Tag an der Art der Darstellung nicht viel geändert. Die Häufigkeit, mit der alte Kriegsfilme aus den 1940er Jahren gezeigt werden, dürfte abgenommen haben, die Zahl der Eigenproduktionen, in denen der „häßliche Deutsche“ dargestellt wird oder zumindest Anspielungen auf die NS-Zeit gemacht werden, hat eher zugenommen.
Die Darstellung des Deutschlandbildes in den Printmedien weist ähnliche Tendenzen auf. Auch wenn es sehr wohl differenzierte Berichterstattung gibt, wird auch hier auf Bilder aus der Zeit der kriegerischen Auseinandersetzung der beiden Länder gerne zurückgegriffen. Als die deutsche Wiedervereinigung auf politischer Ebene diskutiert wurde, bediente sich die britische Presse erneut verstärkt einer Metaphorik, die von der Zeit des Zweiten Weltkrieges geprägt war (vgl. Moritz 1998: 56). Dies mag einerseits die Angst der Engländer vor einem Wiedererstarken der Deutschen auf dem Kontinent reflektieren (vielleicht weniger als militärische Hegemonialmacht, sehr wohl aber als Wirtschaftsmacht); andererseits erfreut sich dieses Bild des häßlichen Deutschen auch in trivialeren Zusammenhängen der Alltagskultur gerade in der Boulevardpresse einer besonderen Beliebtheit: Als Beispiel sei hier die Fußball- Europameisterschaft 1996 genannt; anläßlich des Spiels England gegen Deutschland titelte der Daily Mirror „Achtung! Surrender“ (vgl. ohne Autor, 24.6.1996) und konfrontierte seine Leser mit Kampfparolen aus dem Zweiten Weltkrieg (vgl. Moritz 1998: 15)...
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Das Bild vom anderen Land in der Wissenschaft
- 2.1.1 Interdisziplinarität und Forschungsgegenstände in der komparatistischen Imagologie
- 2.1.2 Konstanz oder Variabilität? – Stereotype, Vorurteile, Images, Klischees
- 2.1.3 Die Interdependenz von Selbst- und Fremdbild
- 2.1.4 Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität
- 2.2 Englisches Selbstbild und englische Fremdbilder
- 2.2.1 Englishness - zwischen Empire und, Cool Britain’
- 2.2.2 Amerikabilder - zwischen Verehrung und Ablehnung
- 2.2.3 Deutschlandbilder – zwischen, häßlichen Deutschen' und Wirtschaftswunder
- 2.3 Relevante narrative Analysekriterien
- III. Out of the Shelter
- 3.1 Der,, Blitz\" als individuelle und kollektive Traumatisierung
- 3.2 Abschied und Reise als Vorzeichen der Revidierung nationaler Vorurteile
- 3.3 Die Grenzüberschreitung als Grenzerfahrung - Reaktivierung nationaler Vorurteile
- 3.4 Semantisierung des Raumes und Kulturvergleich als Möglichkeiten der narrativen Inszenierung von Selbst- und Fremdbildern
- 3.5 Kontrast- und Korrespondenzrelationen: Die Projektion nationaler Selbst- und Fremdbilder auf das Personal
- 3.6 Die Interferenz von nationalem Selbst- und Fremdbild
- 3.7 Zusammenfassung
- IV. Changing Places: A Tale of Two Campuses
- 4.1 Das Personal: Figuren als Vertreter ihrer Nationen
- 4.2 Die Bedeutung von Raum- und Zeitdarstellung für den Nationenvergleich
- 4.3 Die Universitätsthematik als Metonymie für die Gesellschaft
- 4.4 Die Form als zusätzliche Bedeutungsebene: Implizite Orchestrierung von nationalen Selbst- und Fremdbildern
- 4.5 Multiperspektivität als Mittel der Kontrastierung von Nationen
- 4.6 Explizite Inszenierung der Interferenz zwischen nationalem Selbst- und Fremdbild
- 4.7 Zusammenfassung
- V. England, England
- 5.1 Formale Kriterien: Die Darstellung individueller Erlebnisse in Form der Historiographie
- 5.2 Das Personal – zwischen kritischer Hinterfragung und unreflektiertem Patriotismus
- 5.3 Die explizite Thematisierung von Englishness anhand der, The Fifty Quintessences of Englishness'
- 5.4 Dekonstruktion englischer Landschaft, Institutionen und Mythen
- 5.5,,Baby, your tits have dropped“ – die Kommerzialisierung und Personifizierung Englands
- 5.6 Die Interferenz zwischen nationalem Selbst- und Fremdbild
- 5.7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die narrative Inszenierung nationaler Selbst- und Fremdbilder in zeitgenössischen englischen Romanen. Dabei fokussiert sie auf die Frage, wie die Figuren in den ausgewählten Romanen durch ihre Handlungen und Dialoge, durch ihre Beziehungen zueinander und durch ihre Interaktion mit Raum und Zeit ihre eigene nationale Identität gestalten und gleichzeitig andere Kulturen wahrnehmen. Die Arbeit analysiert die Strategien, mit denen die Autoren die Wahrnehmung nationaler Identität und Fremdbilder durch Sprache, Erzählperspektive und narrative Struktur konstruieren.
- Narrative Inszenierung nationaler Selbst- und Fremdbilder
- Die Konstruktion von Identität durch Sprache und Erzählstruktur
- Die Bedeutung von Raum, Zeit und Figur für die Darstellung nationaler Identität
- Die Interferenz von nationalem Selbst- und Fremdbild in der Literatur
- Die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen in der Gestaltung nationaler Bilder
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Relevanz der Arbeit vor, indem sie den Fokus auf die Darstellung Deutschlands in britischen Medien legt. Sie zeigt, wie das Deutschlandbild durch historische Ereignisse und aktuelle Trends geprägt ist und wie die Wahrnehmung der eigenen Nation durch die Kontrastierung mit dem Fremdbild beeinflusst werden kann.
- II. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Arbeit und stellt verschiedene Konzepte zur Analyse von Selbst- und Fremdbildern vor. Es beleuchtet die Interdisziplinarität der komparatistischen Imagologie, die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen sowie die Interdependenz von Selbst- und Fremdbild. Darüber hinaus werden zentrale Aspekte wie das englische Selbstbild und die Wahrnehmung von Amerika und Deutschland in der englischen Literatur behandelt.
- III. Out of the Shelter: Dieses Kapitel analysiert den Roman „Out of the Shelter“ von [Autorname]. Es befasst sich mit der Darstellung der individuellen und kollektiven Traumatisierung durch den „Blitz“ im Zweiten Weltkrieg und den Auswirkungen auf die Wahrnehmung der eigenen Identität im Kontext der nationaler Vorurteile. Die Analyse untersucht die Grenzüberschreitung als Grenzerfahrung und die Semantisierung des Raumes und des Kulturvergleichs als narrative Mittel zur Inszenierung von Selbst- und Fremdbildern.
- IV. Changing Places: A Tale of Two Campuses: Dieses Kapitel analysiert den Roman „Changing Places: A Tale of Two Campuses“ von [Autorname]. Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle von Raum, Zeit und Figur für den Nationenvergleich und beleuchtet, wie die Universitätsthematik als Metonymie für die Gesellschaft genutzt wird. Es wird untersucht, wie die Form des Romans die Darstellung der nationalen Selbst- und Fremdbilder beeinflusst und wie Multiperspektivität als Mittel der Kontrastierung von Nationen eingesetzt wird.
- V. England, England: Dieses Kapitel analysiert den Roman „England, England“ von [Autorname]. Es untersucht, wie die formalen Kriterien, die Darstellung individueller Erlebnisse in Form der Historiographie, die Wahrnehmung nationaler Identität beeinflussen. Darüber hinaus werden die Figuren und ihre Beziehung zum Patriotismus sowie die Dekonstruktion englischer Landschaft, Institutionen und Mythen analysiert. Abschließend wird die Kommerzialisierung und Personifizierung Englands im Kontext des nationalen Selbst- und Fremdbildes betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Nationalismus, Selbstbild, Fremdbild, Stereotypen, Vorurteile, Imagologie, englische Literatur, narrative Strukturen, Raumdarstellung, Zeitdarstellung und kulturelle Identität.
- Quote paper
- Wolfgang Scholz (Author), 2004, Formen und Funktionen der narrativen Inszenierung nationaler Selbst- und Fremdbilder in zeitgenössischen englischen Romanen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28962