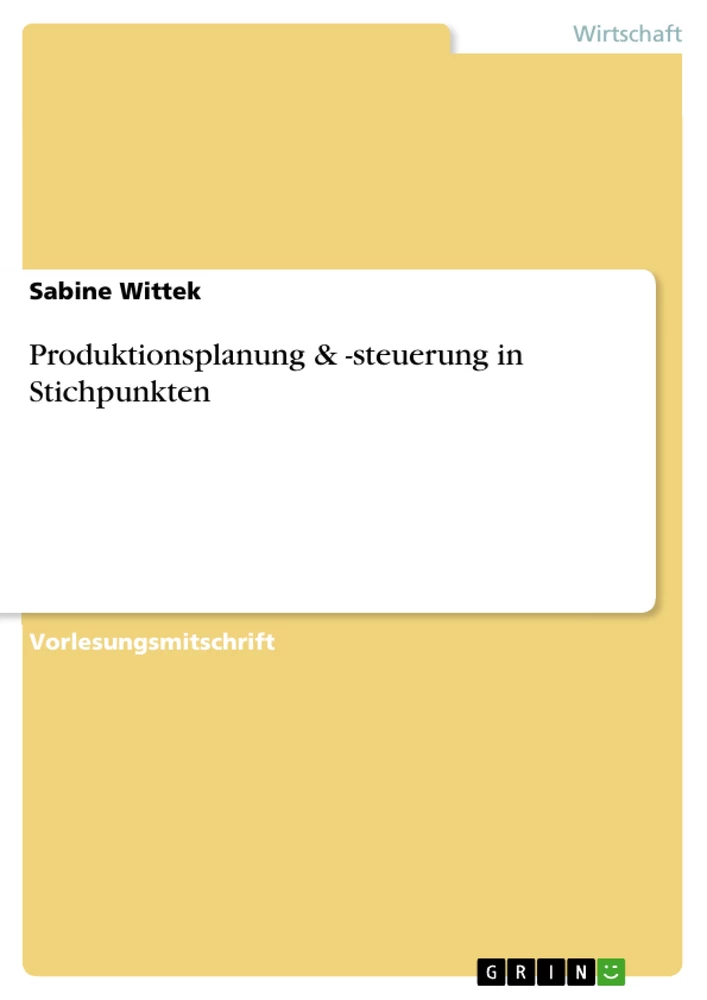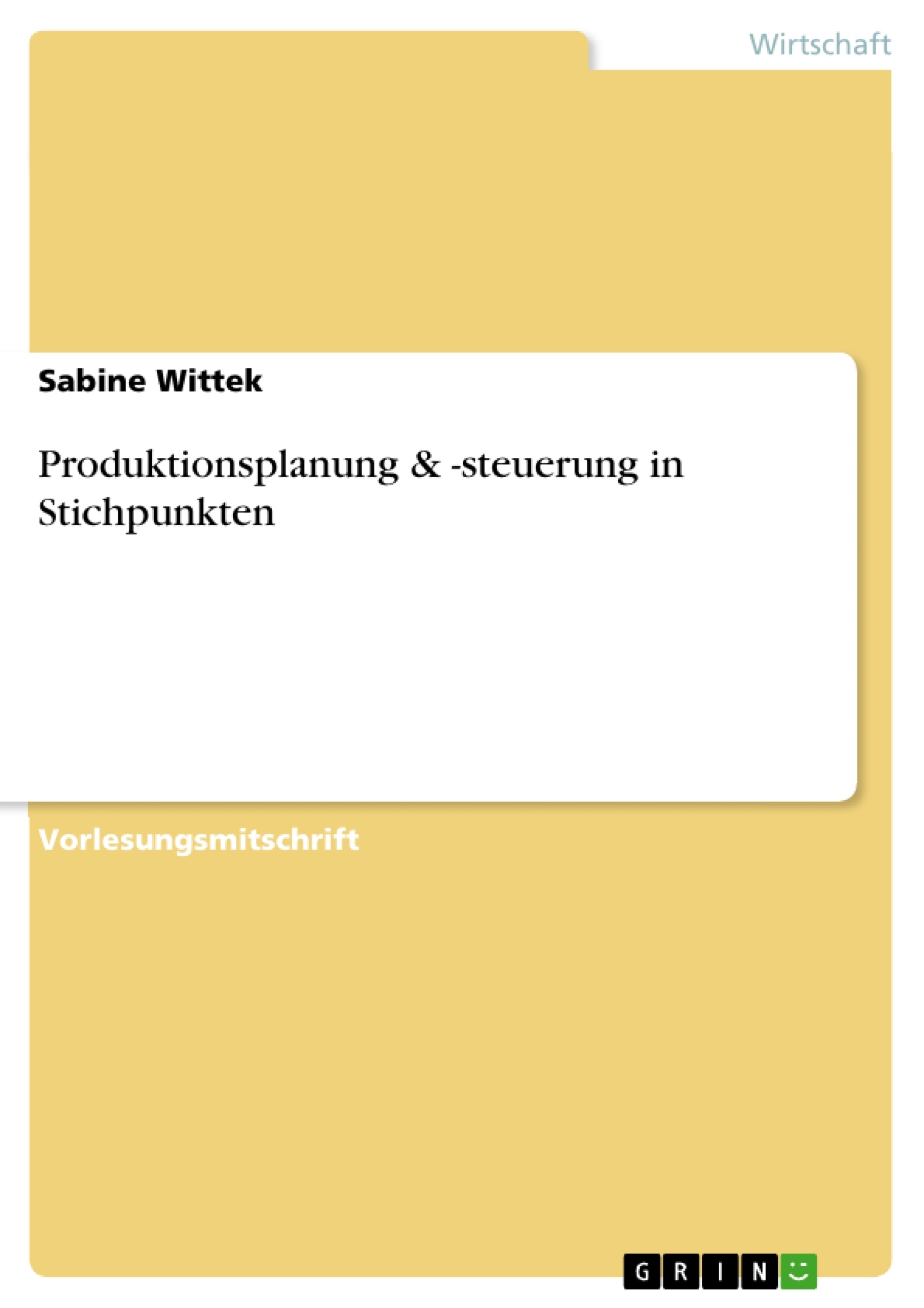Überblick Produktionsplanung und -steuerung
1. Planung
1.2 Planungsmerkmale
1.3 Durchführung der Planung
2. Steuerung
2.1 Begriffe der Steuerung
2.2 Steuerungsmerkmale
2.3 Durchführung der Steuerung
3. REFA - Standardprogramm Planung und Steuern
...
Erzeugnisse und Arbeitsunterlagen
Programme und Aufträge
Durchlaufzeiten- und Terminermittlung
Inhaltsverzeichnis
- Planung
- Begriffe und Aufgaben
- Planungsmerkmale
- Durchführung der Planung
- Steuerung
- Begriffe der Steuerung
- Steuerungsmerkmale
- Durchführung der Steuerung
- REFA Standardprogramm Planung und Steuern
- Erzeugnisse und Arbeitsunterlagen
- Begriffe zur Erzeugnisstruktur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Produktionsplanung und -steuerung in industriellen Unternehmen. Es befasst sich mit den grundlegenden Begriffen, Aufgaben und Merkmalen der Planung und Steuerung sowie mit der praktischen Durchführung dieser Prozesse. Der Fokus liegt auf der Darstellung der REFA-Standardprogramme und der Erläuterung der Erzeugnisstruktur.
- Planung und Steuerung als zentrale Elemente der Produktion
- Begriffe und Aufgaben der Planung und Steuerung
- Planungsmerkmale wie Planungshorizont, Planungsstufe und Planungsebene
- Steuerungsmerkmale wie Steuerungsphasen, Steuerungsziele und Steuerungsebene
- REFA-Standardprogramme für Planung und Steuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Planung
Das Kapitel "Planung" behandelt die grundlegenden Begriffe und Aufgaben der Planung in industriellen Unternehmen. Es werden verschiedene Planungsmerkmale wie Planungshorizont, Planungsstufe und Planungsebene erläutert. Außerdem wird die Durchführung der Planung in Abhängigkeit von der Komplexität der Planungsaufgabe beschrieben.
Steuerung
Das Kapitel "Steuerung" befasst sich mit den Begriffen und Aufgaben der Steuerung in industriellen Unternehmen. Es werden die verschiedenen Steuerungsphasen, Steuerungsziele und Steuerungsebenen erläutert. Außerdem wird die Durchführung der Steuerung anhand des Modells des Regelkreises beschrieben.
REFA Standardprogramm Planung und Steuern
Dieses Kapitel stellt das REFA-Standardprogramm für Planung und Steuerung vor. Es bietet einen Überblick über die Methodenlehre der Betriebsorganisation und die wichtigsten Elemente des Programms.
Erzeugnisse und Arbeitsunterlagen
Das Kapitel "Erzeugnisse und Arbeitsunterlagen" behandelt die Begriffe zur Erzeugnisstruktur. Es werden verschiedene Gruppenabgrenzungen und die Darstellung der Erzeugnisstruktur anhand von Strukturbildern und Stücklisten erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Produktionsplanung, Produktionssteuerung, REFA-Standardprogramm, Erzeugnisstruktur, Planungshorizont, Planungsstufe, Planungsebene, Steuerungsphasen, Steuerungsziele, Steuerungsebene, Begriffe, Aufgaben, Merkmale, Durchführung.
- Quote paper
- Sabine Wittek (Author), 2015, Produktionsplanung & -steuerung in Stichpunkten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/288190