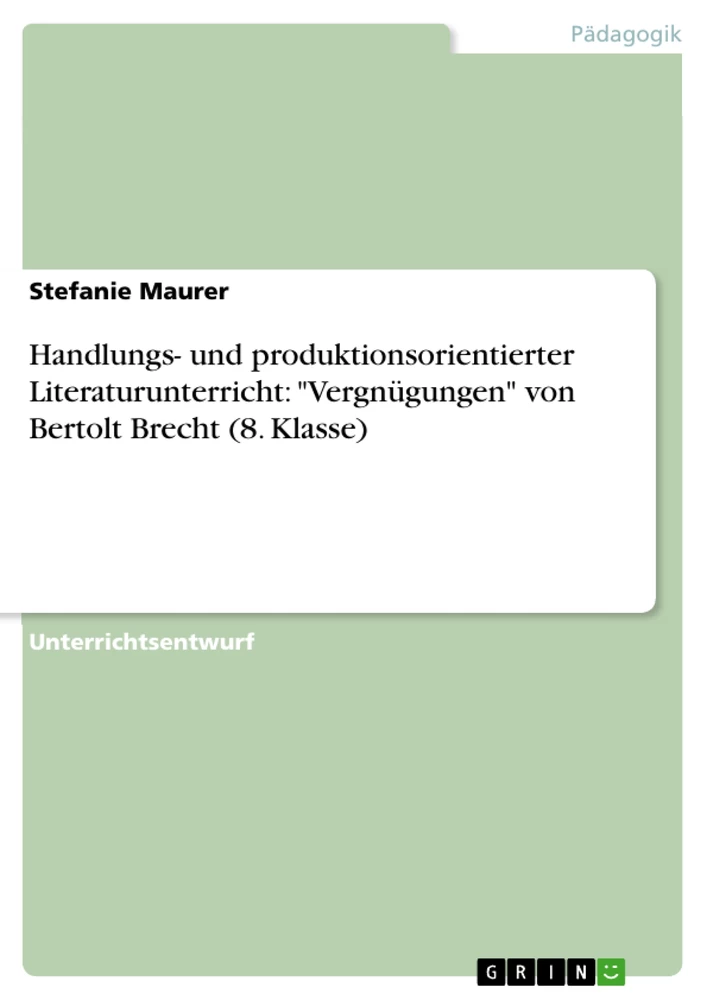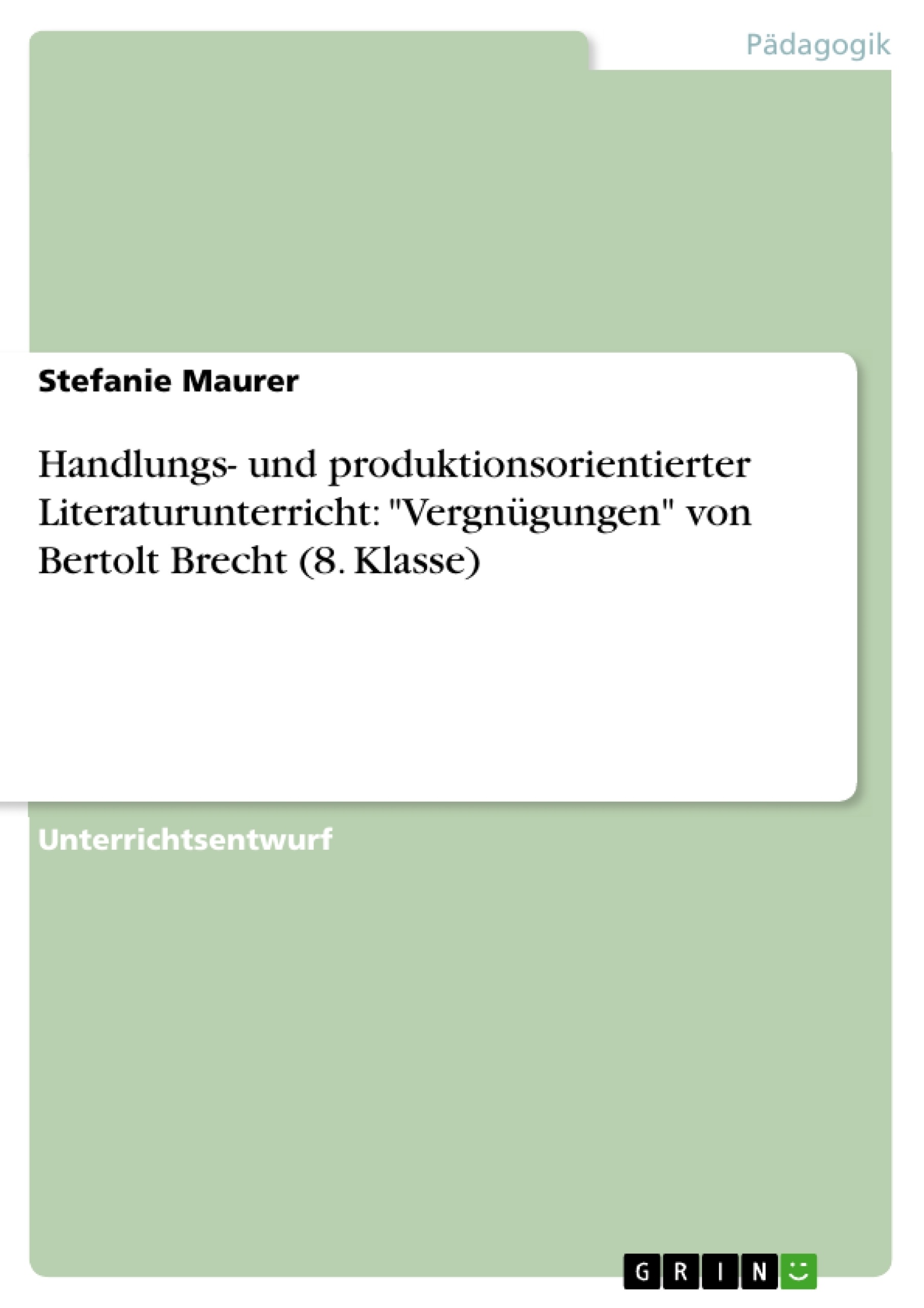Die Schüler lernen das Gedicht „Vergnügungen“ von Bertolt Brecht
kennen und setzen sich mit diesem handlungs- und produktionsorientiert auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- Didaktische Analyse
- Didaktische Überlegungen
- Gegenwartsbedeutung
- Zukunftsbedeutung
- Vorkenntnisse der Schüler
- Auswahl und Begrenzung der Stunde
- Einbettung des Stundenthemas in die Unterrichtseinheit
- Mögliche Schwierigkeiten
- Bezug zum Bildungsplan
- Lernziele
- Verlaufsplanung
- Literaturverzeichnis
- Anhang (Medien)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, die Freude am Lesen und Schreiben von lyrischen Texten bei den Schülern zu wecken. Durch einen handlungs- und produktionsorientierten Umgang mit dem Gedicht „Vergnügungen“ von Bertolt Brecht sollen die Schüler die Schönheit und Verschiedenartigkeit poetischer Texte erfahren und selbst kreativ tätig werden. Die Stunde soll den Schülern den Zugang zu klassischer Lyrik erleichtern und ihnen zeigen, dass auch sie selbst Gedichte verfassen können.
- Handlungs- und produktionsorientierter Umgang mit Lyrik
- Kreatives Schreiben und Verfassen von Analogietexten
- Entwicklung von Lesekompetenz und Textverständnis
- Förderung der Fantasie und des Tätigkeitsdrangs
- Bezug zur Lebenswelt der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die didaktische Analyse beleuchtet die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Themas „Vergnügungen“ im Kontext von Lesekompetenz und Kommunikation. Die Stunde baut auf den Vorkenntnissen der Schüler auf und setzt sich mit den Herausforderungen auseinander, die bei der Beschäftigung mit klassischer Lyrik auftreten können. Die Einbettung des Stundenthemas in die Unterrichtseinheit zeigt den Zusammenhang mit vorherigen und nachfolgenden Stunden. Mögliche Schwierigkeiten, die während der Stunde auftreten können, werden ebenfalls betrachtet. Der Bezug zum Bildungsplan verdeutlicht die Relevanz der Stunde für die Förderung der Lesekompetenz und die Entwicklung einer Lesekultur.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Förderung der Lesekompetenz, den handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht, die Lyrik, das Gedicht „Vergnügungen“ von Bertolt Brecht, das Verfassen von Analogietexten, die Kreativität und die Lebenswelt der Schüler. Der Text beleuchtet die Bedeutung von Literatur für die Entwicklung von Lesekompetenz und Kommunikation sowie die Herausforderungen, die bei der Beschäftigung mit klassischer Lyrik auftreten können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung der Freude am Lesen und Schreiben von lyrischen Texten und der Ermächtigung der Schüler, selbst kreativ tätig zu werden.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Maurer (Autor:in), 2011, Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht: "Vergnügungen" von Bertolt Brecht (8. Klasse), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/287864