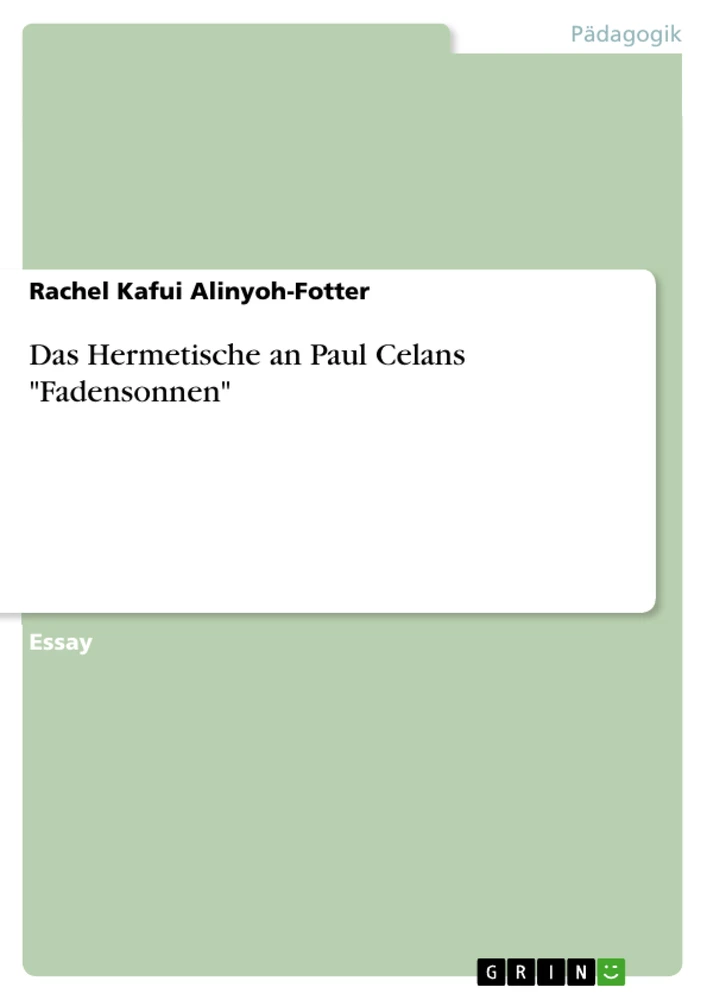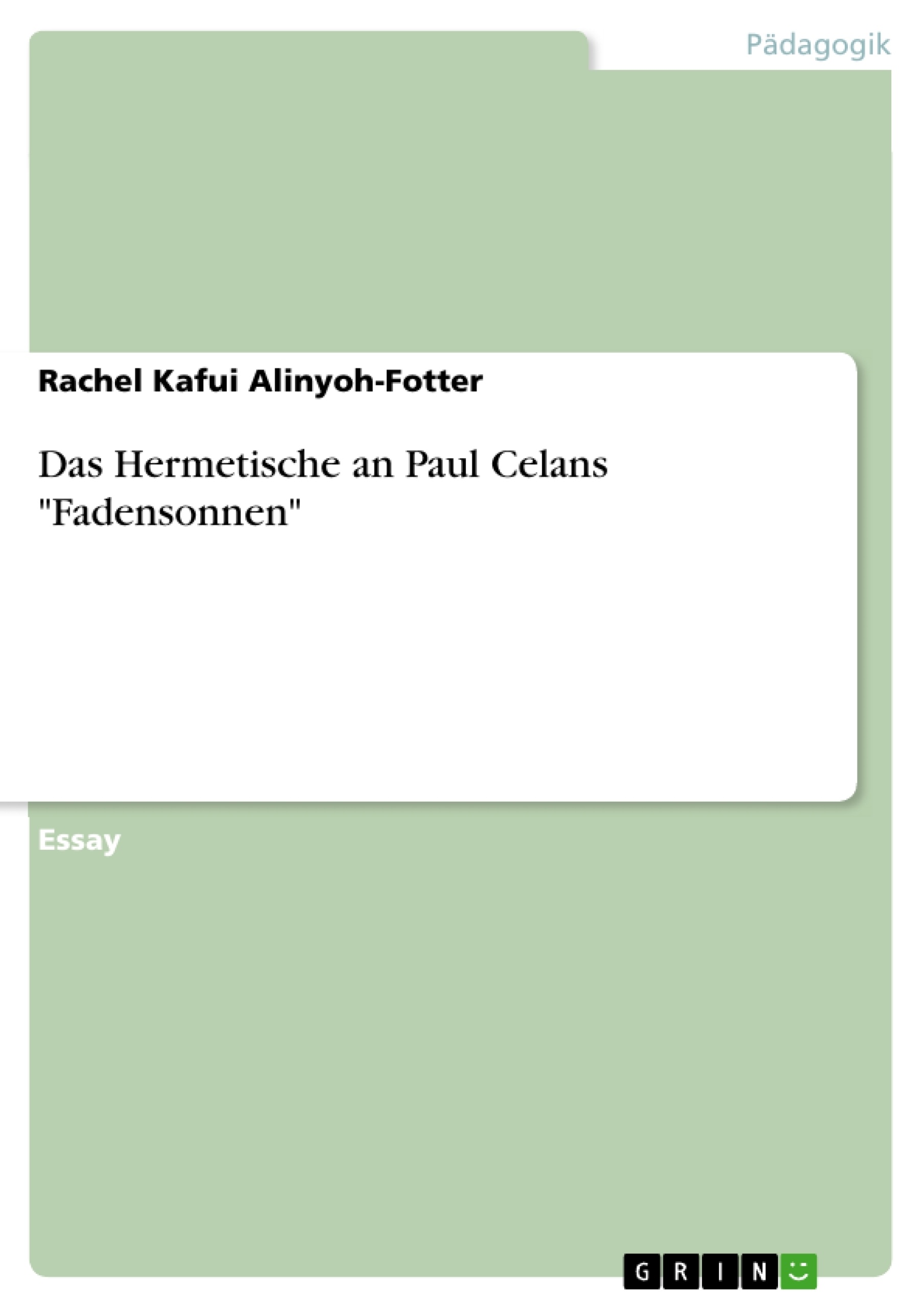Das Gedicht „Fadensonnen“ ist von Personen verschiedenster Provenienz, Feuilletonisten, Ideologen und Literaturwissenschaftlern mit unterschiedlichem Ergebnis ausgelegt worden. All diese Deutungsversuche sind auf den letzten Satz gerichtet: „Es gibt zu diesem Gedicht vor allem wohl wegen seines provokativen – oder resignativen – Schlusses verhältnismäßig viele Interpretationen, die sich jedoch meist auf eben den letzten Satz beschränken und die bisweilen eben auch jene Überschrift tragen, die auch ich dieser Phase der Lyrik Celans gegeben habe“. Hartmut Steinecke spricht in seinem Aufsatz „Lieder... jenseits der Menschen“ nicht unbedingt jedem Leser die notwendigen Voraussetzungen zu, ein Gedicht Celans adäquat interpretieren zu können. Er nennt im Wesentlichen exemplarisch vier mögliche Interpretationsansätze, die von Celan-Interpreten, v.a. für das Gedicht „Fadensonnen“, gewählt wurden:
- Das esoterische Verstehen, oder: Schreiben als Vorstufe zum Verstummen;
- Das theologische Verstehen, oder: Was liegt jenseits der Menschen?
- Das ideologische Verstehen, oder: Alles ist Politik;
- Das naive Verstehen, oder: Der Leser ist alles
Das „esoterische Verstehen“ sieht in Celans Beschäftigung mit dem Problem der Sprache, also die Sprachreflexion, das Zentrum der Deutungsmöglichkeit Celan`scher Dichtung: wenn Celan die Sprache als unzulänglich erklärt, das Phänomen Welt zu erfassen, kommt er diesem Ansatz nach immer mehr zu einem Verstummen, was durch eine zunehmend hermetische Sprache angedeutet wird. Bei der theologischen Auslegung wird versucht – ausgehend von der Deutungsrichtung, die durch das Adverb „jenseits“ gegeben wird –, das Gedicht „Fadensonnen“ in „der heilsgeschichtlichen Tradition“ zu sehen. Es evoziere ein „messianischen Leuchten“. Celan verweise in dem Gedicht auf ein zu erwartendes Jenseits.
Ideologisch hat man Celan vorgeworfen, sein Gedicht sei „ bewusst konzipiert gegen jede gesellschaftliche Realität, als esoterisches Sich-Abschließen im Elfenbeinturm. Erich Fried liest das Gedicht als Einladung „ins Nichts“; er erkennt den „furchtbaren Irrtum“ Celans in der Hoffnung, es gebe Lieder jenseits der Menschen zu singen. Das von Hartmut Steinecke aufgezählte vierte Deutungsmuster hebt den Aspekt des Lyrischen in „Lieder zu singen“ hervor und erkennt, dass Wohlklang, Musikalität im romantischen Sinne nach den Ungeheuerlichkeiten im 2. Weltkrieg nicht mehr angebracht sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- Das poetische Werk Celans im Überblick
- Der Stand der Forschung im Umriss
- Zur Struktur von „, Fadensonnen”
- Interpretationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert das Gedicht „Fadensonnen“ von Paul Celan, indem er sich mit der Hermeneutik des Textes auseinandersetzt und verschiedene Interpretationen von Celan-Forschern beleuchtet. Die Zielsetzung ist es, die Komplexität und Mehrdeutigkeit des Gedichts aufzuzeigen und verschiedene Lesarten zu erforschen, um ein umfassenderes Verständnis der sprachlichen und thematischen Dimensionen des Gedichts zu erlangen.
- Hermetischer Stil und Chiffrierung in Celans Dichtung
- Das Trauma des Holocausts und die Unfassbarkeit der Geschichte
- Die Rolle der Sprache und die Grenzen der sprachlichen Darstellung
- Die Suche nach einem Jenseits und die Frage nach der Menschlichkeit
- Verschiedene Interpretationen von Celans „Fadensonnen“
Zusammenfassung der Kapitel
Das poetische Werk Celans im Überblick
Dieses Kapitel stellt die charakteristischen Merkmale von Celans poetischem Werk vor, insbesondere seinen hermetischen Stil und die Verwendung von Chiffrierung. Der Text beleuchtet die Bedeutung der Sprache als Mittel der Auseinandersetzung mit dem Trauma des Holocausts und zeigt, wie Celans Gedichte eine komplexe Verbindung von Erinnerung, Verlust und Suche nach Sinn herstellen.
Der Stand der Forschung im Umriss
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Interpretationen des Gedichts „Fadensonnen“, die von Feuilletonisten, Ideologen und Literaturwissenschaftlern vorgelegt wurden. Der Text analysiert die unterschiedlichen Deutungsansätze, die sich insbesondere auf den Schluss des Gedichts konzentrieren, und diskutiert die verschiedenen Lesarten, die von „esoterischem Verstehen“ über „theologische Auslegung“ bis hin zu „ideologischem Verstehen“ reichen.
Zur Struktur von „, Fadensonnen”
Dieses Kapitel analysiert die strukturellen Merkmale des Gedichts „Fadensonnen“. Es beleuchtet die sprachlichen Besonderheiten des Textes, die Verwendung von Metaphern, Symbolen und Bildern, um den inneren Zustand des Sprechers und die komplexe Beziehung zwischen Mensch und Sprache zu verdeutlichen.
Interpretationen
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Interpretationen von Celans „Fadensonnen“, die von Celan-Forschern vorgelegt wurden. Der Text zeigt, wie verschiedene Leser das Gedicht auf unterschiedliche Weise lesen, und analysiert die verschiedenen Deutungsmuster und Theorien, die zur Interpretation des Textes herangezogen werden.
Schlüsselwörter
Hermetischer Stil, Chiffrierung, Holocaust, Trauma, Sprache, Erinnerung, Verlust, Jenseits, Menschlichkeit, Interpretation, Lesarten, Deutungsmuster, Celan, „Fadensonnen“, Sprachreflexion, Lyrik.
- Quote paper
- Rachel Kafui Alinyoh-Fotter (Author), 2007, Das Hermetische an Paul Celans "Fadensonnen", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/287691