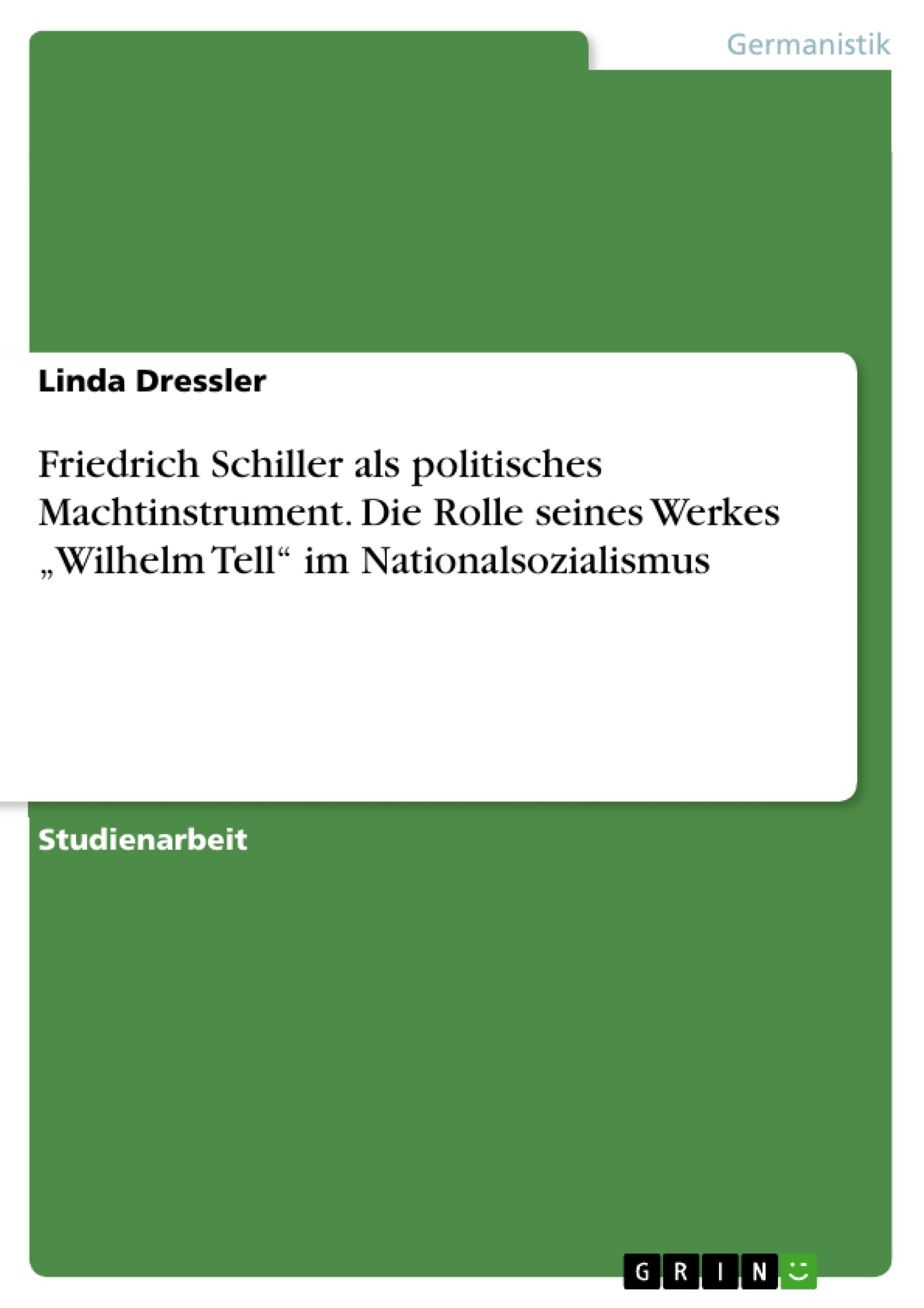Im Laufe der Zeit wurde seitens verschiedener Politiker versucht, die Werke der Klassiker der deutschen Literatur für die Propaganda eigener politischer Zwecke zu benutzen. Besonders oft wurden Versuche unternommen, die Begründung eines gemeinsamen kulturellen Nationalbewusstseins der Deutschen zu untermauern. Deshalb wurde in der klassischen Literatur gezielt nach bestimmten Zitaten gesucht, die als Belege für die kulturelle Einheit der Deutschen dienen und damit die geistige Grundlage für den modernen deutschen Nationalstaat schaffen könnten. Nach der Gründung des modernen deutschen Nationalstaats als Kaiserreich im Jahre 1871 begannen die Literaturwissenschaftler sich verstärkt mit der Erforschung von Leben und Werken auseinander zu setzen, sowie die Pflege der Erinnerung an bestimmte Schriftsteller und Dichter als nationale Aufgaben zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Propagandaarbeit
- Propagandaarbeit der Nationalsozialisten
- Schiller im Nationalsozialismus
- Schiller: Propaganda und Medien
- Schiller als Vorzeige-Literat
- Wilhelm Tell als Nationaldrama des Dritten Reiches
- Das Verbot des Wilhelm Tell
- Tyrannenmord
- Attentäter
- Außenpolitische Lage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit widmet sich der Rolle Friedrich Schillers und seines Werkes „Wilhelm Tell“ im Nationalsozialismus. Sie untersucht, wie die Nationalsozialisten Schillers Werke für ihre politische Propaganda instrumentalisierten und wie sie das Stück „Wilhelm Tell“ für ihre Zwecke nutzten und schließlich verbieten mussten.
- Die Instrumentalisierung der deutschen Literatur durch die Nationalsozialisten
- Die Rolle von Schiller als Vorzeige-Literat im nationalsozialistischen Kontext
- Die Nutzung und spätere Verbannung von Schillers „Wilhelm Tell“ durch das NS-Regime
- Die Gründe für das Verbot von „Wilhelm Tell“ im Nationalsozialismus
- Die Propagandaarbeit der Nationalsozialisten und ihre Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die Bedeutung von Schiller und Goethe als Nationaldichter im 19. Jahrhundert. Sie führt in die Thematik der Instrumentalisierung klassischer Literatur für politische Zwecke ein, insbesondere im Nationalsozialismus.
Das Kapitel „Propagandaarbeit“ definiert den Begriff Propaganda und beschreibt die Bedeutung von Propagandaarbeit im Nationalsozialismus. Es wird erläutert, wie die Nationalsozialisten die Propaganda für ihre Zwecke nutzten und welche Methoden sie dabei einsetzten.
Das Kapitel „Schiller im Nationalsozialismus“ behandelt die Rezeption Schillers im Nationalsozialismus. Es werden die verschiedenen Aspekte der Instrumentalisierung von Schillers Werken durch das NS-Regime beleuchtet, darunter die Nutzung als Propaganda und die Darstellung Schillers als Vorzeige-Literat.
Das Kapitel „Wilhelm Tell als Nationaldrama des Dritten Reiches“ analysiert Schillers „Wilhelm Tell“ im Kontext des Nationalsozialismus. Es wird untersucht, wie das Stück vom NS-Regime genutzt wurde und welche Aspekte des Stücks für die Nationalsozialisten relevant waren.
Das Kapitel „Das Verbot des Wilhelm Tell“ beleuchtet die Gründe für das Verbot des Stücks durch das NS-Regime. Es werden die Aspekte des Stücks, die für die Nationalsozialisten problematisch waren, analysiert, wie z.B. der Tyrannenmord und die Attentäterthematik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Instrumentalisierung von Literatur, Propaganda im Nationalsozialismus, die Rezeption von Schiller im NS-Regime, die Nutzung und Verbannung von „Wilhelm Tell“, Tyrannenmord, Attentäter, Außenpolitik und das Bild des Vorzeige-Literaten.
- Arbeit zitieren
- Linda Dressler (Autor:in), 2011, Friedrich Schiller als politisches Machtinstrument. Die Rolle seines Werkes „Wilhelm Tell“ im Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/287100