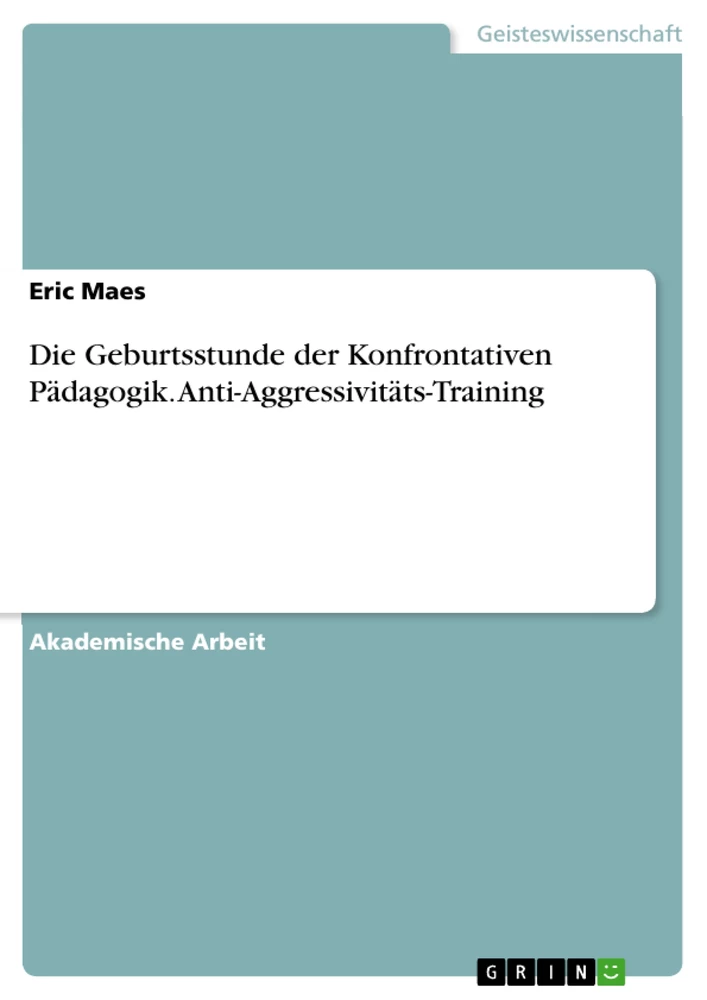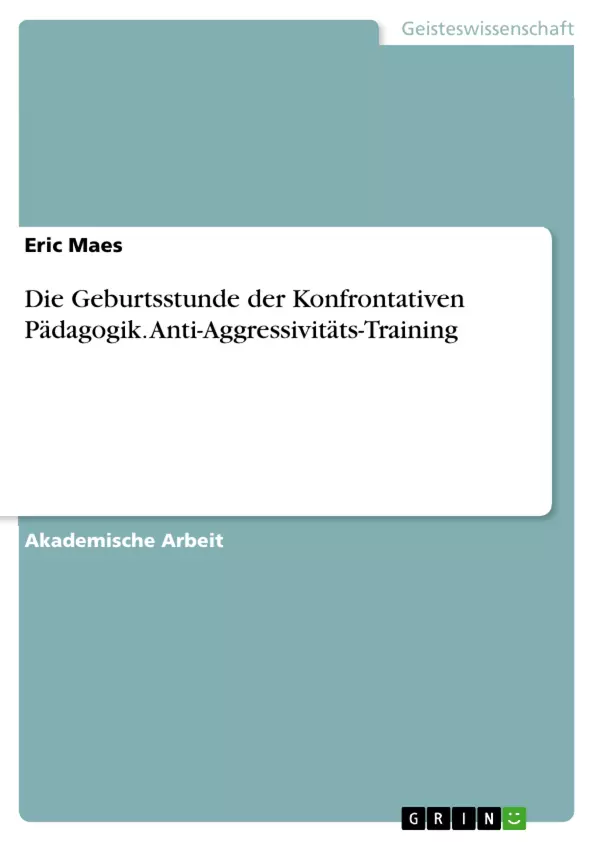Das Anti-Aggressivitäts-Training ist ebenso eine deliktspezifische Maßnahme und beschäftigt sich mit aggressiven Gewalttätern. Es ist als Spezialisierung eines Sozialen Trainings zu verstehen und folgt dem Erziehungsgedanken des § 91 Abs. 1 JGG, bei dem der Jugendliche zu einem „rechtschaffenden und verantwortungsbewussten Lebenswandel zu führen“ ist. Es ist im Sektor der Tertiär-Prävention bei der Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe anzusiedeln.
Dabei wird der Zwang zur Behandlung von Wiederholungstätern als Einstiegs-Sekundärmotivation akzeptiert. Jedoch sollte diese nach spätestens vier Sitzungen einem primären Interesse weichen. Weidner entwickelte dieses Training aus seinen Erfahrungen aus dem Praktikum in den Glen Mills Schools (6 Monate) sowie den Erfahrungen des Geschlechtsrollenseminars in der Vollzugsanstalt Hameln (3 Monate), als auch seinen theoretischen Erkenntnissen aus der Provokativen Therapie Ferrainolas. Vor dem Hintergrund, dass der Jugendstrafvollzug dem Erziehungsgedanken bisher nicht gerecht werden konnte, startete die Jugendanstalt Hameln 1986 ein Programm, das diesem Behandlungsdefizit in einem Pilotprojekt entgegenwirken sollte.
Es baut vor allem auf den Arbeiten von Bandura zur Modifikation und Kontrolle aggressiven Verhaltens sowie Ellis rational-emotiver Therapie auf. Diese zeigen therapeutische Möglichkeiten im Umgang mit gewalttätigen Menschen auf.
Weidner entwickelte mit seinen Kollegen (Psychologen, Sozialpädagogen, Psychiater, und Soziologen) darauf hin ein Curriculum, bei dem die Gewaltbereitschaft abgebaut werden sollte.
Das Anti-Aggressivitäts-Training oder auch Antagonisten-Training, wie es in der Anstalt genannt wurde, ging von gewissen Subkulturen in der Totalen Institution Gefängnis aus, die wohl eher diese negativen Verhaltensweisen fördert und bestätigt, als dass sie diese abbaut.
Auch hier fand eine eher mehr private Finanzierung des ganzen durch den Verein für Jugendhilfe in der Jugendanstalt Hameln statt. Dieser stellte die personellen und finanziellen Mittel. Dies zeigt die zurückhaltende und abwartende Seite des Staates bei solchen Neuerungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Philosophie Jens Weidners
- Die Voraussetzungen in der deutschen (europäischen) Gesellschaft
- Die Praxis des Anti-Aggressivitäts-Trainings und die Konfrontation
- Die Antagonisten - Positive Peer Culture
- Das Curriculum zum Abbau der Gewaltbereitschaft
- Der Heiße Stuhl
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, das Anti-Aggressivitäts-Training nach Jens Weidner vorzustellen und zu analysieren. Der Fokus liegt auf den philosophischen Grundlagen, den gesellschaftlichen Voraussetzungen in Deutschland und der praktischen Umsetzung des Trainings.
- Die Philosophie Jens Weidners und seine Methode der konfrontativen Pädagogik
- Die Herausforderungen der Implementierung des Trainings in der deutschen Gesellschaft
- Die Praxis des Anti-Aggressivitäts-Trainings und seine verschiedenen Methoden
- Der Vergleich mit anderen Ansätzen zur Gewaltprävention
- Die Rolle des Staates und der Finanzierung solcher Programme
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Anti-Aggressivitäts-Training als eine deliktspezifische Maßnahme im Kontext der Jugendgerichtshilfe vor. Es wird als Spezialisierung des Sozialen Trainings verstanden und zielt auf die Förderung eines „rechtschaffenden und verantwortungsbewussten Lebenswandels“ ab. Die Entwicklung des Trainings durch Weidner wird skizziert, basierend auf seinen Erfahrungen und theoretischen Erkenntnissen aus Provokativer Therapie und den Arbeiten von Bandura und Ellis. Die Arbeit betont die Notwendigkeit eines solchen Trainings angesichts des bisherigen Behandlungsdefizits im Jugendstrafvollzug und die eher private Finanzierung durch den Verein für Jugendhilfe.
Die Philosophie Jens Weidners: Dieses Kapitel beleuchtet die Philosophie Jens Weidners, die durch den Leitspruch „Eine klare Linie mit Herz“ gekennzeichnet ist. Es wird betont, dass Weidners Ansatz nicht nur auf Konfrontation beruht, sondern auch Empathie und den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses umfasst. Der Fokus liegt auf der Provokation zum Wandel im Denken und moralischen Bewusstsein der Teilnehmer, wobei der Schritt zum Wandel von den Teilnehmern selbst getan werden muss. Der Autor vergleicht Weidners Ansatz mit der Provokativen Therapie und diskutiert die Debatten um autoritäre Strukturen. Die Provokation zielt darauf ab, die Gewaltfaszination der Teilnehmer zu begreifen und zu erschüttern.
Die Voraussetzungen in der deutschen (europäischen) Gesellschaft: Dieses Kapitel vergleicht die Voraussetzungen für das Anti-Aggressivitäts-Training in Deutschland mit denen in den USA. Es werden die Unterschiede im Verhältnis von freier Marktwirtschaft und sozialem Sektor, die Rolle des bürgerlichen Engagements und die Finanzierung solcher Programme diskutiert. Es wird auf die Herausforderungen hingewiesen, die sich aus der staatlichen Trägerschaft sozialer Leistungen und den medialen Forderungen nach lebenslanger Sicherheitsverwahrung ergeben. Trotz dieser Hürden wird der positive Aspekt der wachsenden Zahl von Trainern und Auszubildenden hervorgehoben, welche die Nachfrage nach dieser Methode belegen.
Die Praxis des Anti-Aggressivitäts-Trainings und die Konfrontation: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung des Anti-Aggressivitäts-Trainings. Es erläutert den Ablauf des sechsmonatigen Curriculums, die wöchentlichen Sitzungen, Einzelgespräche und ergänzende Aktivitäten. Die Bedeutung der Durchführung außerhalb der Anstaltsmauern wird betont, um eine künstliche Umgebung zu vermeiden. Die unterschiedliche Nachbereitung für Teilnehmer mit und ohne Vollzugslockerungen wird ebenfalls beschrieben.
Schlüsselwörter
Anti-Aggressivitäts-Training, Konfrontative Pädagogik, Jens Weidner, Gewaltprävention, Jugendgerichtshilfe, Resozialisierung, Provokative Therapie, Glen Mills Schools, Gewaltbereitschaft, Empathie, Konfrontation.
Häufig gestellte Fragen zum Anti-Aggressivitäts-Training nach Jens Weidner
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Anti-Aggressivitäts-Training nach Jens Weidner. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der philosophischen Grundlage, den gesellschaftlichen Voraussetzungen in Deutschland und der praktischen Umsetzung des Trainings.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Philosophie von Jens Weidner und seine Methode der konfrontativen Pädagogik, die Herausforderungen der Implementierung des Trainings in der deutschen Gesellschaft, die Praxis des Anti-Aggressivitäts-Trainings mit seinen verschiedenen Methoden, einen Vergleich mit anderen Ansätzen zur Gewaltprävention und die Rolle des Staates und der Finanzierung solcher Programme.
Wie ist das Anti-Aggressivitäts-Training aufgebaut?
Das Anti-Aggressivitäts-Training umfasst ein sechsmonatiges Curriculum mit wöchentlichen Sitzungen, Einzelgesprächen und ergänzenden Aktivitäten. Es wird außerhalb der Anstaltsmauern durchgeführt, um eine künstliche Umgebung zu vermeiden. Die Nachbereitung unterscheidet sich für Teilnehmer mit und ohne Vollzugslockerungen. Das Curriculum beinhaltet unter anderem den „Heißen Stuhl“ als Methode.
Welche philosophischen Grundlagen hat das Training?
Das Training basiert auf der Philosophie von Jens Weidner, die durch den Leitspruch „Eine klare Linie mit Herz“ gekennzeichnet ist. Es kombiniert Konfrontation mit Empathie und dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Der Fokus liegt auf der Provokation zum Wandel im Denken und moralischen Bewusstsein der Teilnehmer, wobei der Schritt zum Wandel von den Teilnehmern selbst getan werden muss. Vergleiche werden zur Provokativen Therapie gezogen.
Welche gesellschaftlichen Voraussetzungen werden betrachtet?
Das Dokument vergleicht die Voraussetzungen für das Training in Deutschland mit denen in den USA und diskutiert Unterschiede im Verhältnis von freier Marktwirtschaft und sozialem Sektor, die Rolle des bürgerlichen Engagements und die Finanzierung solcher Programme. Herausforderungen durch staatliche Trägerschaft sozialer Leistungen und mediale Forderungen nach lebenslanger Sicherheitsverwahrung werden angesprochen. Der positive Aspekt der wachsenden Zahl von Trainern und Auszubildenden wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Training?
Schlüsselwörter sind: Anti-Aggressivitäts-Training, Konfrontative Pädagogik, Jens Weidner, Gewaltprävention, Jugendgerichtshilfe, Resozialisierung, Provokative Therapie, Glen Mills Schools, Gewaltbereitschaft, Empathie, Konfrontation.
Wo wird das Anti-Aggressivitäts-Training eingesetzt?
Das Dokument präsentiert das Anti-Aggressivitäts-Training als deliktspezifische Maßnahme im Kontext der Jugendgerichtshilfe. Es wird als Spezialisierung des Sozialen Trainings verstanden und zielt auf die Förderung eines „rechtschaffenden und verantwortungsbewussten Lebenswandels“ ab.
Wie wird das Training finanziert?
Das Dokument erwähnt, dass das Training eher privat durch den Verein für Jugendhilfe finanziert wird und diskutiert die Herausforderungen der staatlichen Finanzierung solcher Programme.
- Quote paper
- Eric Maes (Author), 2004, Die Geburtsstunde der Konfrontativen Pädagogik. Anti-Aggressivitäts-Training, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/286217