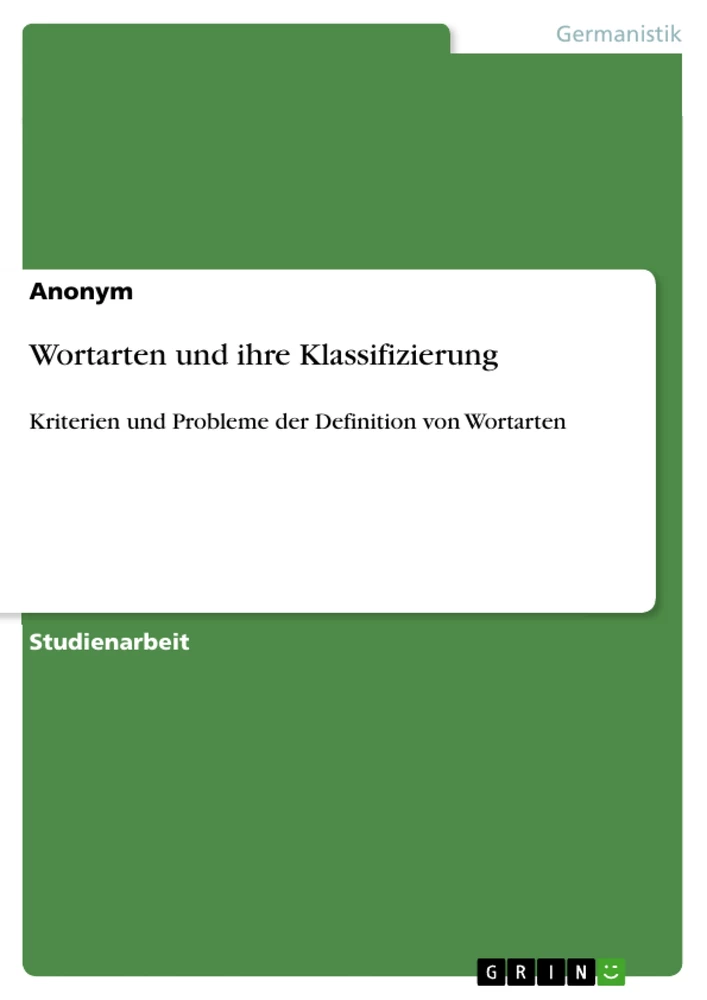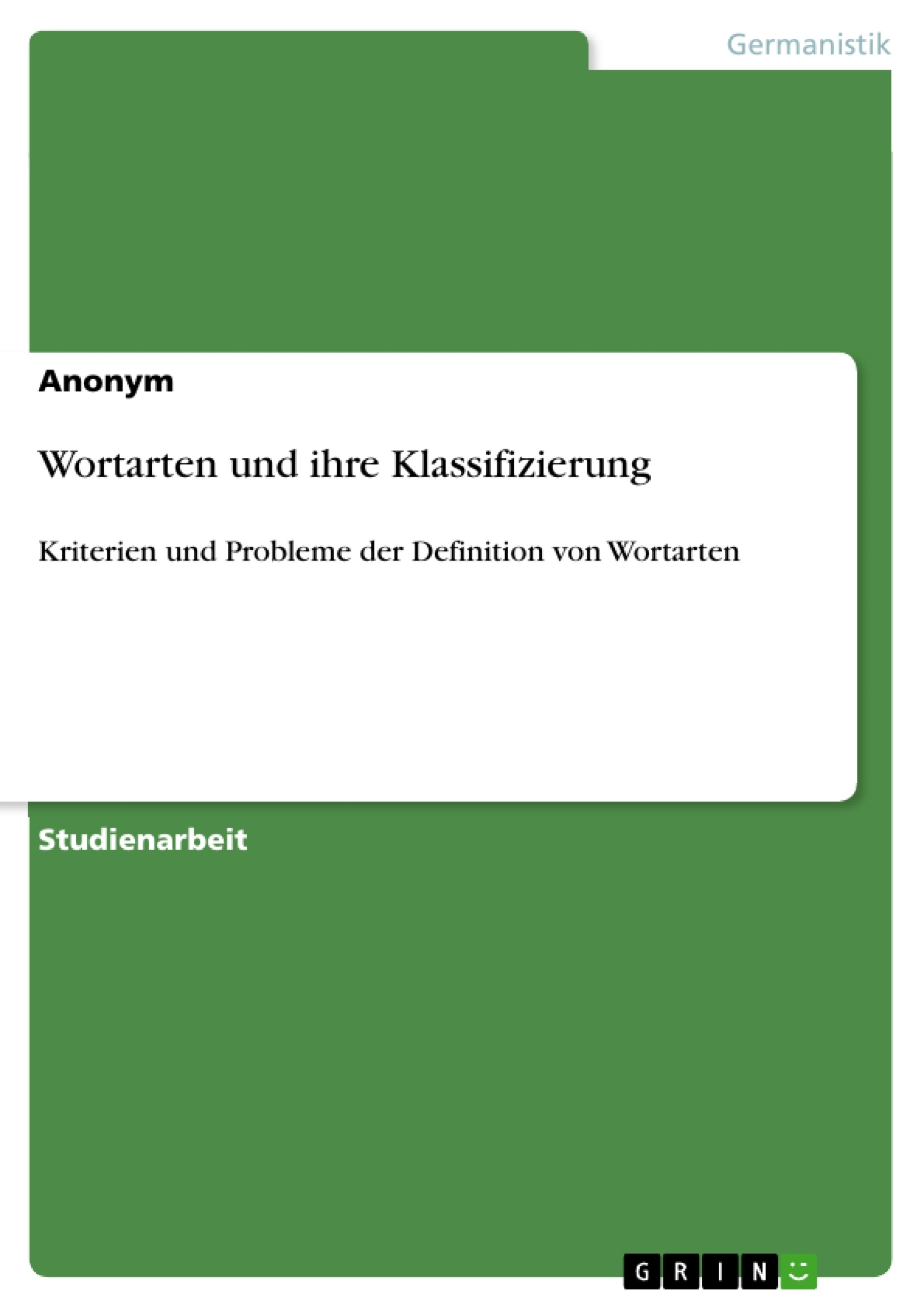In dieser Hausarbeit sollen die Wortarten, ihre Klassifikation und die Grenzen der Wortartenklassifikation näher betrachtet werden.
Die Wortartenbestimmung trägt eine wichtige Bedeutung innerhalb der deutschen Grammatik und bildet das Fundament des Grammatikverständnisses.
Fast jede Grammatikbeschreibung hat als Grundlage das Wortartensystem. Das Ziel ist es, Wörter mit ähnlichen oder gleichen Eigenschaften einer bestimmten Gruppe zuzuordnen, diese also zu klassifizieren. Diese Zuordnung geschieht mithilfe verschiedener Klassifikationskriterien. Die Bestimmung der Wortarten bildet das Fundament der Satzgliedanalyse. Die Zugehörigkeit zu einer Wortart entscheidet letztlich darüber, wie sprachliche Ausdrücke syntaktisch und semantisch miteinander verknüpft werden müssen bzw. können. Doch trotz bestimmter Kriterien zur Abgrenzung der Wortarten können nicht alle sprachlichen Elemente eindeutig einer bestimmten Wortart zugeordnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Das Wort
- 2.2 Die Wortart, Wortartenklassifizierung und Klassifikationskriterien
- 3. Anforderungen der Wortartenklassifikation
- 4. Wortartenklassifizierungen
- 4.1 Morphologisches Kriterium
- 4.2 Syntaktisches Kriterium
- 4.3 Semantisches (bzw. lexikalisches) Kriterium
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die verschiedenen Wortarten im Deutschen und deren Klassifizierung. Sie analysiert kritisch die gängigen Methoden der Wortartenklassifizierung und beleuchtet die Herausforderungen bei der eindeutigen Zuordnung von Wörtern zu bestimmten Wortarten.
- Definition des Wortbegriffs und der Wortart
- Klassifikationskriterien für Wortarten (morphologisch, syntaktisch, semantisch)
- Anforderungen an eine erfolgreiche Wortartenklassifikation
- Probleme und Grenzen der Wortartenklassifizierung
- Kritische Betrachtung verschiedener Klassifizierungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Wortartenklassifizierung ein und erläutert die Bedeutung der Wortartenbestimmung für das Verständnis der deutschen Grammatik. Sie hebt die Komplexität der Sprache hervor und betont die Notwendigkeit eines systematischen Ansatzes zur Ordnung und Klassifizierung von Wörtern. Das Ziel der Arbeit wird als kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Wortarten und deren Klassifikationsmethoden definiert.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel widmet sich der Definition zentraler Begriffe wie "Wort" und "Wortart". Es verdeutlicht die Schwierigkeiten, eine eindeutige und allgemein akzeptierte Definition für den Begriff "Wort" zu finden, und diskutiert verschiedene Ansätze aus der Fachliteratur, die phonetische, orthographische, morphologische, semantische und syntaktische Kriterien berücksichtigen. Die Mehrdeutigkeit des Wortbegriffs wird hervorgehoben, und es wird eine pragmatische Arbeitsdefinition eingeführt. Weiterhin werden "Wortart", "Wortartenklassifizierung" und "Klassifikationskriterien" definiert und deren Zusammenhänge erläutert. Die Herausforderungen bei der Zuordnung von Wörtern zu Wortarten werden angedeutet.
Schlüsselwörter
Wortarten, Wortartenklassifizierung, Morphologie, Syntax, Semantik, Klassifikationskriterien, deutsche Grammatik, Lexem, Flexionsform, Problematik der Wortartenbestimmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Wortartenklassifizierung im Deutschen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Wortarten im Deutschen und deren Klassifizierung. Sie analysiert kritisch gängige Methoden der Wortartenklassifizierung und beleuchtet die Herausforderungen bei der eindeutigen Zuordnung von Wörtern zu bestimmten Wortarten. Der Inhalt umfasst eine Einleitung, Begriffsdefinitionen (Wort und Wortart), Anforderungen an die Wortartenklassifizierung, verschiedene Klassifizierungssysteme (morphologisch, syntaktisch, semantisch), und ein Fazit. Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter erleichtern das Verständnis.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie "Wort" und "Wortart", "Wortartenklassifizierung" und "Klassifikationskriterien". Sie hebt die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Definition des "Worts" hervor und diskutiert verschiedene Ansätze, die phonetische, orthographische, morphologische, semantische und syntaktische Kriterien berücksichtigen. Es wird eine pragmatische Arbeitsdefinition für "Wort" eingeführt.
Welche Kriterien für die Wortartenklassifizierung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet morphologische, syntaktische und semantische (lexikalische) Kriterien für die Wortartenklassifizierung. Sie analysiert die Vor- und Nachteile jedes Kriteriums und die Herausforderungen bei der Anwendung in der Praxis. Die Interaktion und der kombinierte Einsatz dieser Kriterien werden implizit diskutiert.
Welche Anforderungen werden an eine erfolgreiche Wortartenklassifizierung gestellt?
Die Arbeit impliziert Anforderungen an eine erfolgreiche Wortartenklassifizierung, die sich aus der Diskussion der verschiedenen Kriterien und der Probleme bei der Zuordnung von Wörtern ergeben. Eine eindeutige und konsistente Klassifizierung, die die Komplexität der Sprache berücksichtigt, ist ein zentrales Anliegen.
Welche Probleme und Grenzen der Wortartenklassifizierung werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet die Mehrdeutigkeit des Wortbegriffs und die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Zuordnung von Wörtern zu Wortarten. Sie zeigt auf, dass kein einziges Kriterium ausreicht und die Kombination verschiedener Kriterien oft notwendig ist. Die Grenzen der einzelnen Klassifizierungssysteme werden kritisch betrachtet.
Welche Klassifizierungssysteme werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Wortartenklassifizierungssysteme, die auf morphologischen, syntaktischen und semantischen Kriterien basieren. Sie vergleicht diese Systeme und analysiert deren Stärken und Schwächen. Konkrete Beispiele für Klassifizierungssysteme werden zwar nicht explizit genannt, aber implizit durch die Diskussion der Kriterien deutlich.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Wortarten, Wortartenklassifizierung, Morphologie, Syntax, Semantik, Klassifikationskriterien, deutsche Grammatik, Lexem, Flexionsform, Problematik der Wortartenbestimmung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Wortarten und ihre Klassifizierung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/285362