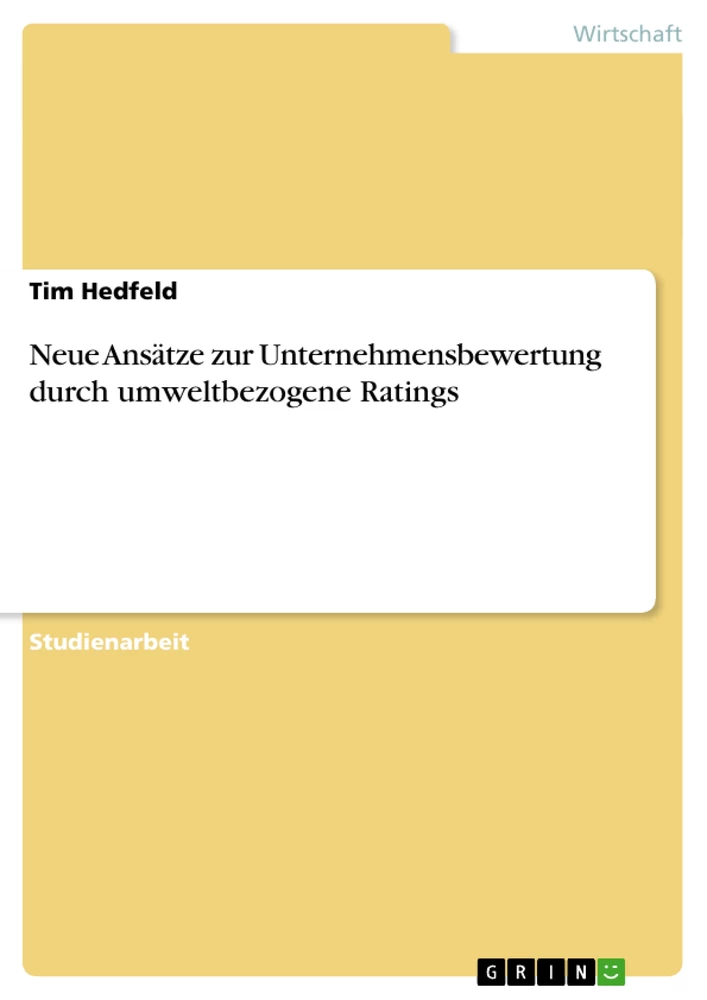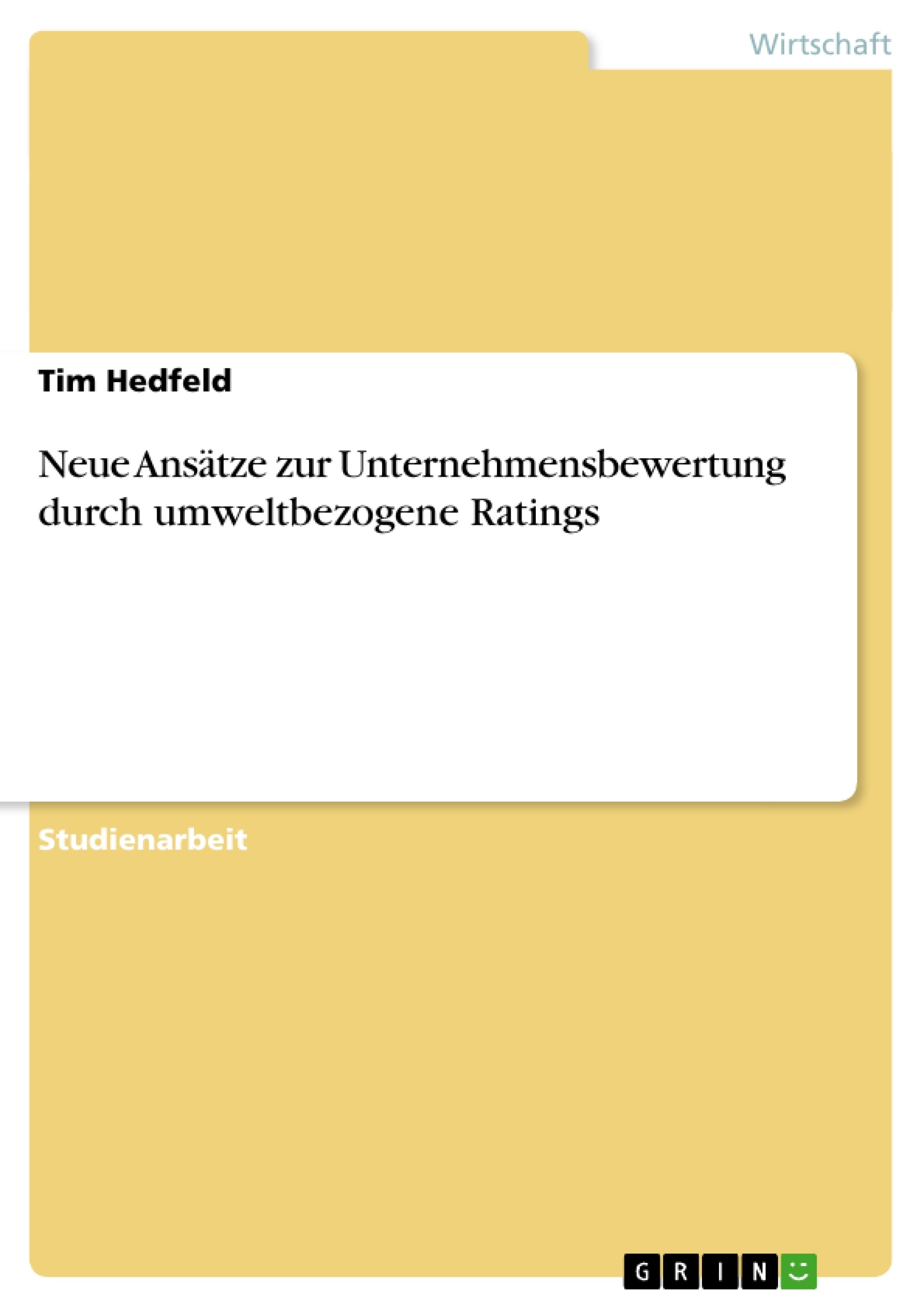Dieses Problem der Unsicherheit und asymmetrischen Informationsverteilung ist im Finanz- und Börsensektor schon lange bekannt. Dem kann man entgegenwirken, indem man die Unternehmen einem Rating unterzieht. Es versucht die Informationsdichte und -genauigkeit zu erhöhen. Die Vereinigung von Investment und Nachhaltigkeit gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Immer mehr private und institutionelle Investoren sehen hier eine Chance, Geld in Einklang mit ihren Moralvorstellungen und/oder sogar renditewirksam anzulegen. Hier entstand nun der Bedarf nach „neuen Ratingverfahren“, mit deren Hilfe Unternehmen – als Emittenten von Wertpapieren – gemäß nachhaltiger Kriterien analysiert und bewertet werden können. Diese neuen Ratingverfahren versuchen das Leitbild der Nachhaltigkeit, verkörpert durch eine Kriteriologie auf die Unternehmen anzuwenden und so zu einem Rating zu gelangen. Aufgabe dieser Arbeit ist es bestehende Ansätze von Nachhaltigkeits-Ratings darzustellen und sie bezüglich ihrer Nachhaltigkeits-Validität zu beurteilen. Neben dem Instrument des Ratings sollen auch Portfolios anhand sozialökologischer Kriterien – sog. Nachhaltigkeitsindices vorgestellt und begutachtet werden. Der Aufbau der Arbeit stellt sich folgendermaßen dar: Kapitel 2 führt in die grundlegenden Begriffe – Nachhaltigkeit und Rating ein. In anbetracht der vielen oft nicht klar voneinander abzugrenzenden Ausdrücke werden Begriffsdefinitionen gegeben, die semantische Missverständnisse verhindern sollen. Es wird der Frage nachgegangen inwiefern Nachhaltigkeit und Rating in einem Konzept integrierbar sind und worin die Legitimation dieser Integration liegt. Kapitel 3 befasst sich eingehend mit dem Konzept des nachhaltigkeitsorientierten Ratings. Es wird der prinzipielle Ablauf eines solchen Verfahrens aufgezeigt Kapitel 4 versucht die Funktionen und Wirkungen, die im besonderen mit einem Öko-Rating einhergehen, darzustellen. Im Kapitel 5 wird eine Bewertungssystematik für Öko-Ratings erstellt. Diese soll es ermöglichen eine Bewertung der unterschiedlichen Ratingansätze vorzunehmen. Kapitel 6 stellt die wichtigsten im deutschsprachigen Raum etablierten Ansätze dar und gibt ein kurzes Portrait der betreffenden Rating-Agenturen. Kapitel 7 unterzieht die unter Kapitel 6 vorgestellten Ansätze anhand der im 5. Kapitel entwickelten Systematik einer vergleichenden Bewertung. Kapitel 8 befasst sich mit den sog...
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ÖKO-RATING – EIN IN SICH WIDERSPRÜCHLICHER BEGRIFF?
- 2.1 Nachhaltigkeit als Leitbild der Ökonomie
- 2.2 Rolle der Unternehmen in einer nachhaltigen Gesellschaft
- 2.3 Rating
- 2.3.1 grundlegende Definition
- 2.3.2. Funktion des Ratings für den Emittenten
- 2.3.3. Funktion des Ratings für den Investor
- 2.4. Öko-Rating
- 3. ABLAUF EINES ÖKO-RATINGS
- 3.1. Initiierung des Öko-Ratings
- 3.2. Datengewinnung für die Bewertung des Unternehmens
- 3.3. Ausschlusskriterien
- 3.4. Determinanten einer Bewertung
- 3.4.1. Ziele und Kriterien
- 3.4.2. Präferenzen
- 3.4.3. Umweltzustände
- 3.4.4. Alternativenraum
- 3.4.5. Bewertungsmethoden
- 3.5. Distribution der Ergebnisse
- 4. FUNKTIONEN EINES ÖKO-RATINGS
- 4.1. Funktion aus Sicht der Investoren
- 4.1.1. Verbesserung der Informationsgrundlage
- 4.1.2. Erhöhung der Marktvisibilität
- 4.1.3. Erhöhung der Markttransparenz
- 4.1.4. Zusatznutzen für den Investor
- 4.2. Funktion aus Sicht der Emittenten
- 4.2.1. Senkung der Finanzierungskosten / Erweiterung des Anlegerspektrums
- 4.2.2. Disziplinierungseffekt und Kompetenzgewinn
- 4.2.3. Verbesserung des Shareholder-Value und Imagevorteile
- 5. DIE BEWERTUNGSSYSTEMATIK VON ÖKO-RATING-ANSÄTZEN
- 5.1. Delegationsproblematik
- 5.2. Methodik
- 5.3. Kosten
- 6. BESCHREIBUNG DER RATING-AGENTUREN UND IHRER ANSÄTZE
- 6.1. oekom research AG
- 6.2. imug – Institut für Markt - Umwelt – Gesellschaft
- 6.3. SAM-Group – Sustainable Asset Management-Group
- 6.4. Centre Info
- 7. VERGLEICHENDE BEWERTUNG DER ÖKO-RATING-ANSÄTZE
- 7.1. Nachhaltigkeitsverständnis
- 7.2. Delegationsproblematik
- 7.2.1.Treffsicherheit → Ziele
- 7.2.2. Treffsicherheit →Alternativen
- 7.2.3. Treffsicherheit → Umweltzustände
- 7.2.4. Treffsicherheit → Präferenzen
- 7.3. Agency-Problematik
- 7.3.1. Transparenz
- 7.3.2. Anreize
- 7.4. Methodik
- 7.4.1. Erhebungsmethodik
- 7.4.2. Erfasste Dimensionen der Nachhaltigkeit
- 7.4.3. Bewertungsmethodik
- 7.5. Kosten
- 7.6. Tabellarische Darstellung der Ergebnisse
- 8. PORTFOLIOS ANHAND SOZIAL-ÖKOLOGISCHER KRITERIEN -\nNACHHALTIGKEITSINDICES
- 8.1. Der Dow Jones Sustainability Global Index – DJSGI
- 8.2. Der Naturaktienindex - NAI
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Thema der Unternehmensbewertung durch umweltbezogene Ratings. Sie untersucht den Begriff des Öko-Ratings im Detail und analysiert die verschiedenen Ansätze und Methoden, die von Rating-Agenturen verwendet werden. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Kombination aus Investment und Nachhaltigkeit durch Öko-Ratings realisiert werden kann.
- Die Bedeutung des Nachhaltigkeitsbegriffs für die Wirtschaft und die Rolle von Unternehmen in einer nachhaltigen Gesellschaft
- Die Funktionsweise von Öko-Ratings und deren Bedeutung für Investoren und Emittenten
- Die Bewertungssystematik verschiedener Öko-Rating-Ansätze und deren Vergleich hinsichtlich ihrer Methodik, Kosten und Treffsicherheit
- Die Darstellung und Analyse verschiedener Rating-Agenturen und ihrer Ansätze zur Bewertung von Unternehmen
- Die Rolle von Nachhaltigkeitsindizes wie dem Dow Jones Sustainability Global Index und dem Naturaktienindex
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema der Unternehmensbewertung durch umweltbezogene Ratings und beleuchtet die Bedeutung des Nachhaltigkeitsbegriffs in der heutigen Zeit. Kapitel 2 analysiert den Begriff des Öko-Ratings und dessen Relevanz für Unternehmen und Investoren. Kapitel 3 beschreibt den Ablauf eines Öko-Ratings, inklusive der Datenerhebung, der Kriterien und der Bewertungsmethoden. Kapitel 4 erläutert die Funktionen eines Öko-Ratings aus Sicht der Investoren und der Emittenten. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Bewertungssystematik verschiedener Öko-Rating-Ansätze, wobei die Delegationsproblematik, die Methodik und die Kosten betrachtet werden. Kapitel 6 stellt verschiedene Rating-Agenturen und ihre Ansätze vor, während Kapitel 7 eine vergleichende Bewertung der Öko-Rating-Ansätze liefert. Kapitel 8 behandelt die Entwicklung von Portfolios anhand sozial-ökologischer Kriterien und stellt Nachhaltigkeitsindizes vor.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit dem Themenkomplex der Unternehmensbewertung durch umweltbezogene Ratings. Schlüsselbegriffe sind hier Nachhaltigkeit, Öko-Rating, Rating-Agenturen, Bewertungsmethodik, Delegationsproblematik, Agency-Problematik, Nachhaltigkeitsindizes und Investitionsentscheidungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Öko-Rating?
Ein Öko-Rating ist ein Verfahren, bei dem Unternehmen nach ökologischen und nachhaltigen Kriterien bewertet werden, um Investoren eine Entscheidungsgrundlage zu bieten.
Welchen Nutzen hat ein Öko-Rating für Investoren?
Es erhöht die Markttransparenz, verbessert die Informationsgrundlage über ökologische Risiken und ermöglicht Geldanlagen im Einklang mit Moralvorstellungen.
Was sind Ausschlusskriterien bei Nachhaltigkeits-Ratings?
Dies sind Kriterien, die Unternehmen sofort vom Investment ausschließen, wie z. B. Kinderarbeit, Rüstungsproduktion oder schwere Umweltverstöße.
Welche Rating-Agenturen werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit analysiert Agenturen wie oekom research AG, imug, die SAM-Group und Centre Info.
Was ist der Dow Jones Sustainability Index (DJSGI)?
Es ist ein weltweit bekannter Aktienindex, der die finanzielle Performance der führenden nachhaltigen Unternehmen abbildet.
Können Öko-Ratings die Finanzierungskosten senken?
Ja, ein gutes Rating kann das Anlegerspektrum erweitern und durch Imagevorteile sowie Disziplinierungseffekte langfristig die Kapitalkosten für den Emittenten senken.
- Arbeit zitieren
- Tim Hedfeld (Autor:in), 2003, Neue Ansätze zur Unternehmensbewertung durch umweltbezogene Ratings, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28479