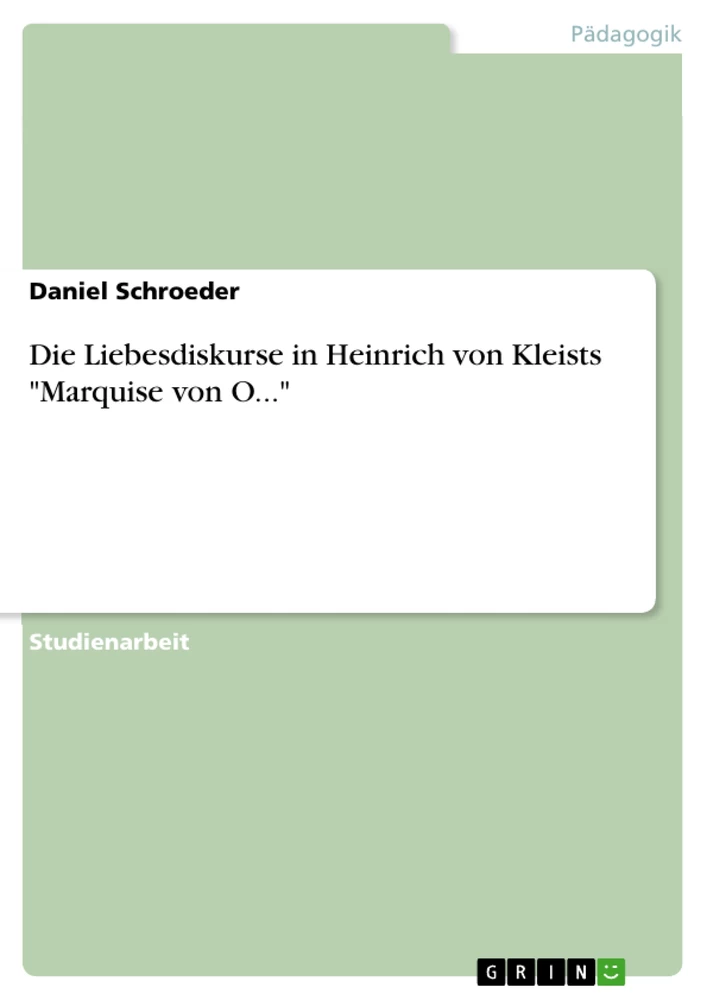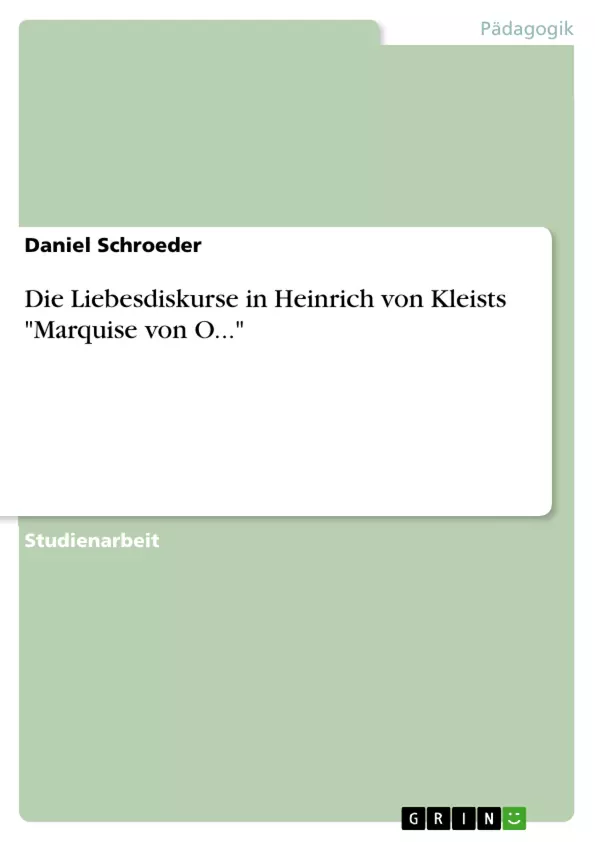Liebe ist etwas, das nicht wirklich beschrieben, sondern eher gefühlt werden kann. Die Definition des Terminus ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil jeder seine eigene Vorstellung davon hat, wo und wie Liebe stattfindet, wie sie sich äußert und anfühlt. Es gibt verschiedene Begriffe für bestimmte Arten von Liebe. Dies verdeutlicht, dass Zuneigung hochgradig variant sein kann. Demzufolge kann die Liebe in der Literatur unterschiedlich definiert und dargestellt werden.
In dieser Hausarbeit wird der Fokus auf die Liebe zwischen Menschen in Heinrich von Kleists Die Marquise von O… gerichtet. Hierbei können verschiedene „Arten“ von Zuneigung festgestellt werden.
Die Liebesdiskurse in Heinrich von Kleists Die Marquise von O… sind sehr unterschiedlich. Die Frage nach der Darstellung und Bewertung dieser Liebesdiskurse mit Hilfe von Analysen der figuralen Interaktionen im Buch zu beantworten, ist das Ziel der vorliegenden Hausarbeit.
Diese Liebesdiskurse können bestimmten Liebeskonzepten zugeordnet werden. In der vorliegenden Arbeit wird dabei eine Unterteilung in geschlechtliche und familiäre Liebe vorgenommen. Bei der geschlechtlichen Liebe wird zwischen vernünftiger und romantischer Liebe unterschieden. Heinrich von Kleist lebte von 1777 bis 1811. In dieser Zeit wurden beide Liebesdiskurse in der Literatur dargestellt, da es während der Aufklärung im 18. Jahrhundert einen Wandel der Werte gab, was zu verschiedenen Liebesauffassungen führte, weil die Entwicklung zum bürgerlichen Ehe- und Liebesideal häufig nur bestimmte Bevölkerungsgruppen und Schichten betraf. Die vernünftige und romantische Liebe wurden beide in den Werken am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts thematisiert. Deswegen ist es interessant zu sehen, welche Form der Liebe zwischen den Figuren in Heinrich von Kleists "Die Marquise von O…" vorwiegend dargestellt wird.
Es gibt noch eine andere Form von Liebe zu Menschen, die in dem genannten Werk ebenfalls zum Vorschein kommt. Hierbei kann allgemein von familiärer Liebe gesprochen werden, die in Kindes- und Elternliebe unterteilt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Liebesdiskurse in Die Marquise von O...
- Geschlechtliche Liebe
- Vernünftige Liebe
- Romantische Liebe
- Familiäre Liebe
- Kindesliebe
- Elternliebe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Liebesdiskurse in Heinrich von Kleists „Die Marquise von O...“ und untersucht, wie diese Diskurse in den figuralen Interaktionen des Werks dargestellt und bewertet werden. Ziel ist es, die verschiedenen Liebeskonzepte, die in der Erzählung zum Ausdruck kommen, zu identifizieren und zu analysieren.
- Die Darstellung verschiedener Liebesformen in „Die Marquise von O...“
- Die Unterscheidung zwischen vernünftiger und romantischer Liebe
- Die Rolle der familiären Liebe in der Erzählung
- Die Bedeutung der gesellschaftlichen Normen und Erwartungen für die Liebesbeziehungen
- Die Auswirkungen der Liebesdiskurse auf die Handlung und die Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Liebesdiskurse in der Literatur ein und stellt die Relevanz des Themas für die Analyse von Heinrich von Kleists „Die Marquise von O...“ heraus. Sie beleuchtet die verschiedenen Begriffsdefinitionen von Liebe und die unterschiedlichen Arten von Zuneigung, die in der Literatur vorkommen.
Das Kapitel „Die Liebesdiskurse in Die Marquise von O...“ analysiert die verschiedenen Liebeskonzepte, die in der Erzählung zum Ausdruck kommen. Es wird zwischen geschlechtlicher und familiärer Liebe unterschieden. Die geschlechtliche Liebe wird weiter in vernünftige und romantische Liebe unterteilt. Die Analyse der Liebesdiskurse erfolgt anhand der figuralen Interaktionen im Werk.
Das Kapitel „Geschlechtliche Liebe“ untersucht die verschiedenen Formen der geschlechtlichen Liebe in „Die Marquise von O...“. Es wird die Entwicklung des Begriffs der vernünftigen Liebe von der Renaissance bis zur Aufklärung beleuchtet und die verschiedenen Formen der vernünftigen Liebe in der Literatur dargestellt. Die Analyse der Liebesbeziehung zwischen der Marquise und dem Grafen F. zeigt, dass diese Beziehung eher von Vernunft als von romantischer Liebe geprägt ist.
Das Kapitel „Familiäre Liebe“ analysiert die verschiedenen Formen der familiären Liebe in „Die Marquise von O...“. Es wird die Bedeutung der Kindesliebe und der Elternliebe für die Figuren und die Handlung der Erzählung untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Liebesdiskurse in Heinrich von Kleists „Die Marquise von O...“, die Unterscheidung zwischen vernünftiger und romantischer Liebe, die Rolle der familiären Liebe, die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen sowie die Auswirkungen der Liebesdiskurse auf die Handlung und die Figuren. Der Text analysiert die verschiedenen Liebeskonzepte, die in der Erzählung zum Ausdruck kommen, und untersucht, wie diese Diskurse in den figuralen Interaktionen des Werks dargestellt und bewertet werden.
Häufig gestellte Fragen
Welche Liebeskonzepte werden in „Die Marquise von O...“ analysiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen geschlechtlicher Liebe (vernünftig vs. romantisch) und familiärer Liebe (Kindes- vs. Elternliebe).
Was versteht man unter „vernünftiger Liebe“?
Ein Konzept der Aufklärung, bei dem die Partnerwahl eher auf sozialen Normen, Standesinteressen und rationalen Erwägungen als auf Leidenschaft basiert.
Wie wird die Beziehung zwischen der Marquise und dem Grafen bewertet?
Die Analyse zeigt, dass ihre Interaktion stark von gesellschaftlichen Konventionen und Vernunft geprägt ist, weniger von einer romantischen Idealvorstellung.
Welche Rolle spielt die familiäre Liebe im Werk?
Sie wird durch die extremen Reaktionen der Eltern auf die Schwangerschaft der Marquise und die spätere Versöhnung als zentrales Handlungselement dargestellt.
Wie beeinflussen gesellschaftliche Normen die Liebe bei Kleist?
Die bürgerlichen Ehe- und Liebesideale des späten 18. Jahrhunderts setzen die Figuren unter Druck und bestimmen deren Handlungsspielraum.
- Quote paper
- MA Daniel Schroeder (Author), 2013, Die Liebesdiskurse in Heinrich von Kleists "Marquise von O...", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/284368