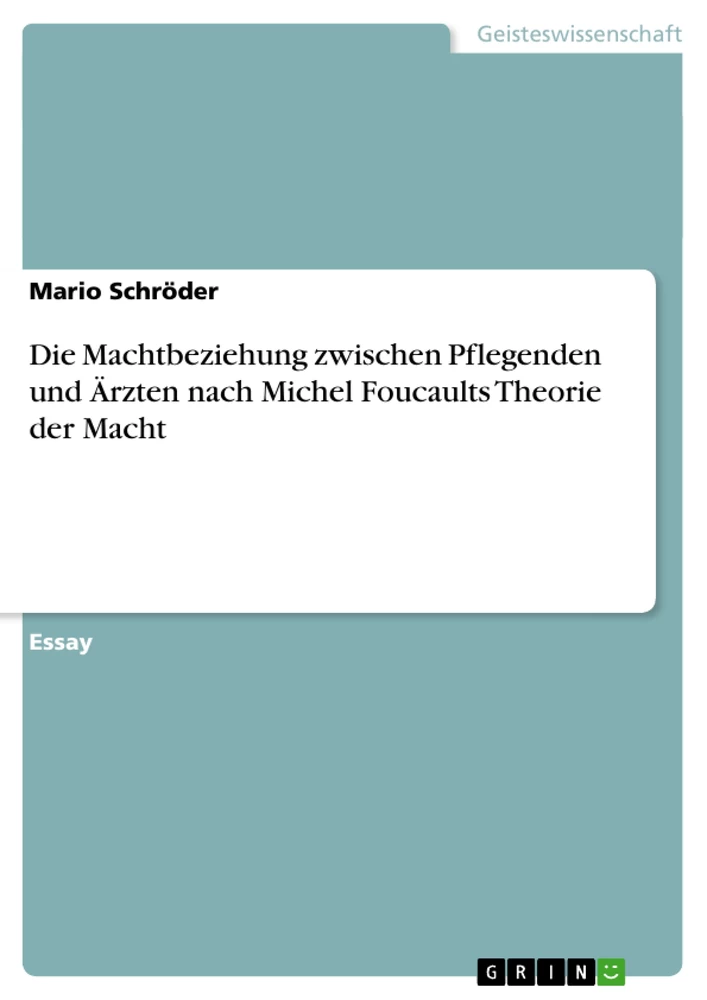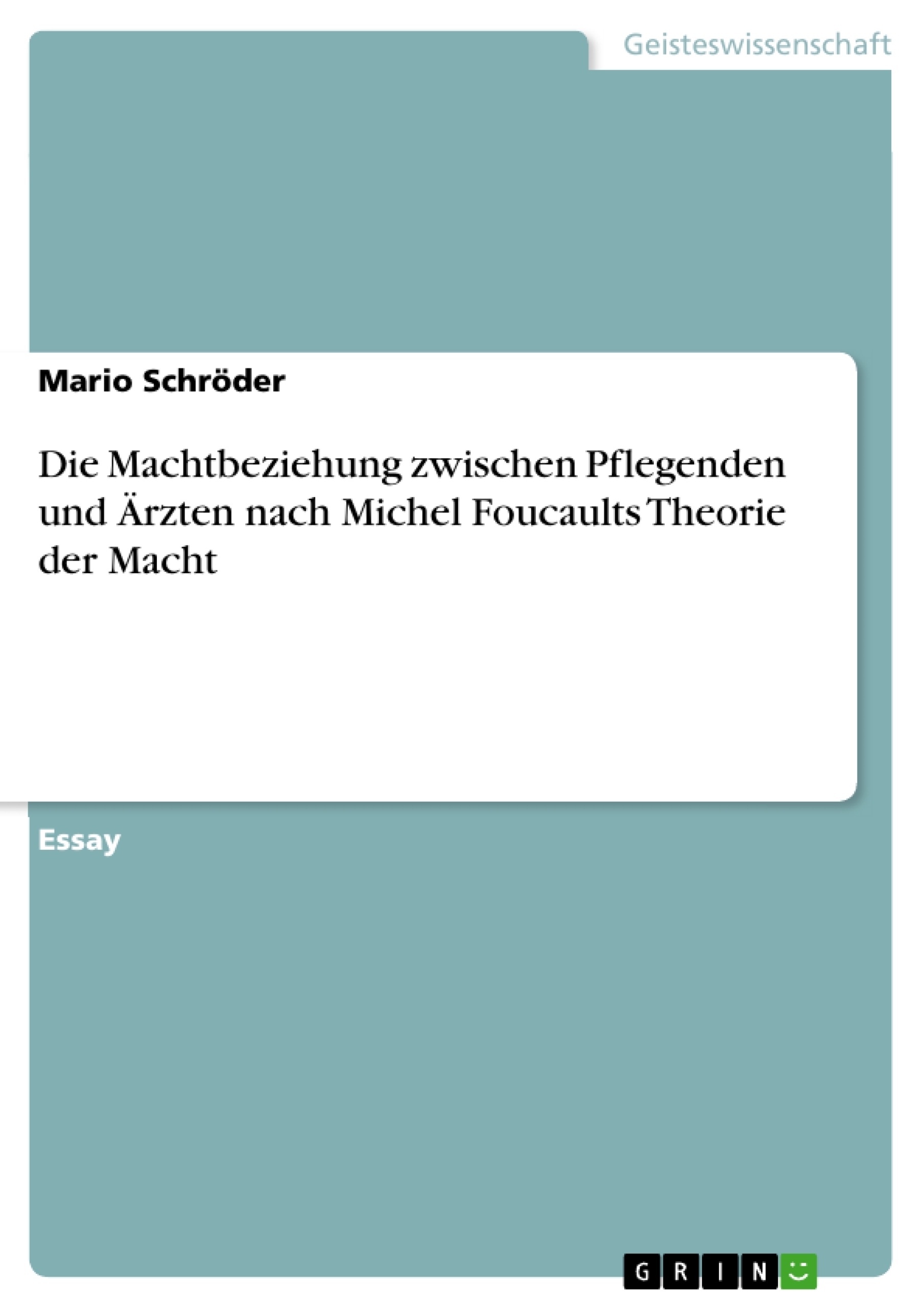In dieser Arbeit geht es um die Machttheorie des französischen Philosophen Michel Foucault. Anhand des im Semester bearbeiteten Textes wird im ersten Teil der Arbeit der Foucaultsche Machtbegriff erklärt und in die Machtanalyse eingeführt. Im zweiten Teil wird anhand der Machtanalyse die Machtasymmetrie in der Beziehung zwischen Pflegenden und Ärzten im Gesundheitswesen beschrieben und wie sie historisch gewachsen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Foucaults Machtbegriff und die Machtanalyse
- Die Machtbeziehung zwischen Pflegenden und Ärzten
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Machttheorie des französischen Philosophen Michel Foucault. Sie analysiert den Foucaultschen Machtbegriff und seine Machtanalysemethode, um die Machtasymmetrie in der Beziehung zwischen Pflegenden und Ärzten im Gesundheitswesen zu beleuchten.
- Foucaults Machtbegriff und seine Machtanalyse
- Die Subjektivierung von Menschen durch Macht
- Die Machtbeziehung zwischen Pflegenden und Ärzten
- Die historische Entwicklung der Machtasymmetrie im Gesundheitswesen
- Möglichkeiten zur Veränderung von Machtstrukturen im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den Fokus auf die Machttheorie von Michel Foucault und ihre Anwendung im Gesundheitswesen dar. Im zweiten Kapitel wird der Foucaultsche Machtbegriff erläutert und in die Machtanalyse eingeführt. Foucault beschreibt Macht als ein allgegenwärtiges Phänomen, das in allen sozialen Beziehungen wirkt und die Identitäten von Subjekten prägt. Er entwickelt eine Methode zur Analyse von Machtbeziehungen, die auf dem Wechselspiel gegensätzlicher Strategien basiert. Im dritten Kapitel wird die Machtasymmetrie in der Beziehung zwischen Pflegenden und Ärzten im Gesundheitswesen anhand der Foucaultschen Machtanalyse untersucht. Es wird gezeigt, wie die Machtverhältnisse historisch gewachsen sind und welche Faktoren zu den bestehenden Machtstrukturen geführt haben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Michel Foucaults Machttheorie, die Machtanalyse, die Machtbeziehung zwischen Pflegenden und Ärzten, die Subjektivierung von Menschen durch Macht, die historische Entwicklung der Machtasymmetrie im Gesundheitswesen und Möglichkeiten zur Veränderung von Machtstrukturen im Gesundheitswesen.
- Quote paper
- Mario Schröder (Author), 2010, Die Machtbeziehung zwischen Pflegenden und Ärzten nach Michel Foucaults Theorie der Macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/284001