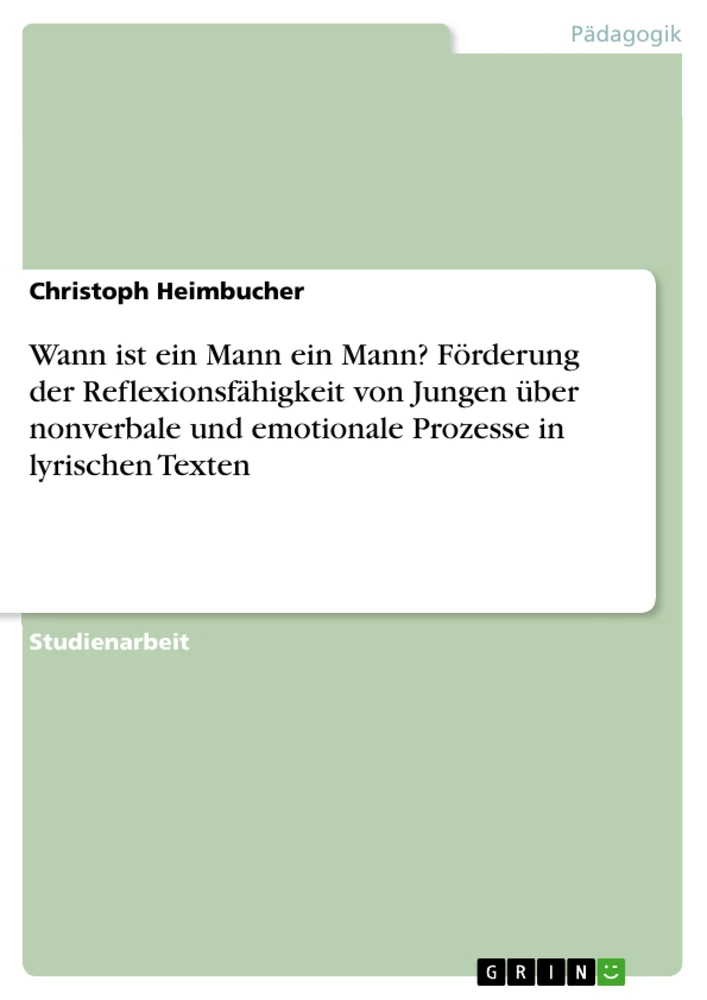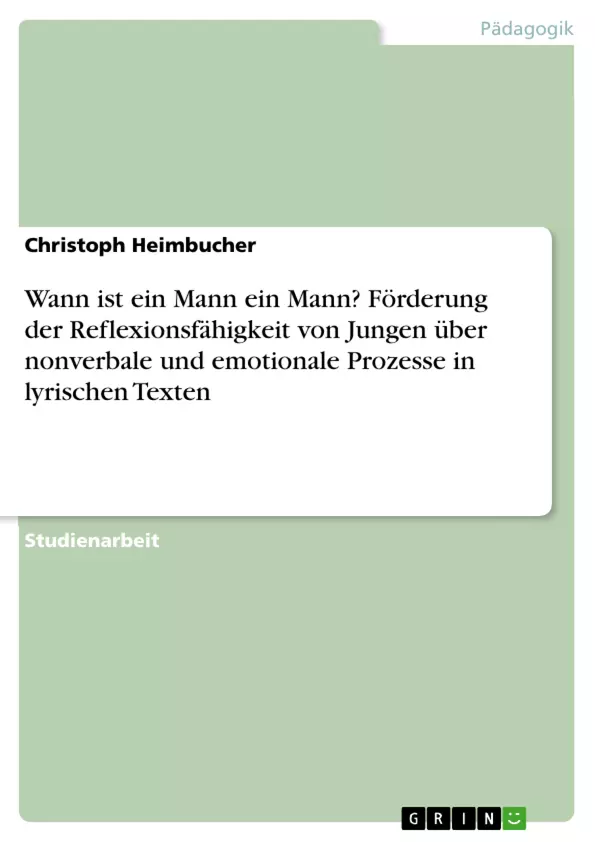Der „PISA-Schock“ im deutschen Bildungswesen verstärkte sich durch den Blick auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Denn obwohl sich der durchschnittliche Lesekompetenzwert der Schülerinnen und Schüler in Deutschland in Relation zum OECD-Durchschnitt über die Jahre verbessert hat, ist der Befund, „dass Jungen deutlich geringere Kompetenzen im Lesen erzielen als Mädchen“, bis heute gleichbleibend. Über 50% der an der ersten PISA-Studie teilnehmenden deutschen Jungen gaben an, nur zu lesen, wenn sie es müssten. Bei den Mädchen äußerte sich nur etwa ein Viertel in dieser Weise. Auch diese Beobachtung erweist sich als „langfristig stabil“.
So erscheint es auch heute noch wichtig, die Leseförderung von Jungen in den Fokus des Deutschunterrichtes zu rücken. Dabei berücksichtigen die meisten Konzepte zur Leseförderung heute ganz selbstverständlich die biologischen und sozialen Einflüsse auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Jungen und versuchen, diesen Vorbedingungen gerecht zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jungenforschung
- 2.1. Biologische Einflüsse
- 2.1.1. Gehirn
- 2.1.2. Weitere evolutionsbiologische Einflüsse
- 2.2. Soziale Einflüsse
- 2.2.1. Eltern
- 2.2.2. Schule
- 2.2.3. Peer-Group
- 2.2.4. Medien
- 2.3. Zusammenfassung
- 3. Konzept
- 3.1. Kompetenzen
- 3.1.1. Lesekompetenz
- 3.1.2. Emotionale Kompetenz
- 3.1.3. Verbalisierungskompetenz
- 3.2. Lehrerfunktionen
- 3.3. Rahmenbedingungen
- 3.3.1. Koedukation
- 3.3.2. Eine Jungenkonferenz?
- 3.3.3. Leistungsbewertung
- 3.3.4. Ablauf einer Unterrichtseinheit
- 3.4. Vier Bausteine des Konzeptes
- 3.4.1. Baustein 1: Öffnung (sich und andere anders kennenlernen)
- 3.4.1.1. Körperübung Pendeln
- 3.4.1.2. Wann ist ein Mann ein Mann?
- 3.4.2. Baustein 2: Widerstände gegen Lyrik auflösen
- 3.4.3. Baustein 3: zwischen den Zeilen lesen
- 3.4.4. Baustein 4: einen eigenen Ausdruck finden – Poetry Slam
- 3.4.4.1. Poetry Slam – 1. Phase
- 3.4.4.2. Poetry Slam - 2. Phase
- 3.4.4.3. Poetry Slam - 3. Phase
- 4. Schlussbemerkung
- 5. Evaluation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit entwickelt ein Konzept zur Förderung der Reflexionsfähigkeit von Jungen im Umgang mit lyrischen Texten. Das Konzept zielt darauf ab, die Lesekompetenz, die emotionale Kompetenz und die Verbalisierungskompetenz von Jungen zu verbessern, um eine fundierte Auseinandersetzung mit Literatur zu ermöglichen. Es berücksichtigt dabei die spezifischen Herausforderungen, die Jungen im Deutschunterricht, insbesondere beim Umgang mit Lyrik, oftmals begegnen.
- Förderung der Lesekompetenz bei Jungen
- Analyse geschlechtsspezifischer Unterschiede im Umgang mit Lyrik
- Entwicklung emotionaler und verbaler Kompetenzen
- Konzeption eines praxisorientierten Unterrichtsansatzes
- Reflexion über nonverbale und emotionale Prozesse in lyrischen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Hintergrund des Konzepts vor dem Hintergrund der PISA-Studien und der daraus resultierenden Feststellung, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen deutlich geringere Lesekompetenzen aufweisen. Sie verweist auf die Notwendigkeit, gezielte Leseförderungsmaßnahmen für Jungen zu entwickeln und argumentiert für den Einsatz von Lyrik als ein bisher möglicherweise zu wenig genutztes Medium zur Förderung der Lesekompetenz und der damit verbundenen Kompetenzen. Die Einleitung führt in die Problematik der „Sprachlosigkeit“ von Jungen gegenüber lyrischen Texten ein und begründet die Notwendigkeit, die biologischen und sozialen Faktoren, die zu diesem Phänomen beitragen, zu untersuchen.
2. Jungenforschung: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen für die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Umgang mit Lyrik, indem es biologische und soziale Einflüsse analysiert. Der Abschnitt zu den biologischen Einflüssen beleuchtet Unterschiede im Gehirnaufbau und die Rolle von Hormonen. Die soziale Komponente betrachtet Einflüsse von Familie, Schule, Peer-Group und Medien auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Jungen und deren Auswirkungen auf ihre Lesekompetenz und den Umgang mit Literatur. Es wird ein konstruktivistischer Ansatz der Gender-Forschung vorgestellt, der die aktive Gestaltung der Geschlechtsidentität betont und die Möglichkeit von Jungen, hergebrachte Geschlechterrollen zu hinterfragen und zu verändern, hervorhebt.
3. Konzept: Das Kernstück der Arbeit beschreibt ein Konzept zur Förderung der Reflexionsfähigkeit von Jungen über nonverbale und emotionale Prozesse in lyrischen Texten. Es definiert die relevanten Kompetenzen (Lesekompetenz, emotionale Kompetenz, Verbalisierungskompetenz) und beschreibt die Rolle der Lehrkraft bei der Umsetzung des Konzepts. Der Abschnitt zu den Rahmenbedingungen beleuchtet die Bedeutung der Koedukation, die Möglichkeit einer Jungenkonferenz, die Leistungsbewertung und den Ablauf einer Unterrichtseinheit. Das Herzstück des Konzepts besteht aus vier Bausteinen: Öffnung (sich und andere anders kennenlernen), Auflösung von Widerständen gegen Lyrik, das Lesen zwischen den Zeilen und das Finden eines eigenen Ausdrucks mittels Poetry Slam. Jeder Baustein ist detailliert erklärt und mit konkreten Beispielen illustriert.
Schlüsselwörter
Jungenforschung, Lesekompetenz, Lyrik, Emotionale Kompetenz, Verbalisierungskompetenz, Geschlechtsidentität, Koedukation, Poetry Slam, Reflexion, Deutschunterricht, PISA-Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Konzept zur Förderung der Reflexionsfähigkeit von Jungen im Umgang mit Lyrik
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit entwickelt ein Konzept zur Verbesserung der Lesekompetenz, emotionalen Kompetenz und Verbalisierungskompetenz von Jungen im Deutschunterricht, speziell im Umgang mit Lyrik. Sie analysiert die Ursachen für die oft beobachteten Schwierigkeiten von Jungen mit lyrischen Texten und bietet einen praxisorientierten Unterrichtsansatz.
Warum ist dieses Konzept notwendig?
PISA-Studien zeigen deutlich geringere Lesekompetenzen bei Jungen im Vergleich zu Mädchen. Das Konzept zielt darauf ab, gezielte Maßnahmen zur Leseförderung bei Jungen zu entwickeln und Lyrik als bisher möglicherweise untergenutztes Medium für die Kompetenzentwicklung zu nutzen. Es adressiert die Problematik der „Sprachlosigkeit“ von Jungen im Kontext lyrischer Texte.
Welche Faktoren beeinflussen die Lesekompetenz von Jungen?
Die Arbeit untersucht sowohl biologische als auch soziale Einflüsse. Biologische Faktoren umfassen Unterschiede im Gehirnaufbau und hormonelle Einflüsse. Soziale Faktoren umfassen den Einfluss von Familie, Schule, Peer-Group und Medien auf die Geschlechtsidentität und deren Auswirkungen auf die Lesekompetenz.
Welche Kompetenzen werden durch das Konzept gefördert?
Das Konzept zielt auf die Verbesserung der Lesekompetenz, der emotionalen Kompetenz und der Verbalisierungskompetenz ab. Es fördert die Fähigkeit, lyrische Texte fundiert zu analysieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Wie ist das Konzept aufgebaut?
Das Konzept besteht aus vier Bausteinen: 1. Öffnung (sich und andere anders kennenlernen), 2. Auflösung von Widerständen gegen Lyrik, 3. Lesen zwischen den Zeilen und 4. Finden eines eigenen Ausdrucks mittels Poetry Slam. Jeder Baustein enthält konkrete Beispiele und Methoden.
Welche Rolle spielt die Lehrkraft im Konzept?
Die Lehrkraft spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Konzepts. Sie moderiert die Aktivitäten, unterstützt die Schüler und schafft ein positives Lernumfeld. Die Arbeit beschreibt die spezifischen Aufgaben und Funktionen der Lehrkraft.
Welche Rahmenbedingungen sind wichtig für die Umsetzung des Konzepts?
Die Arbeit diskutiert die Bedeutung von Koedukation, der Möglichkeit einer Jungenkonferenz, der Leistungsbewertung und dem Ablauf einer Unterrichtseinheit im Kontext des Konzepts.
Wie wird der Erfolg des Konzepts evaluiert?
Die Arbeit enthält einen Abschnitt zur Evaluation, der jedoch im vorliegenden Auszug nicht im Detail beschrieben wird.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Jungenforschung, Lesekompetenz, Lyrik, Emotionale Kompetenz, Verbalisierungskompetenz, Geschlechtsidentität, Koedukation, Poetry Slam, Reflexion, Deutschunterricht, PISA-Studie.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Bausteinen des Konzepts?
Die detaillierten Beschreibungen der einzelnen Bausteine (Öffnung, Widerstände auflösen, zwischen den Zeilen lesen, Poetry Slam) befinden sich im Hauptteil der Arbeit, der in diesem Auszug nur summarisch dargestellt ist.
- Arbeit zitieren
- Christoph Heimbucher (Autor:in), 2011, Wann ist ein Mann ein Mann? Förderung der Reflexionsfähigkeit von Jungen über nonverbale und emotionale Prozesse in lyrischen Texten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/283697