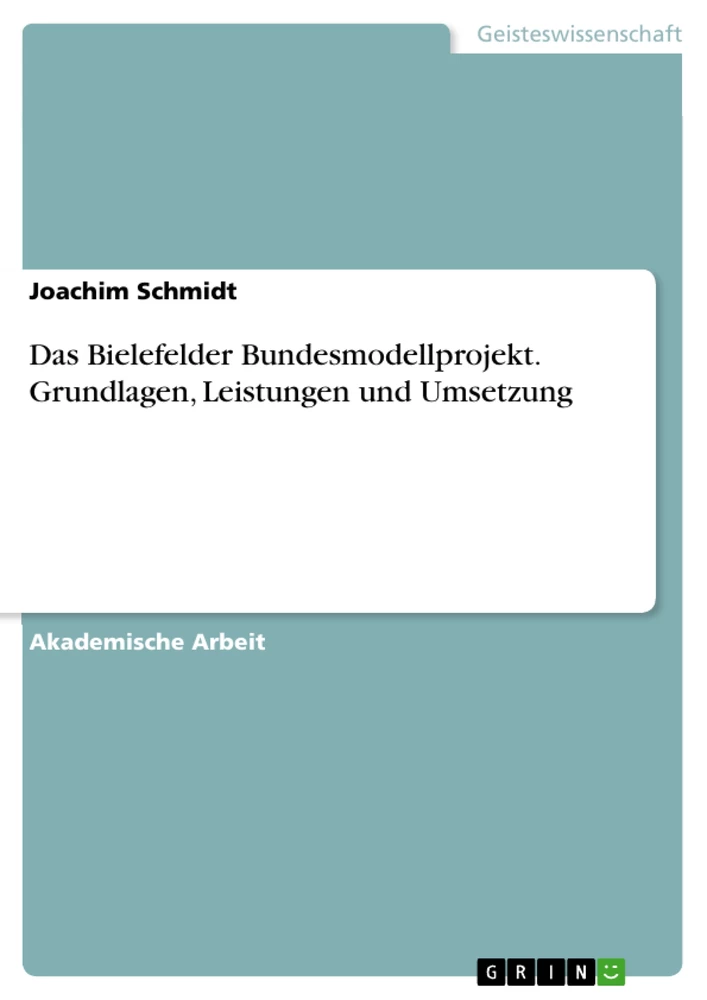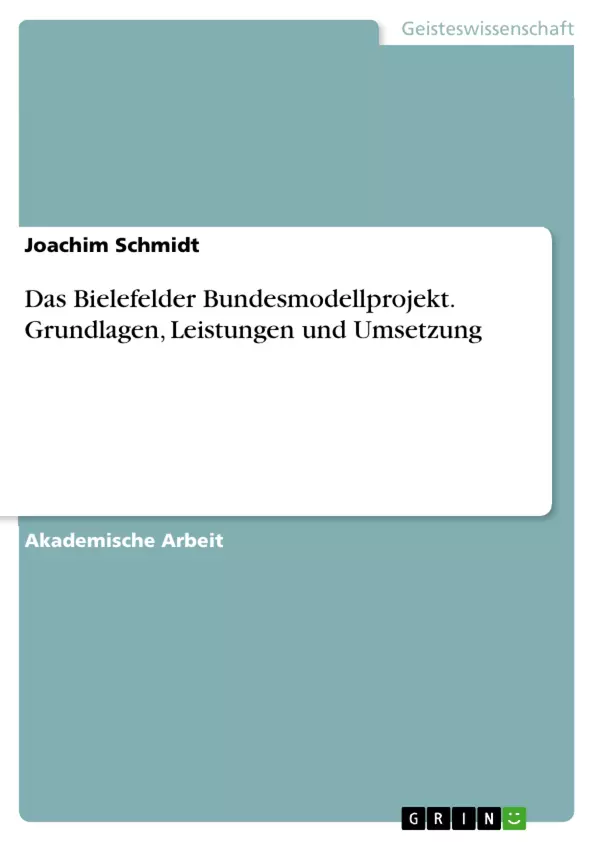In der folgenden Arbeit stelle ich das Bielefelder Bundesmodellprojekt für Menschen mit Behinderung vor. Als globale Ziele des Projekts werden sowohl die „Stärkung der Selbstständigkeit und Eigeninitiative Betroffener“ und die „Erhöhung der Dispositionsmöglichkeiten Betroffener“ als auch die „Organisation passgenauerer Hilfen“ und keine Kostensteigerungen bzw. langfristig gegebenenfalls Kostensenkungen genannt.
Zunächst beginne ich im nächsten Abschnitt mit einer Darstellung der rechtlichen Grundlagen des Modellprojekts, um dann im darauffolgenden Abschnitt näher auf die potentiell budgetfähigen Leistungen einzugehen. Die konkrete Umsetzung des Bielefelder Modellprojekts wird dann von mir in Abschnitt 1.3 beschrieben. Zum Abschluss stelle ich dann zwei potenzielle Fallbeispiele vor.
Inhaltsverzeichnis
- DAS BIELEFELDER BUNDESMODELLPROJEKT.
- RECHTLICHE GRUNDLAGEN DES BUNDESMODELLPROJEKTS..
- POTENTIELL BUDGETFÄHIGE LEISTUNGEN.
- UMSETZUNG DES BIELEFELDER MODELLPROJEKTS
- POTENZIELLE FALLBEISPIELE .....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Bielefelder Bundesmodellprojekt zum Persönlichen Budget. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Projekts, die potentiell budgetfähigen Leistungen und die konkrete Umsetzung. Darüber hinaus werden zwei potenzielle Fallbeispiele vorgestellt.
- Rechtliche Grundlagen des Persönlichen Budgets
- Potentiell budgetfähige Leistungen
- Umsetzung des Bundesmodellprojekts in Bielefeld
- Fallbeispiele für die Anwendung des Persönlichen Budgets
- Bewertung des Bundesmodellprojekts und seiner Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1.1: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Bundesmodellprojekts zum Persönlichen Budget. Es untersucht die relevanten Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs IX (SGB IX) und diskutiert die Entwicklung des Persönlichen Budgets von den ersten Modellprojekten bis zur bundesweiten Einführung.
- Kapitel 1.2: In diesem Kapitel werden die potentiell budgetfähigen Leistungen im Rahmen des Persönlichen Budgets vorgestellt. Es wird erläutert, welche Leistungen für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen im Rahmen des SGB IX als budgetfähig gelten.
- Kapitel 1.3: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Umsetzung des Bielefelder Bundesmodellprojekts zum Persönlichen Budget. Es geht auf die Organisation, die beteiligten Akteure und die Abläufe des Projekts ein.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel präsentiert zwei potenzielle Fallbeispiele, die die Anwendung des Persönlichen Budgets in der Praxis verdeutlichen. Die Fallbeispiele zeigen, wie die Leistungsempfänger das Persönliche Budget nutzen können, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen und an der Gesellschaft teilzuhaben.
Schlüsselwörter
Persönliches Budget, Bundesmodellprojekt, Bielefeld, SGB IX, Teilhabe, Rehabilitation, Behinderung, Eingliederungshilfe, Budgetverordnung, Modellregion, Leistungsanspruch, Sachleistungen, Geldleistungen, Fallbeispiele, Trägerübergreifende Leistung, sozialstaatliche Prinzipien.
- Quote paper
- Joachim Schmidt (Author), 2006, Das Bielefelder Bundesmodellprojekt. Grundlagen, Leistungen und Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/283622