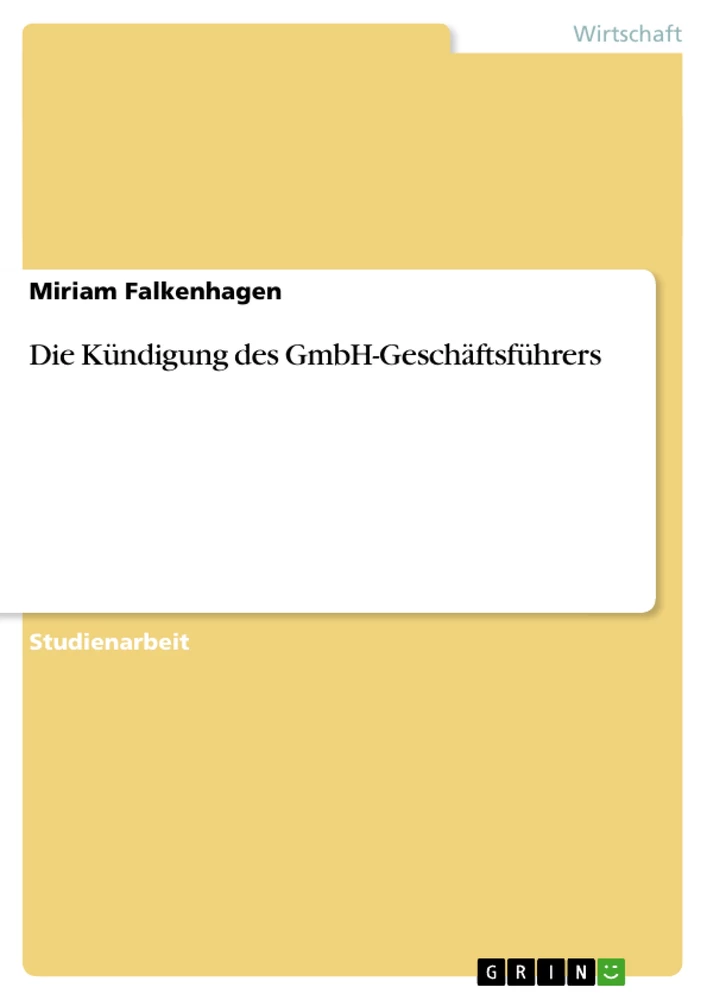Die GmbH als juristische Person benötigt für ihre Handlungsfähigkeit bestimmte Organe und eine organschaftliche Struktur. Das Vorhandensein eines oder mehrerer Geschäftsführer die sie gerichtlich und außergerichtlich vertritt und die Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung, sind gesetzlich vorgeschrieben1. Der GmbH- Geschäftsführer (nachfolgend meist als „Geschäftsführer“ bezeichnet) trägt als ausführendes Organ der Gesellschaft eine große Verantwortung mit bestimmten Rechten und Pflichten, welche in der einführenden Darstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Organe der GmbH beschrieben werden. Der darin aufgeführte Aufsichtsrat wird in dieser Arbeit weitgehend außeracht gelassen und deren eventuelle, im Gesellschaftsvertrag geregelten bzw. sich aus dem Gesetz ergebenden Zuständigkeiten werden der Gesellschafterversammlung zugerechnet. Die Stellung als Vertretungsorgan der Gesellschaft erhält der Geschäftsführer durch die Bestellung. Gesellschafter, aber auch nicht an der Gesellschaft beteiligte Personen können zum Geschäftsführer bestellt werden. Da die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer grundsätzlich gleich sind und nur ein Interessengegensatz bestehen kann, wird im Folgenden nur an bestimmten, für die Arbeit relevanten Stellen auf die sich ergebenden Unterschiede eingegangen.
I. d. R. besteht zusätzlich zu der organschaftlichen Bestellung ein vertragliches Dienstverhältnis zwischen Gesellschaft und Geschäftsführer, welches durch die Anstellung begründet wird. Diese Differenzierung und die daraus folgenden Erörterung der Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberstellung des Geschäftsführers ist vor allem im Hinblick auf die Beendigung der Geschäftsführertätigkeit und die dann eventuell anzuwendenden Arbeitnehmerschutzvorschriften von großer Bedeutung. Dementsprechend folgt im ersten Teil dieser Arbeit eine Klärung und Einordnung der Rechtsstellung des Geschäftsführers, um im Folgenden nicht anwendbare Vorschriften ausschließen zu können und um die getrennten Ausführungen zu der Beendigung der Geschäftsführertätigkeit zu begründen. Die Behandlung der Beendigung der Organstellung des Geschäftsführers im zweiten Teil, ist für diese Arbeit insoweit von Bedeutung, als dass in der Praxis Kündigung und Abberufung meist gekoppelt werden und sich bestimmte Voraussetzungen und Herangehensweisen im weitesten Sinne entsprechen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der GmbH-Geschäftsführer.
- Die Aufgaben und Pflichten.
- Einordnung der Rechtsstellung
- Die Gesellschaftsbeteiligung
- Die Grundlagen der Geschäftsführertätigkeit
- Die Anwendbarkeit sozialer Schutzvorschriften und der Arbeitsgerichtsweg
- Die Beendigung der Organstellung des Geschäftsführers
- Die Abberufung .
- Die Amtsniederlegung.
- Die Beendigung des Anstellungsvertrages des Geschäftsführers
- Die Trennungstheorie.
- Die ordentliche Kündigung des Anstellungsvertrages...
- Die außerordentliche Kündigung des Anstellungsvertrages..
- Die Erfordernis des wichtigen Grundes
- Die Kündigungsfrist des § 626 II BGB
- Die Erfordernis der vorherigen Abmahnung.
- Ansprüche und Pflichten des Geschäftsführers nach Beendigung seiner Geschäftsführertätigkeit
- Die Abfindungsansprüche und der Gerichtsweg bei Kündigungsstreitigkeiten...………………..\n
- Die nachvertraglichen Pflichten
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Rechtsstellung des GmbH-Geschäftsführers und den Besonderheiten bei der Beendigung seiner Tätigkeit. Der Fokus liegt auf der Klärung der rechtlichen Grundlagen und der verschiedenen Möglichkeiten der Beendigung sowohl der organschaftlichen Stellung als auch des Anstellungsvertrages.
- Rechtliche Einordnung des GmbH-Geschäftsführers
- Abgrenzung zwischen Organstellung und Arbeitsverhältnis
- Möglichkeiten der Beendigung der Geschäftsführertätigkeit
- Anwendbarkeit von Arbeitnehmerschutzvorschriften
- Ansprüche und Pflichten nach Beendigung der Tätigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Geschäftsführertätigkeit in GmbHs ein und beschreibt die organschaftliche Struktur und die Bedeutung des Geschäftsführers als Vertretungsorgan. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Rechtsstellung des Geschäftsführers, wobei die Aufgaben und Pflichten sowie die Abgrenzung zwischen Gesellschaftsbeteiligung, Grundlagen der Geschäftsführertätigkeit und der Anwendbarkeit sozialer Schutzvorschriften im Detail beleuchtet werden. Kapitel 3 behandelt die Beendigung der Organstellung des Geschäftsführers durch Abberufung und Amtsniederlegung. Kapitel 4 widmet sich der Beendigung des Anstellungsvertrages, wobei die Trennungstheorie, die ordentliche Kündigung und die außerordentliche Kündigung mit ihren jeweiligen Voraussetzungen erläutert werden.
Schlüsselwörter
GmbH-Geschäftsführer, Organstellung, Anstellungsvertragsrecht, Beendigung der Geschäftsführertätigkeit, Abberufung, Amtsniederlegung, ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung, wichtiger Grund, Abfindungsansprüche, nachvertragliche Pflichten.
- Quote paper
- Miriam Falkenhagen (Author), 2004, Die Kündigung des GmbH-Geschäftsführers, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28237