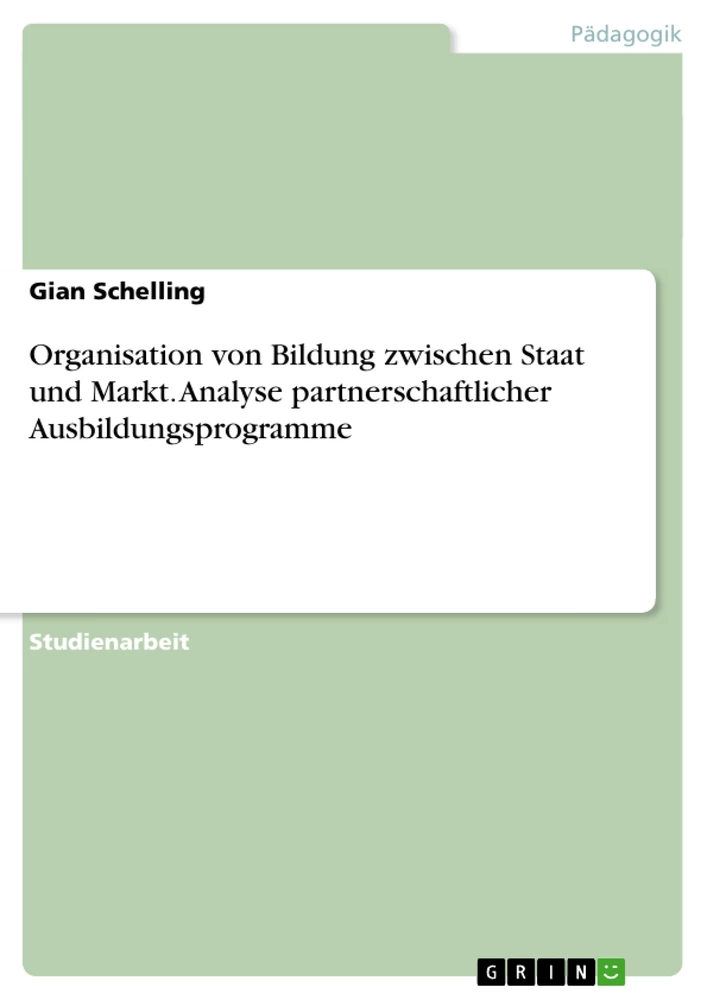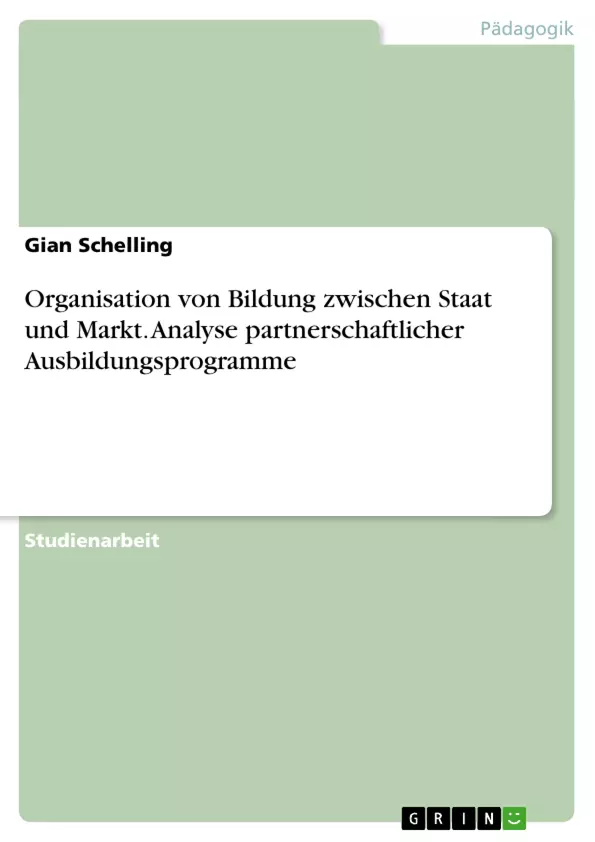Executive Summary
Durch eine Zusammentragung der grössten Probleme staatlicher und privater Fachhochschulen (FHs) bei der Organisation ihrer Ausbildungsprogramme als Vorgabe für die weiteren Untersuchungen stellt sich in der vorliegenden Arbeit heraus, dass vor allem hohe Bewerberzahlen, knappe und oft stark reglementierte finanzielle Mittel, eine eingeschränkte Lehrbefugnis für staatliche und hohe Studiengebühren an privaten FHs zu den grössten Leistungsdefiziten des Status Quo gehören.
Anhand einer Analyse von drei Fallbeispielen wird aufgezeigt, dass partnerschaftliche Organisationsformen zwischen Staat und Markt Lösungsmöglichkeiten für diese Probleme bieten: Aus den Fallstudien ableitend wird empfohlen, Auswahlverfahren durch Partnerunternehmen der Praxis zur Vermeidung der Überfüllung von Hochschulen einzusetzen, stärkere Anreize für die Beteiligung der Privatwirtschaft an der Finanzierung von Ausbildungsprogrammen zu schaffen, Reglementierungen im Personal- und Finanzbereich zu lockern und die Erhebung von Studiengebühren durch eine Zusammenarbeit von Staat und Markt auch langfristig zu vermeiden.
In einer Schlussbetrachtung wird konstatiert, dass die Einräumung neuer Freiheiten notwendig erscheint, die Stärken des Staates aber nicht leichtfertig aufgegeben werden sollten. Letztere werden vor allem im etablierten und transparenten Professorensystem und der Möglichkeit des Staates zur Sicherstellung einer solidarischen Finanzierung von Bildung gesehen.
Offen bleiben muss die Frage nach der idealen institutionellen Wahl partnerschaftlich organisierter FHs. Allerdings wird aus den durch die Fallstudien gewonnenen Erkenntnissen gefolgert, dass sich in Hinblick auf eine möglichst hohe Qualität der Ausbildung weniger die Frage nach der optimalen institutionellen Wahl als jene nach der geeigneten Art und einem sinnvollen Umfang der inhaltlichen Beteiligung geeigneter Partner aus der Privatwirtschaft an Ausbildungsprogrammen stellt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- EINGRENZUNG DER FORSCHUNGSFRAGE UND DARSTELLUNG DER METHODIK
- DIE RAHMENBEDINGUNGEN PARTNERSCHAFTLICHER AUSBILDUNGSPROGRAMME.
- Der rechtliche Rahmen der Organisation von Bildung auf FH-Stufe in Deutschland.
- Konkrete Probleme der staatlichen FHs bei der Organisation ihrer Ausbildungsgänge
- Die Diskussion um private Hochschulen in Bildungspolitik und Verwaltungsreformdebatte
- Konkrete Probleme der privaten FHs bei der Organisation ihrer Ausbildungsgänge.
- DREI PARTNERSCHAFTLICHE PROGRAMME IM VERGLEICH.
- Elektro- und Informationstechnik an der staatlichen FH Ingolstadt.
- Fahrzeugelektronik und Informationssysteme bei BA Ravensburg und Audi AG
- Elektrotechnik an der privaten FH Heidelberg....
- LÖSUNGSANSÄTZE DER DREI VORGESTELLTEN PROGRAMME FÜR KONKRETE PROBLEME IM TRADITIONELLEN SYSTEM
- HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE ORGANISATORISCHE OPTIMIERUNG VON BILDUNG AUF FH-EBENE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Organisation von Bildung auf Fachhochschulebene in Deutschland, insbesondere die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus partnerschaftlichen Ausbildungsprogrammen zwischen staatlichen und privaten Akteuren ergeben. Die Arbeit zielt darauf ab, die Stärken und Schwächen dieser Programme zu analysieren und daraus Handlungsempfehlungen für eine optimierte Organisation von Bildung auf FH-Ebene zu entwickeln.
- Probleme des traditionellen Bildungssystems auf FH-Ebene
- Analyse von partnerschaftlichen Ausbildungsprogrammen
- Stärken und Schwächen dieser Programme
- Handlungsempfehlungen für die Optimierung der Organisation von Bildung auf FH-Ebene
- Die Rolle von staatlichen und privaten Akteuren in der Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Organisation von Bildung auf Fachhochschulebene ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit dar. Sie zeigt die Relevanz des Themas im Kontext der Pisa-Studie und der Diskussion um Hochschulreform auf.
- Eingrenzung der Forschungsfrage und Darstellung der Methodik: Dieses Kapitel grenzt die Forschungsfrage ein und beschreibt die Methodik der Arbeit. Es erklärt den Begriff „partnerschaftlich organisierte Ausbildungsprogramme“ und stellt die Grenzen der Untersuchung dar, die sich auf die Fachhochschulebene in Deutschland und staatlich anerkannte Ausbildungsgänge konzentrieren.
- Die Rahmenbedingungen partnerschaftlicher Ausbildungsprogramme: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und konkreten Probleme der Organisation von Bildung auf FH-Ebene in Deutschland, sowohl für staatliche als auch private Hochschulen. Es analysiert die Diskussion um private Hochschulen und die Rolle der staatlichen Reglementierungen im Bildungswesen.
- Drei partnerschaftliche Programme im Vergleich: Dieses Kapitel stellt drei Fallbeispiele für partnerschaftliche Ausbildungsprogramme vor: Elektro- und Informationstechnik an der staatlichen FH Ingolstadt, Fahrzeugelektronik und Informationssysteme bei BA Ravensburg und Audi AG, sowie Elektrotechnik an der privaten FH Heidelberg.
- Lösungsansätze der drei vorgestellten Programme für konkrete Probleme im traditionellen System: Dieses Kapitel analysiert die Lösungsansätze, die die drei vorgestellten Programme für konkrete Probleme im traditionellen Bildungssystem bieten. Es beleuchtet die spezifischen Stärken und Schwächen jedes Programms und diskutiert deren Implikationen für die Optimierung von Bildung auf FH-Ebene.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Hochschulbildung, insbesondere auf der Fachhochschulebene in Deutschland. Die zentralen Schlüsselwörter sind: Organisation von Bildung, staatliche und private Hochschulen, partnerschaftliche Ausbildungsprogramme, Public Private Partnership (PPP), Qualität von Bildung, Hochschulreform, Reglementierungen, Studiengebühren, Finanzierung von Bildung, Handlungsempfehlungen.
- Quote paper
- Gian Schelling (Author), 2003, Organisation von Bildung zwischen Staat und Markt. Analyse partnerschaftlicher Ausbildungsprogramme, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28002