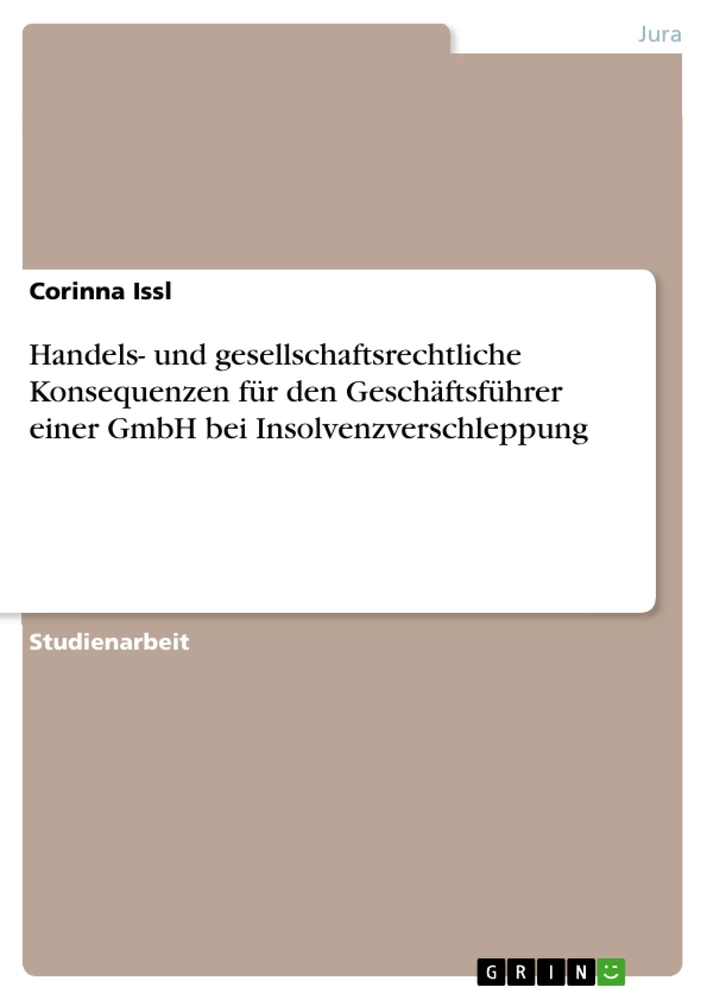Die Rechtsform der GmbH erfreut sich großer Beliebtheit, jedoch ist den Geschäftsführern das Haftungsrisiko in der Krise des Unternehmens und insbesondere bei Insolvenzverschleppung
oftmals nicht bekaunt. Im Mittelpunkt dieser wissenschaftlichen Arbeit steht daher die Darstellung der vielfältigen Konsequenzen und Haftungsrisiken für den Geschäftsführer in der Krise eines Unternehmens und vor allem bei Insolvenzverschleppung.
Außerdem werden in diesem Zusammenhang besondere Merkmale der GmbH und der Insolvenz erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG
- 1. Problemstellung
- 2. Ziele der Arbeit
- B. HAUPTTEIL
- 1. GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
- 1.1. Gründung
- 1.2. Stammkapital
- 1.3. Geschäftsführung
- 1.4. beschränkte Haftung
- 2. Insolvenz
- 2.1. Begriff
- 2.2. Insolvenzgründe
- 2.2.1. Allgemeines
- 2.2.2. Zahlungsunfähigkeit
- 2.2.3. drohende Zahlungsunfähigkeit
- 2.2.4. Überschuldung
- 2.3. Insolvenzantragspflicht
- 2.4. Insolvenzverschleppung
- 3. Konsequenzen für den Geschäftsführer
- 3.1. Haftung gegenüber der Gesellschaft, § 64 GmbHG
- 3.2. Haftung gegenüber Dritten
- 3.2.1 Haftung gem. § 823 II BGB i.V.m. § 15a InsO
- 3.2.2. Haftung gem. § 311 BGB i.V.m. § 280 I BGB
- 3.3. Haftung gem. § 826 BGB
- 3.4. Haftung gem. § 26 III InsO
- 3.5. Konsequenzen bei Insolvenzverschleppung
- 3.5.1. Strafrechtliche Konsequenzen
- 3.4.2. Sonstige Konsequenzen
- C. SCHLUSSTEIL
- Zusammenfassung
- Haftungsrisiken des Geschäftsführers in der Krise der GmbH
- Insolvenzverschleppung und deren Folgen
- Merkmale der GmbH und deren Gründung
- Insolvenzgründe und rechtliche Rahmenbedingungen
- Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft und Dritten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den vielfältigen Haftungsrisiken, denen ein Geschäftsführer einer GmbH in der Krise des Unternehmens und insbesondere bei Insolvenzverschleppung ausgesetzt ist. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Konsequenzen und die damit verbundenen Haftungsrisiken für den Geschäftsführer. Dabei werden besondere Merkmale der GmbH und der Insolvenz erläutert.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung der Arbeit ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der GmbH als Rechtsform und die Herausforderungen, die sich für den Geschäftsführer im Falle einer Krise des Unternehmens ergeben. Die Arbeit stellt die Ziele dar und umreißt die Themenschwerpunkte.
Der Hauptteil untersucht die GmbH als Rechtsform, insbesondere die Gründung, das Stammkapital, die Geschäftsführung und die beschränkte Haftung. Im Anschluss werden die verschiedenen Insolvenzgründe und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Insolvenz erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf den Konsequenzen für den Geschäftsführer bei Insolvenzverschleppung, die sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen können.
Schlüsselwörter
GmbH, Insolvenz, Insolvenzverschleppung, Haftung, Geschäftsführer, Gesellschafter, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Rechtsform, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Insolvenzantragspflicht, Strafrecht, Zivilrecht, Sanierung, Krise.
- Arbeit zitieren
- Corinna Issl (Autor:in), 2013, Handels- und gesellschaftsrechtliche Konsequenzen für den Geschäftsführer einer GmbH bei Insolvenzverschleppung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/279810