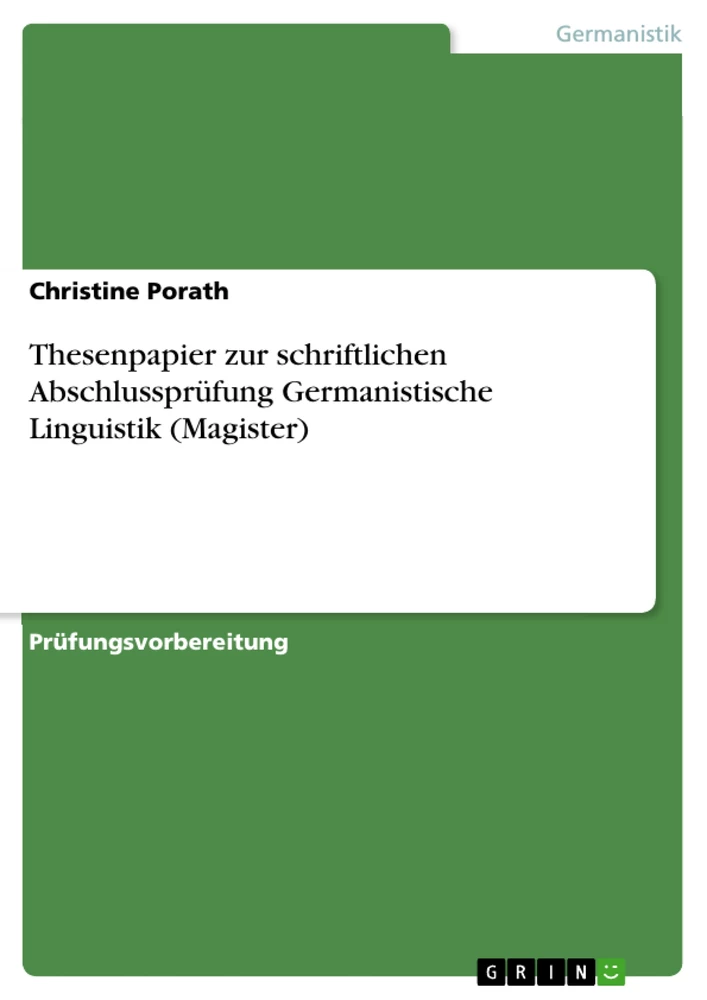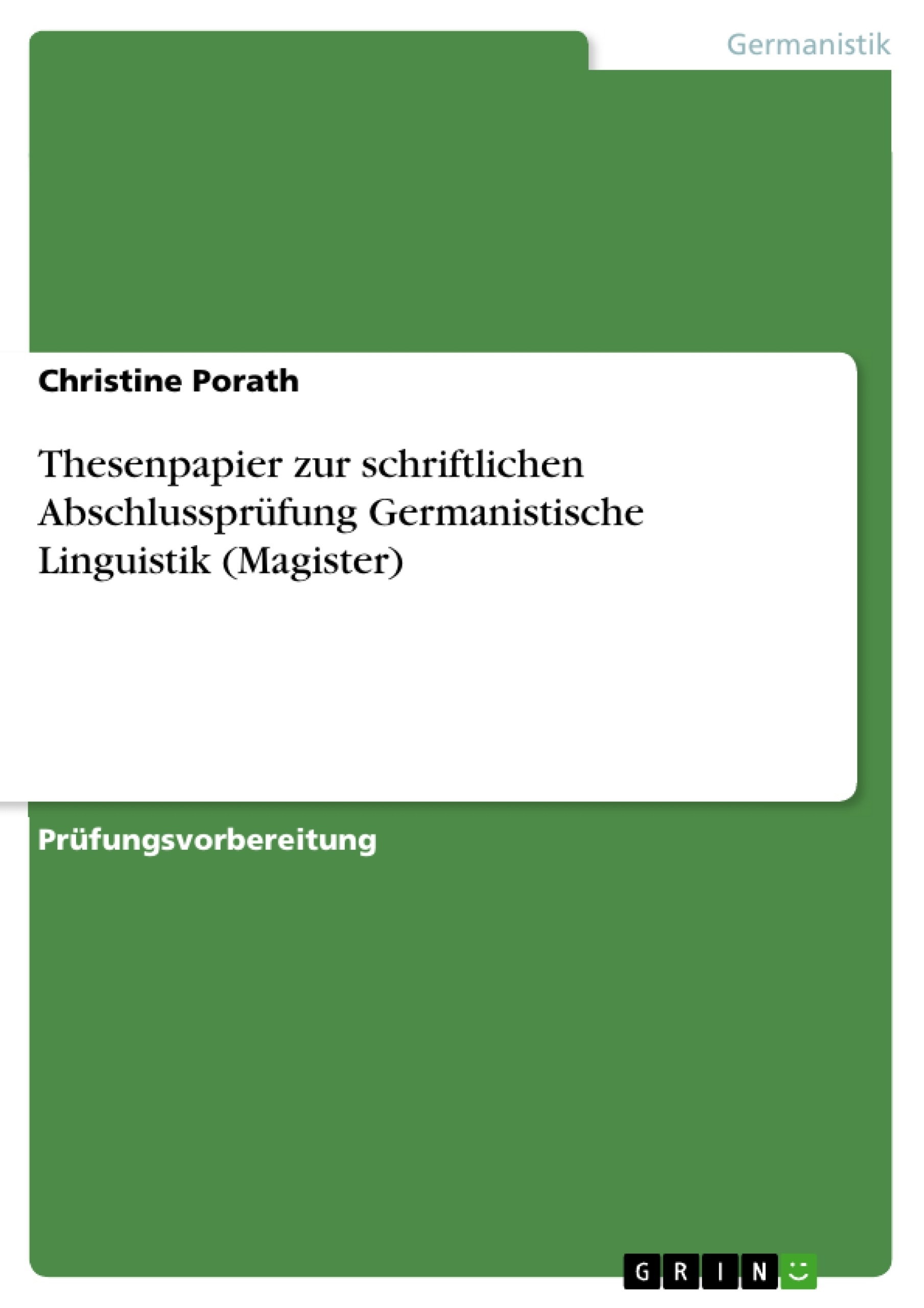Prüfungsthesen zu den Themen:
1) Grammatikalisierung der Pluralmarker im Deutschen.
2) Adverbiale Spaltungskonstruktionen.
3) Topikalisierung im Deutschen.
Inklusive Literaturverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis
- Thema I: Grammatikalisierung der Pluralmarker im Deutschen
- These 1
- These 2
- These 3
- These 4
- These 5
- These 6
- Thema II: Adverbiale Spaltungskonstruktionen
- These 1
- These 2
- These 3
- These 4
- These 5
- Thema III: Topikalisierung im Deutschen
- These 1
- These 2
- These 3
- These 4
- These 5
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erforschung ausgewählter grammatischer Phänomene im Deutschen. Sie untersucht die Grammatikalisierung von Pluralmarkern, die adverbiale Spaltungskonstruktion und die Topikalisierung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung und die Funktionsweise dieser grammatischen Prozesse zu analysieren und dabei die unterschiedlichen theoretischen Ansätze und Perspektiven zu beleuchten.
- Grammatikalisierungsprozesse im Deutschen
- Diachronische Entwicklung grammatischer Strukturen
- Syntaktische und semantische Veränderungen
- Informationsstruktur und Wortstellung
- Pragmatische Funktionen von Satzgliedstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Thema I: Grammatikalisierung der Pluralmarker im Deutschen
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Pluralmarker im Deutschen unter dem Aspekt der Grammatikalisierung. Es stellt die These auf, dass die Pluralmarker nicht als Ergebnis eines klassischen Grammatikalisierungsprozesses betrachtet werden können, sondern eher als ein Fall von Degrammatikalisierung oder semantischer Verstärkung. Die Analyse verfolgt die Entwicklung der Pluralmarker von ihren Ursprüngen im Germanischen und Indo-Europäischen bis hin zu ihrer gegenwärtigen Form im Deutschen.
Thema II: Adverbiale Spaltungskonstruktionen
Dieses Kapitel befasst sich mit der adverbialen Spaltungskonstruktion im Deutschen. Es untersucht die verschiedenen Arten der Spaltung und die areale Verteilung dieser Konstruktion. Außerdem analysiert es die Abhängigkeit der Spaltung vom Anlaut der Präposition und diskutiert die unterschiedlichen theoretischen Ansätze zur Beschreibung dieser Konstruktion. Die Analyse beleuchtet die diachrone Entwicklung der Präpositionaladverbien und argumentiert für eine getrennte Entwicklung im Niederdeutschen und im Hochdeutschen.
Thema III: Topikalisierung im Deutschen
Dieses Kapitel untersucht die Topikalisierung im Deutschen. Es stellt fest, dass nicht jede Linksverschiebung im Satz als Topikalisierung betrachtet werden kann und diskutiert die verschiedenen Arten der Informationsstrukturierung, die für die Bestimmung von Topikalisierung relevant sind. Das Kapitel analysiert die pragmatischen Funktionen der Topikalisierung und untersucht die syntaktischen und pragmatischen Bedingungen, die für die Topikalisierung von Satzgliedern erfüllt sein müssen. Es argumentiert, dass die Funktion der Topikalisierung im Deutschen nicht in einer einheitlichen Theorie erfasst werden kann, da es verschiedene funktionale Typen von Topikalisierung gibt.
Schlüsselwörter
Pluralmarker, Grammatikalisierung, Degrammatikalisierung, Spaltungskonstruktion, Präpositionaladverb, Topikalisierung, Informationsstruktur, Wortstellung, Pragmatik, Syntax, Diachronie.
- Quote paper
- M. A. Christine Porath (Author), 2010, Thesenpapier zur schriftlichen Abschlussprüfung Germanistische Linguistik (Magister), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/279504