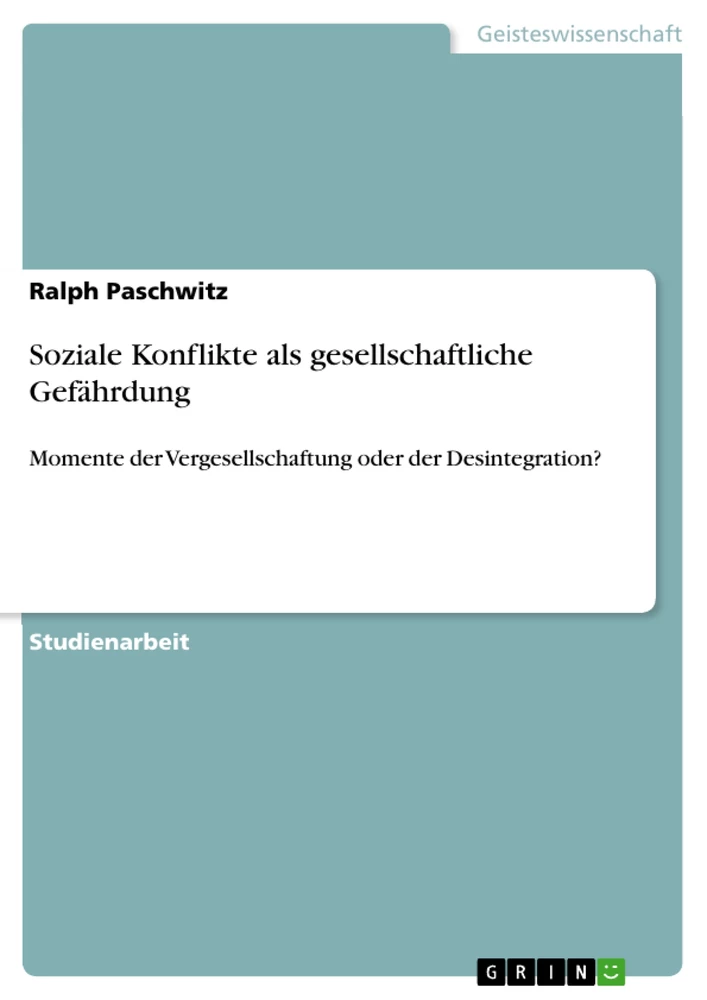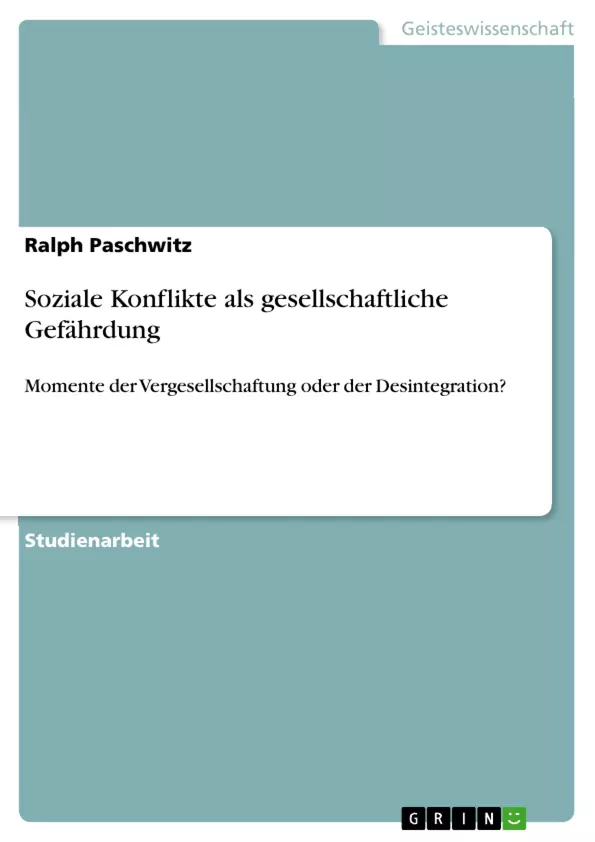Stellt der soziale Konflikt ein pathologisches Phänomen dar, bei dessen übermäßiger Existenz soziale Ordnung zerfällt bzw. nicht entstehen kann und ist Konsens das konstitutive Merkmal oder liegt im sozialen Konflikt an sich eine den gesellschaftlichen Wandel und Gesellschaft als Ganzes konstituierende Wirkung?
Um meinem Anliegen gerecht zu werden, die Forschungsfrage möglichst objektiv zu beantworten, und um mir nicht die Möglichkeit zu nehmen, auch dem mikrosoziologischen Rahmen, der dieser Ausarbeitung zugrunde liegt, entsprechen zu können, wird Heitmeyers Desintegrationstheorie aus dem Grund Dahrendorfs und Simmels Konflikttheorie gegenübergestellt, weil sie ihr Augenmerk (unter anderem) auf das Individuum legt.
Die systemfunktionalistische Theorie Parsons, welche auf Konsens aufbaut, soll hierbei nur am Rande, aber gleichsam – trotz der geringen Rezeption in meiner Arbeit – als Gegenposition Erwähnung finden und über die Kritik an dieser in die Dahrendorfsche Theorie einleiten.
Einer definitorischen Einordnung und Begriffsbestimmung des sozialen Konflikts innerhalb meiner Verschriftlichung soll im Hauptteil die beschriebene theoretische Auseinandersetzung folgen und sich dieser ein Fazit anschließen, welches die Forschungsfrage nach Vergesellschaftungs- oder Desintegrationsmoment sozialer Konflikte ausreichend zu beantworten gedenkt.
Anhand der Beschreibung des Konflikts um die „Dresdner Waldschlösschenbrücke“ sollen die Schlussfolgerungen meiner Seminararbeit verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der soziale Konflikt
- 2.1 Das Beispiel „Waldschlösschenbrücke“
- 3. Theoretische Positionen "Pro-Konflikt"
- 3.1 Sozialer Konflikt als Motor sozialen Wandels
- 3.2 Sozialer Konflikt als Vergesellschaftung
- 3.3 Thematische Rezeptionen
- 4. Dissens als Herausforderung sozialer Ordnung
- 4.1 Sozialer Konflikt als Desintegrationsmoment
- 5. Konfliktregelung
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen sozialer Konflikte auf die Gesellschaft. Sie befasst sich mit der Frage, ob soziale Konflikte eher als Desintegrations- oder Vergesellschaftungsmomente zu betrachten sind. Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Positionen und illustriert ihre Erkenntnisse anhand eines konkreten Beispiels.
- Definition und Typologisierung sozialer Konflikte
- Theoretische Perspektiven auf soziale Konflikte (Pro- und Contra-Konflikt)
- Soziale Konflikte als Motor des sozialen Wandels
- Konfliktlösung und Konfliktmanagement
- Das Beispiel der Waldschlösschenbrücke als Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert zwei gegensätzliche Zitate, die die zentrale Forschungsfrage der Arbeit vorwegnehmen: Sind soziale Konflikte destruktiv oder tragen sie zum gesellschaftlichen Fortschritt bei? Die Arbeit beabsichtigt, diese Frage zu untersuchen, indem sie verschiedene theoretische Perspektiven gegenüberstellt und ein konkretes Beispiel analysiert. Sie vergleicht insbesondere die Positionen von Parsons (der Konsens betont) mit denen von Dahrendorf und Simmel (die den Konflikt als Motor des Wandels sehen). Die Arbeit kündigt an, Heitmeyers Desintegrationstheorie als Gegenposition zu den letztgenannten Theorien zu verwenden, um einen ausgewogeneren Blick auf das Thema zu ermöglichen. Die Methodik der Arbeit wird kurz skizziert, wobei die Waldschlösschenbrücke als Fallbeispiel genannt wird.
2. Der soziale Konflikt: Dieses Kapitel beginnt mit der Feststellung, dass soziale Konflikte allgegenwärtig sind und einen wichtigen Bestandteil der Sozialisation darstellen. Es wird betont, dass der Umgang mit Konflikten oft so automatisiert ist, dass die Bedeutung der Konflikte selbst vernachlässigt wird. Anschließend wird der Begriff „sozialer Konflikt“ eingegrenzt, wobei verschiedene Konflikttypologien (z.B. Interessen- und Wertkonflikte) erwähnt werden. Der Begriff „Konfliktlösung“ wird kritisch hinterfragt, da Konflikte auch nach ihrer vermeintlichen Lösung noch nachhaltige Auswirkungen haben können.
Schlüsselwörter
Sozialer Konflikt, Vergesellschaftung, Desintegration, Konfliktlösung, Konfliktmanagement, gesellschaftlicher Wandel, Theoretische Perspektiven (Parsons, Dahrendorf, Simmel, Heitmeyer), Waldschlösschenbrücke.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Soziale Konflikte: Desintegration oder Vergesellschaftung?"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Auswirkungen sozialer Konflikte auf die Gesellschaft. Der zentrale Forschungsfrage ist, ob soziale Konflikte eher als Desintegrations- oder Vergesellschaftungsmomente zu betrachten sind. Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Positionen und illustriert diese anhand eines konkreten Beispiels, der Waldschlösschenbrücke.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Typologisierung sozialer Konflikte, theoretische Perspektiven auf soziale Konflikte (Pro- und Contra-Konflikt), soziale Konflikte als Motor des sozialen Wandels, Konfliktlösung und Konfliktmanagement, sowie die Waldschlösschenbrücke als Fallstudie. Es werden verschiedene theoretische Positionen von u.a. Parsons, Dahrendorf, Simmel und Heitmeyer betrachtet.
Welche theoretischen Positionen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht gegensätzliche Perspektiven auf soziale Konflikte. Zum einen wird die Position von Parsons betrachtet, der den Konsens betont, und zum anderen die Positionen von Dahrendorf und Simmel, die den Konflikt als Motor des Wandels sehen. Heitmeyers Desintegrationstheorie dient als Gegenposition zu den letztgenannten Theorien, um einen ausgewogeneren Blick zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt die Waldschlösschenbrücke in der Arbeit?
Die Waldschlösschenbrücke dient als konkretes Beispiel zur Illustration der theoretischen Überlegungen. Sie wird als Fallstudie verwendet, um die Auswirkungen eines sozialen Konflikts auf die Gesellschaft zu analysieren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Der soziale Konflikt, Theoretische Positionen "Pro-Konflikt", Dissens als Herausforderung sozialer Ordnung, Konfliktregelung und Schluss. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor und skizziert die Methodik. Die Kapitel 2 bis 5 vertiefen die einzelnen Themen und das Schluss-Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sozialer Konflikt, Vergesellschaftung, Desintegration, Konfliktlösung, Konfliktmanagement, gesellschaftlicher Wandel, Theoretische Perspektiven (Parsons, Dahrendorf, Simmel, Heitmeyer), Waldschlösschenbrücke.
Wie werden soziale Konflikte in der Arbeit definiert?
Die Arbeit grenzt den Begriff "sozialer Konflikt" ein und erwähnt verschiedene Konflikttypologien, z.B. Interessen- und Wertkonflikte. Der Umgang mit Konflikten wird kritisch betrachtet, da auch nach vermeintlicher Lösung nachhaltige Auswirkungen bestehen können.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob soziale Konflikte eher destruktiv sind oder zum gesellschaftlichen Fortschritt beitragen. Die genaue Schlussfolgerung lässt sich aus dem gegebenen Auszug nicht vollständig ableiten, aber die Gegenüberstellung verschiedener theoretischer Positionen deutet auf eine differenzierte Betrachtungsweise hin.
- Quote paper
- Diplom Soziologe Ralph Paschwitz (Author), 2007, Soziale Konflikte als gesellschaftliche Gefährdung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/277430