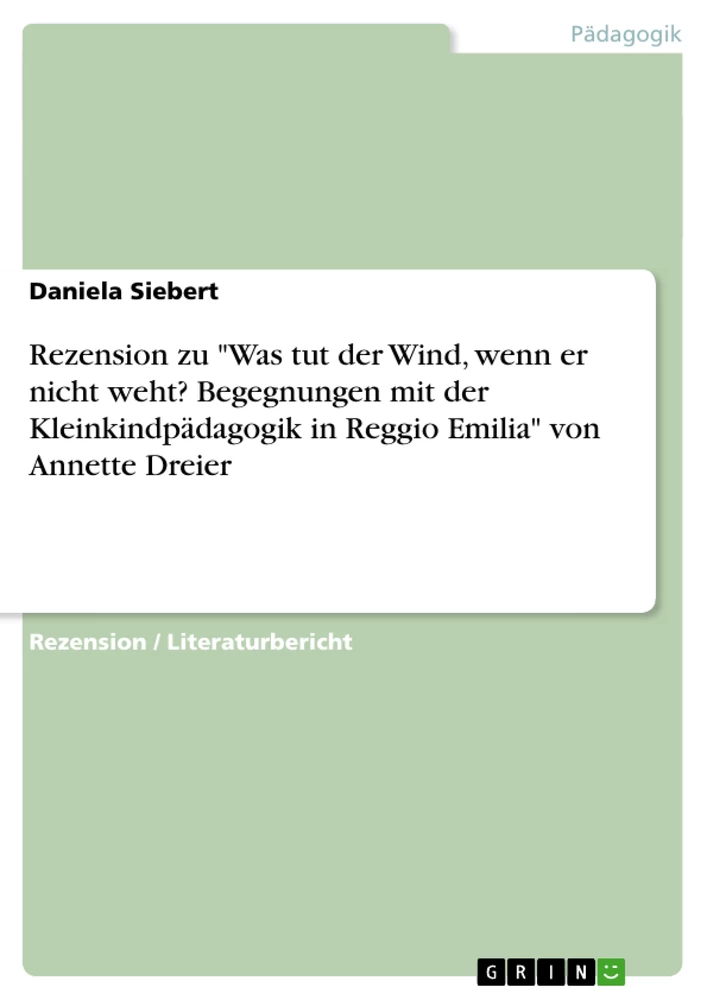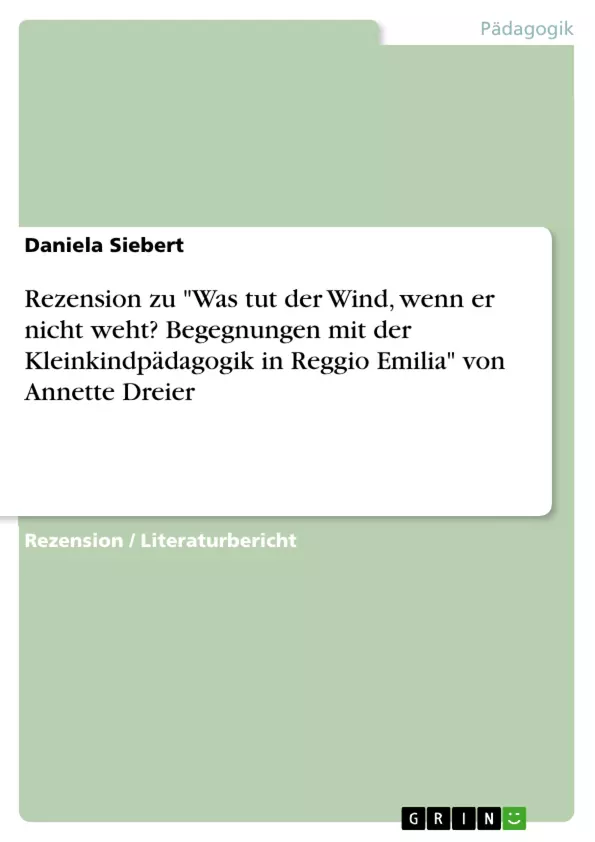Das Buch „Was tut der Wind, wenn er nicht weht? Begegnungen mit der Kleinkindpädagogik in Reggio Emilia“ von Annette Dreier erschien erstmals 1993. Im Jahr 2012 kam das Buch in der 7. Auflage auf den Markt. Es wurde in der Vergangenheit mehrfach überarbeitet. Die Autorin ist Professorin an der FH in Potsdam, wo sie Pädagogik im Kindesalter lehrt. Durch viele Besuche der Stadt Reggio in Italien und dem regen Austausch mit den Pädagogen vor Ort ist ihr die Reggio-Pädagogik sehr gut bekannt. Des Weiteren leitet sie Fortbildungen für Erzieherinnen und Eltern zu Themen der frühen Kindheit.
Ein zentrales Thema der Reggio-Pädagogik ist die Überzeugung, dass Kinder selbst lernende Individuen sind. Sie treten in den Austausch mit anderen Kindern und Erwachsenen und eignen sich somit ihre Umwelt an. Zahlreiche erziehungs- und bildungswissenschaftliche Erkenntnisse verdeutlichen dies.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einladung an die Leser
- Reggio Emilia: Die Stadt, die Region und die vorschulische Erziehung
- Die Entwicklung der Stadt seit 1945: Eine politische Standortbestimmung
- Die Emilia Romagna
- Vorschulische Erziehung in Reggio Emilia
- Besuche in der Krippe Arcobaleno: Eindrücke aus der Praxis
- Die Struktur der Krippe
- Die Räume
- Die Kinder
- Die Erzieherinnen
- Die Eltern
- Die Konzeption der Reggio-Pädagogik: Grundsätze für Krippen und Kindergärten
- Erziehung als gemeinschaftliche Aufgabe und die gestione sociale
- Die 100 Sprachen der Kinder: Die pädagogische Arbeit in Reggio Emilia
- Die Rolle der Erwachsenen: Die pädagogischen Beraterinnen
- Die Dokumentation der Arbeit mit Kindern
- Die Bedeutung der Projekte
- Die 100 Sprachen der Kinder: Die pädagogische Arbeit in Reggio Emilia
- Die pädagogische Arbeit in Reggio Emilia
- Die Rolle der Erwachsenen: Die pädagogischen Beraterinnen
- Die Dokumentation der Arbeit mit Kindern
- Die Bedeutung der Projekte
- Die Rolle der Erwachsenen: Die pädagogischen Beraterinnen
- Die Dokumentation der Arbeit mit Kindern
- Die Bedeutung der Projekte
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit von Daniela Siebert befasst sich mit der Reggio-Pädagogik, einem pädagogischen Ansatz, der in der italienischen Stadt Reggio Emilia entstanden ist. Die Arbeit analysiert die Geschichte, die Konzeption und die Praxis der Reggio-Pädagogik und stellt sie in den Kontext der frühkindlichen Bildung in Deutschland.
- Die Entstehung und Entwicklung der Reggio-Pädagogik
- Die zentralen Prinzipien und Konzepte der Reggio-Pädagogik
- Die Rolle der Kinder, der Erzieherinnen und der Eltern in der Reggio-Pädagogik
- Der Vergleich der Reggio-Pädagogik mit deutschen Bildungskonzepten
- Die Bedeutung der Reggio-Pädagogik für die frühkindliche Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Reggio-Pädagogik vor und erläutert die Relevanz des Themas. Die Autorin beschreibt die Entstehung des ersten Kindergartens in Reggio Emilia und die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Entwicklung der Reggio-Pädagogik führten. Sie betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieherinnen und Kommunalpolitikern.
Im zweiten Kapitel beschreibt die Autorin ihre Eindrücke aus der Krippe „Arcobaleno“ in Reggio Emilia. Sie schildert die Struktur der Krippe, die Gestaltung der Räume und die pädagogische Arbeit. Sie hebt die Bedeutung des Raumes als „dritter Erzieher“ hervor und beschreibt die Rolle der Erzieherinnen und die enge Zusammenarbeit mit den Eltern.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Grundsätzen der Reggio-Pädagogik. Die Autorin erläutert die Konzeption der Reggio-Pädagogik als „Pädagogik des Werdens“ und die Bedeutung der „100 Sprachen der Kinder“. Sie beschreibt die Rolle der pädagogischen Beraterinnen und die Bedeutung der Dokumentation der Arbeit mit Kindern.
Das vierte Kapitel widmet sich der pädagogischen Arbeit in Reggio Emilia. Die Autorin beschreibt die Rolle der Erwachsenen, die Bedeutung der Projekte und die Dokumentation der Arbeit mit Kindern. Sie erläutert die Prinzipien der Reggio-Pädagogik und ihre Bedeutung für die frühkindliche Bildung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Reggio-Pädagogik, die frühkindliche Bildung, die 100 Sprachen der Kinder, den Raum als dritter Erzieher, die Rolle der Erzieherinnen, die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Dokumentation der Arbeit mit Kindern und die Bedeutung der Projekte. Die Arbeit analysiert die Reggio-Pädagogik im Kontext der frühkindlichen Bildung in Deutschland und stellt die Frage nach der Übertragbarkeit des Modells auf andere Kulturen.
- Arbeit zitieren
- Daniela Siebert (Autor:in), 2012, Rezension zu "Was tut der Wind, wenn er nicht weht? Begegnungen mit der Kleinkindpädagogik in Reggio Emilia" von Annette Dreier, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/276671