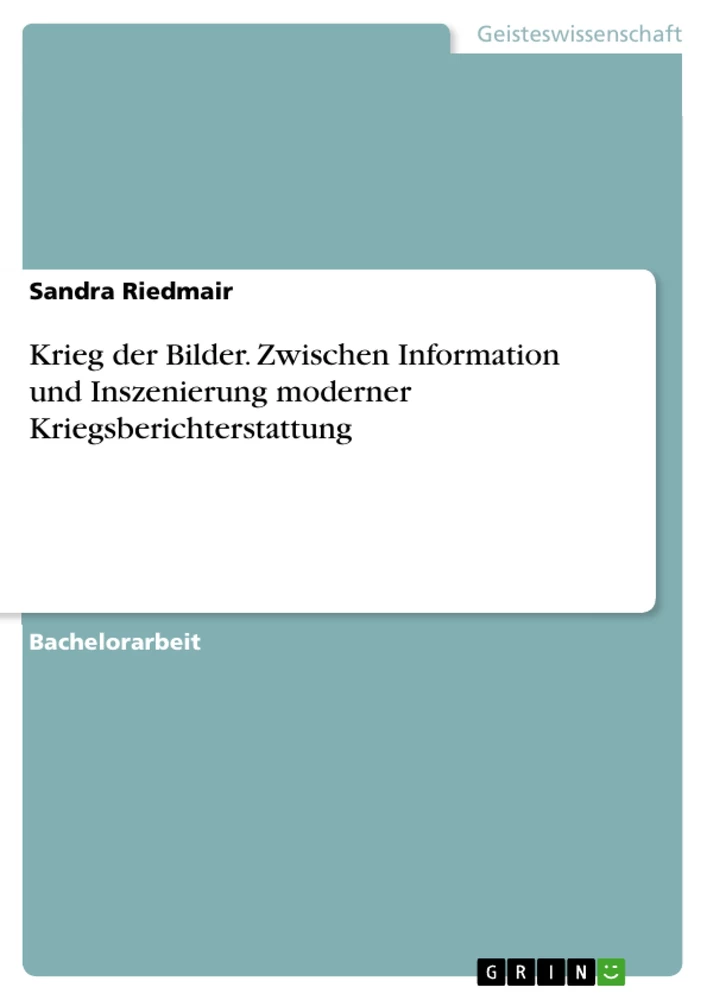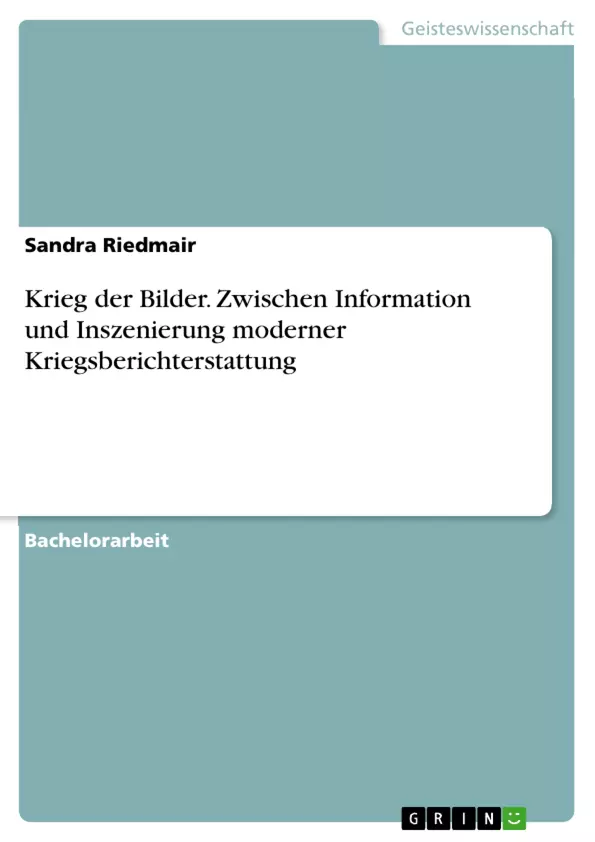Die Darstellung von Kriegen ist seit jeher ein bevorzugter Gegenstand der Medien. Die meisten Menschen wissen das, was sie über Kriege wissen, in der heutigen Zeit, über die Massenmedien. Sie liefern Neuigkeiten über die Orte des Geschehens, über Waffentechnik, Anschläge und Opferzahlen. In Zeitungen überwiegend in Schriftform, im Fernsehen hauptsächlich durch Bilder. Die „Bürger des globalen Dorfes“ (Mc Luhan 1989) nehmen so Kriege wahr und bilden sich ein Urteil darüber. Wer ist der Feind? Wer hat recht und wer unrecht? Die Einflussnahme der Medien auf dieses Urteil ist da-bei unumstritten. Denn ein Krieg, über den nicht berichtet wird, findet in der öffentlichen Wahrnehmung nicht statt. Blicken wir auf die aktuelle Kriegsberichterstattung aus Syrien, Mali oder den Anschlag in Boston fallen uns in erster Linie Bilder auf. Bilder von verletzten Menschen, Soldaten und zerstörten Häusern. Wir sehen Videos von Bombenanschlägen, Menschen, die um ihr Leben rennen und Demonstrationen. Manchmal ganz ohne genaue Erklärung oder Angaben zur Herkunft der Bilder. Doch was wäre der Krieg ohne sie? Auch der Zuschauer hat Erwartungen an die Berichterstattung. Das Bild als scheinbar authentisches Medium ist seitdem es Fotografie gibt fest an diese Erwartungen geknüpft. Jedoch ist es auch seit jeher Gang und Gebe, dass Bilder manipuliert werden. Die Frage nach Authentizität taucht deshalb immer wieder in der Diskussion über Sinn und Unsinn der Kriegsberichterstattung auf. Besonders den Massenmedien, in erster Linie Print und Rundfunk wird angesichts ihrer Allgegenwärtigkeit und Einflussnahme in der heutigen Forschung viel Aufmerksamkeit geschenkt. Sie sind einerseits unsere primäre Informationsquelle, andererseits bieten sie Unterhaltung und Zeitvertreib. Die Trennlinie ist dabei oftmals nicht eindeutig. Deshalb ist es nötig, die Medien kritisch zu betrachten, ihre gesellschaftliche Funktion, ihre Auswirkungen und Einflussnahme und im Besonderen die Darstellung der Realität zu untersuchen. Was bieten uns Medien? Fakt oder Fiktion? Der Zweifel an der Wahrheitsdarstellung ist in den letzten Jahren gewachsen. Und besonders Kriege und Konflikte geraten aufgrund ihrer Komplexität und den unterschiedlichen Interessen, die dabei gewaltsam aufeinander treffen in den Mittelpunkt medialer Verzerrung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Zielsetzung
- Zur Bedeutung von Bildern
- Abbild und Perspektive
- 'pictorial turn'
- Leidensbilder
- Geschichte der visuellen Kriegsberichterstattung
- Kriegsberichterstattung im industrialisierten Krieg
- Die Pluralisierung der Bilder mit dem Vietnamkrieg
- Die „neuen“ Kriege im Zeichen der Digitalisierung
- Formen der Bildmanipulation
- Stilmittel und Gestaltung
- inhaltliche Gestaltungselemente
- optische Gestaltungselemente
- Perspektive
- Nachbearbeitung und Platzierung
- Stilmittel und Gestaltung
- Ikone als Kriegsrepräsentant am Beispiel des Napalm-Girls
- Produktionskontext
- Die Momentaufnahme als historisches Referenzbild
- Bildauswahl und -bearbeitung
- Formal-ästhetische Analyse
- Die Veröffentlichung
- Die personale Überführung Kim Phucs in den Mythos
- Embedded journalism, militainment, infotainment – „Hybridisierungstendenzen“ in der Kriegsberichterstattung
- embedded journalism
- Formale und ästhetische Hybridisierungstendenzen
- Bildgestaltung und Dramaturgie des Krieges
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die Rolle von Bildern in der modernen Kriegsberichterstattung und untersucht, inwieweit sie objektiv informieren oder die Realität manipulieren und verzerrt wiedergeben. Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte der visuellen Kriegsberichterstattung, den Formen der Bildmanipulation und den Auswirkungen von Bildern auf die öffentliche Wahrnehmung von Kriegen.
- Die Bedeutung von Bildern in der Kriegsberichterstattung
- Die Geschichte der visuellen Kriegsberichterstattung
- Formen der Bildmanipulation
- Die Rolle von Ikonen in der Kriegsberichterstattung
- „Hybridisierungstendenzen“ in der Kriegsberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Bildern in unserer Wahrnehmung und diskutiert verschiedene Definitionsansätze. Es wird die Frage nach der Anziehungskraft von Leidensbildern aufgeworfen.
Das zweite Kapitel zeichnet die Geschichte der medialen Kriegsberichterstattung nach, wobei der Schwerpunkt auf der unterschiedlichen bildlichen Darstellung von Kriegen in der jeweiligen Zeit liegt. Es wird gezeigt, wie Manipulation, Propaganda und Realitätsverzerrung in der Geschichte der Kriegsberichterstattung immer wieder eingesetzt wurden.
Das dritte Kapitel diskutiert die Manipulationsmöglichkeiten in den Bildmedien und stellt verschiedene Stilmittel und Gestaltungselemente vor. Es wird gezeigt, wie Bilder eingesetzt werden, um bestimmte Emotionen und Reaktionen beim Betrachter hervorzurufen.
Das vierte Kapitel analysiert das Napalm-Girl als Ikone der visuellen Kriegsberichterstattung und untersucht die Wirkkraft besonders starker Bilder. Es wird gezeigt, wie die mediale Verzerrung und Inszenierung der Realität durch die Auswahl und Bearbeitung von Bildern beeinflusst werden kann.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Bildern in der medialen Präsentation und zeigt, wie Bilder bewusst Teil einer Gesamtinszenierung werden. Es werden neue Formen der Kriegsberichterstattung, wie das embedded journalism und dramaturgisch-ästhetisch konstruierte Sendeformate, vorgestellt und die „Hybridisierungstendenzen“ in der Kriegsberichterstattung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kriegsberichterstattung, Bilder, Bildmanipulation, visuelle Kommunikation, Ikonen, embedded journalism, militainment, infotainment, Hybridisierungstendenzen, Propaganda, Realitätsverzerrung, Medienkritik, Geschichte der Kriegsberichterstattung, Vietnamkrieg, Napalm-Girl.
- Quote paper
- Sandra Riedmair (Author), 2013, Krieg der Bilder. Zwischen Information und Inszenierung moderner Kriegsberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/276554