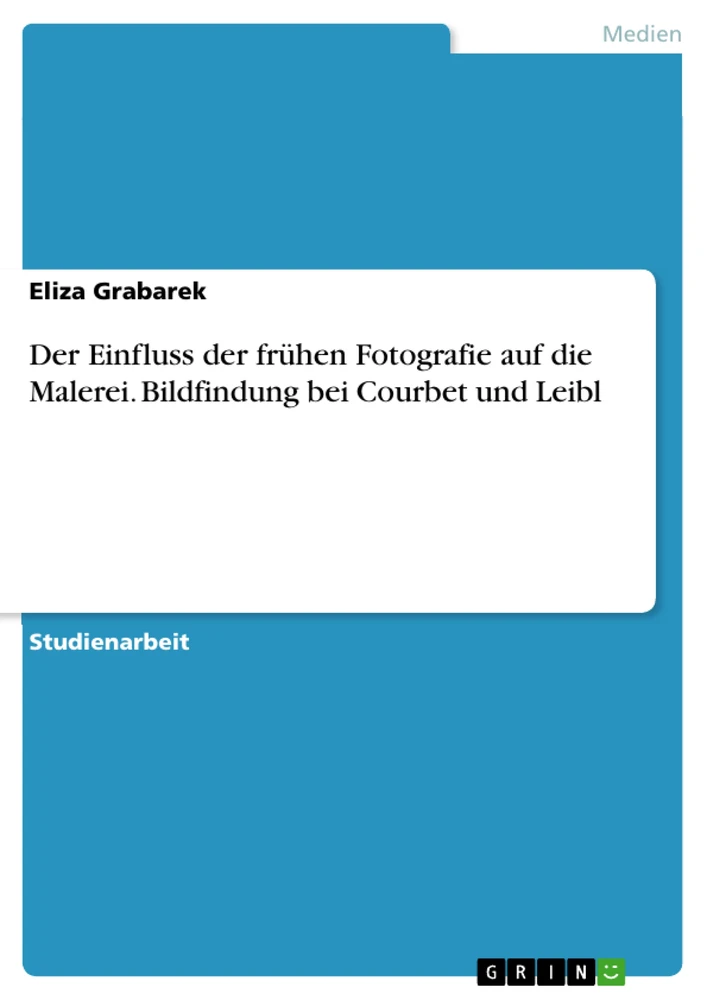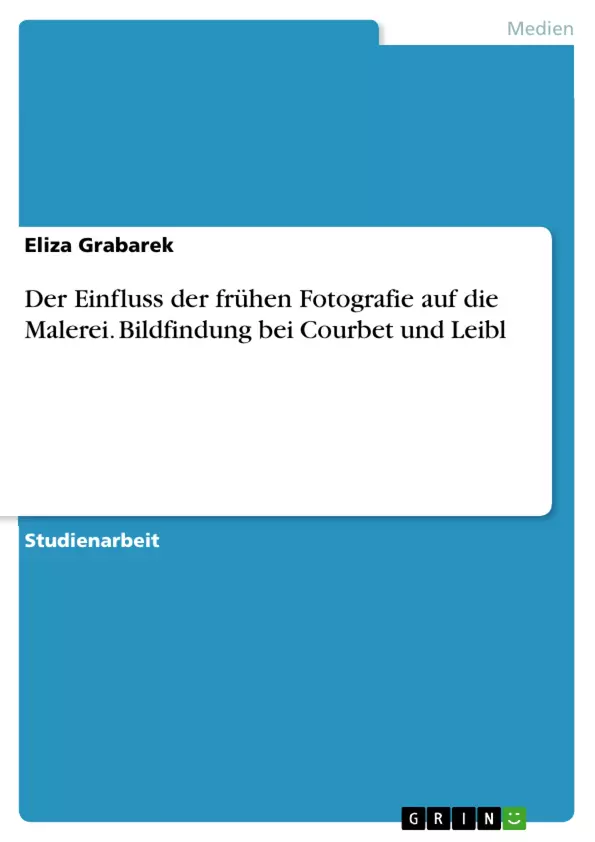Die Bekanntgabe der Erfindung des ersten praktikablen fotografischen Verfahrens, der Daguerreotypie, in Paris 1839 sollte nicht ohne Folgen für die künstlerische Wahrnehmung und Praxis des 19. Jahrhunderts bleiben.
Die Erfindung der Fotografie stieß auf einen für sie vorteilhaften Zeitgeist. So erschien im selben Jahr die erste Veröffentlichung von Auguste Comptes “Philosophie positive”, die den Wissenschaftsbegriff des 19. Jahrhunderts als “Herleitung der Gesetze aus der Beschreibung des Gegebenen” und sinnlich Erfahrbaren definieren sollte. Wichtigster Gegenstand der positivistischen Philosophie war neben der Soziologie die exakte Erforschung der Natur, die jegliche theologischen und metaphysischen Erklärungsmuster ersetzen sollte.
Schnell in den Dienst der Wissenschaften, wie der Medizin, Ethnologie und Geologie gestellt, machte die Fotografie bislang Unsichtbares sichtbar, veränderte und schärfte zugleich so die Wahrnehmung der zeitgenössischen Wirklichkeit. Die von den Wissenschaften angestrebte Objektivität sollte auch für den Künstler zum Paradigma avancieren, weshalb diese die Fotografie mit ihrer vermeintlichen Exaktheit der Realitätsdarstellung zunächst als Bedrohung für den eigenen Berufsstand empfanden. So sahen sich die Künstler letztlich zur Neudefinierung ihrer künstlerischen Ausdrucksformen gezwungen und bemächtigten sich letztlich des neuen Mediums als künstlerisches Hilfsmittel.
Die Maler fanden in der Fotografie die Möglichkeit, sich in kürzester Zeit eine Sammlung an Naturstudien anlegen zu können, die, in traditioneller Manier geschaffen, mit hohem zeitlichen
Aufwand, als auch Modellkosten verbunden, dabei aber mit geringerer Vollkommenheit zu erreichen gewesen wären. Die Fotografie erleichterte damit erheblich den Arbeitsprozeß des
Künstlers, zumal die Herstellung von Naturstudien ausschließlich professionellen Fotografen vorbehalten war. Diese wiederum sahen neben der Portraitfotografie, das Anfertigen von Vorlagenstudien zunächst als ihre wichtigste Aufgabe an, in der sie die Möglichkeit zur Aufwertung ihres Handwerks als Kunst sahen. Ab 1850 ist folglich eine blühende Bilderindustrie mit fotografischen Vorlagenstudien zu verzeichnen, die, über Buch-, Graphik und
Kunsthandel vertrieben, als Musterblätter letztlich auch Eingang in die Kunstakademien, sowie in die Künstlerateliers fanden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Courbet und die Fotografie
- Körperbilder
- Die Aktfigur in “Das Atelier des Malers (Allégorie réelle)” (1855)
- Zur Relation zwischen Gemälde und fotografischer Aktstudie
- “Die Frau mit Papagei” (1866)
- Zur Relation zwischen Gemälde und fotografischer Aktstudie
- Die Aktfigur in “Das Atelier des Malers (Allégorie réelle)” (1855)
- Landschaftsbilder
- “Schloss von Chillon” (1874)
- Zur Relation zwischen Gemälde und Fotografie
- “Schloss von Chillon” (1874)
- Körperbilder
- Wilhelm Leibl und Fotografie
- “Obstgarten von Kutterling” (1888)
- Gemälde und fotografische Studie im Vergleich
- “In der Bauernstube” (1890)
- Gemälde und fotografische Studie im Vergleich
- “Obstgarten von Kutterling” (1888)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Fotografie als Mittel der Bildfindung bei den Realisten Gustave Courbet und Wilhelm Leibl. Dabei wird analysiert, inwiefern die Fotografie die künstlerische Praxis und die Konzeption des Realismus beeinflusst hat.
- Die Rezeption der Fotografie in der Kunst des 19. Jahrhunderts
- Der Einfluss fotografischer Vorlagen auf Courbets und Leibls Malerei
- Die Verwendung der Fotografie als Werkzeug zur Erfassung von Realität und Details
- Die Beziehung zwischen Fotografie und Malerei im Kontext des Realismus
- Die Frage, ob die Fotografie die Autonomie des Künstlers bedroht oder unterstützt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Fotografie für die Kunst des 19. Jahrhunderts dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. In Kapitel 2 wird Courbets Umgang mit der Fotografie untersucht. Dabei werden verschiedene Werke analysiert, die auf fotografischen Vorlagen basieren, insbesondere Akt- und Landschaftsbilder. Kapitel 3 widmet sich Wilhelm Leibls Beschäftigung mit der Fotografie und setzt seine Werke mit den entsprechenden fotografischen Studien in Beziehung. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zeigt die Bedeutung der Fotografie für die Entwicklung des Realismus auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Fotografie als Mittel der Bildfindung im 19. Jahrhundert, insbesondere im Kontext des Realismus. Schlüsselbegriffe sind Fotografie als künstlerisches Hilfsmittel, Realismus, Aktfotografie, Landschaftsfotografie, Courbet, Leibl, „Das Atelier des Malers“, „Die Frau mit Papagei“, „Schloss von Chillon“, „Obstgarten von Kutterling“, „In der Bauernstube“.
- Quote paper
- Eliza Grabarek (Author), 2007, Der Einfluss der frühen Fotografie auf die Malerei. Bildfindung bei Courbet und Leibl, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/276295