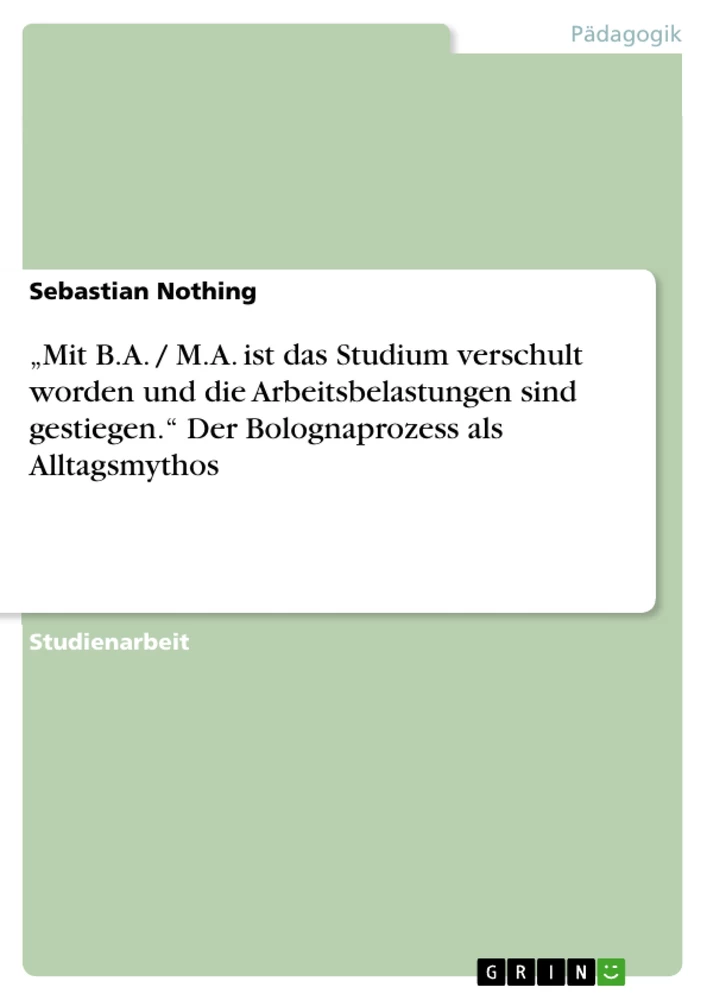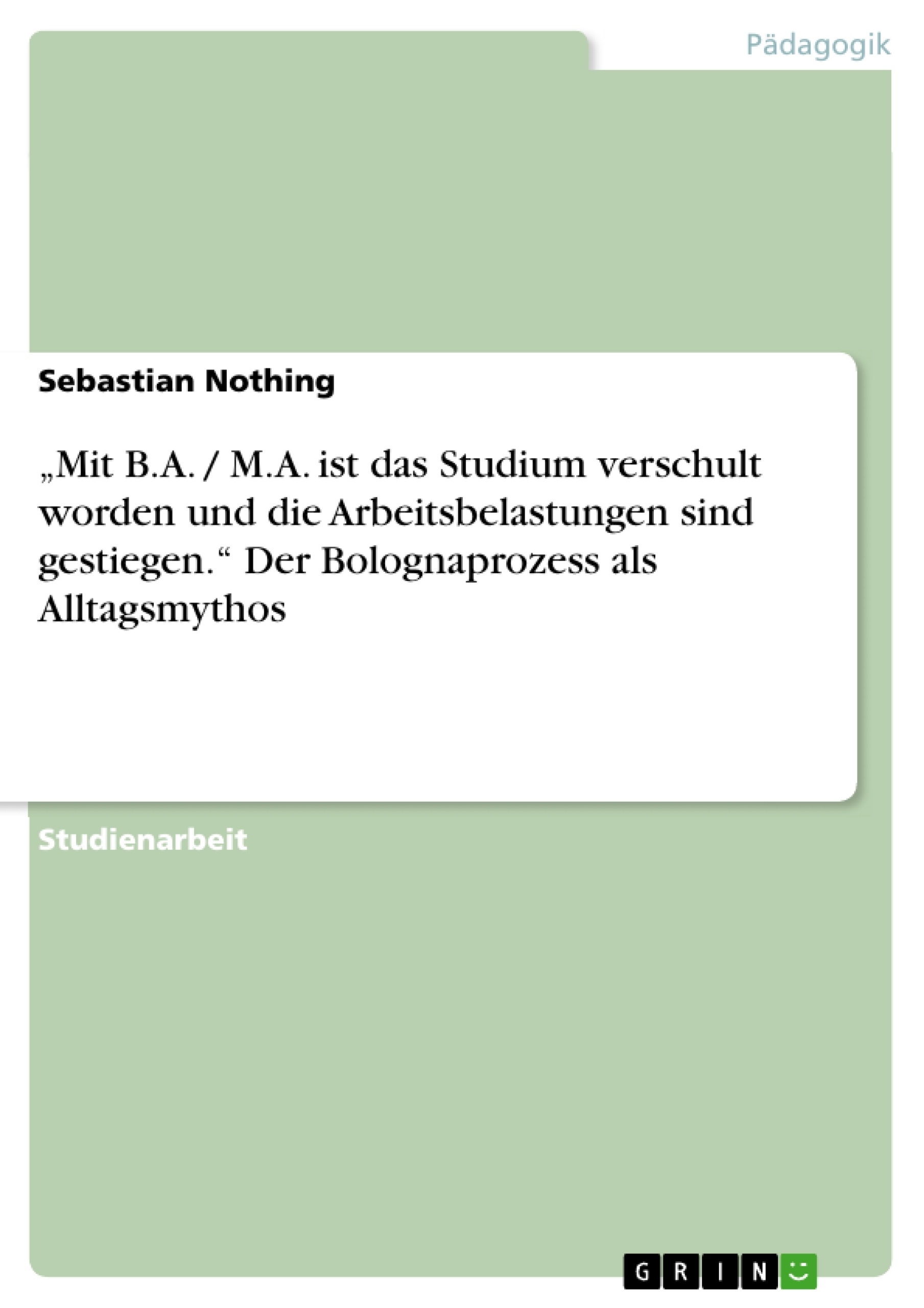Im Frühjahrstrimester 2010 wurde im Rahmen des Seminars „Stimmts? – Erziehungswissenschaftliche Analysen von Alltagsmythen der Erziehungswirklichkeit“ unter anderem der Mythos behandelt, ob mit der Einführung von Bachelor und Master das Studium verschult worden ist und die Arbeitsbelastung gestiegen sei. Aufgrund eigener Erfahrungen als Student im Bachelorstudiengang Bildungs- und Erziehungswissenschaften und des Interesses am Bolognaprozess wurde der Mythos als Thema der Hausarbeit gewählt.
Der erste Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über den Bolognaprozess, da dieser den Hintergrund des genannten Alltagsmythos bildet. Weiterhin wird sich in diesem Kapitel mit einem Teil der Forderungen des Bolognaprozess und der Umsetzung in Deutschland durch die Vorgaben und Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) befasst. Des Weiteren wird hier der aktuelle Stand der Umsetzung bezüglich der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen aufgezeigt. Auch wird auf den geforderten Aspekt der Qualitätssicherung, insbesondere den der Akkreditierung der neuen Studiengänge in Deutschland eingegangen.
Im sich anschließenden Abschnitt wird die Funktion des Leistungspunktesystems erläutert, danach die Modularisierung von Studiengängen beschrieben.
Das folgende Kapitel widmet sich dem Mythos der Verschulung und der gestiegen Arbeitsbelastung. Die Verschulung soll durch die drei Perspektiven einer Hochschulpolitischen Institution, eines Wissenschaftlers und einer Betroffenen, nämlich die der Hochschulrektorenkonferenz, die des Hamburger Bildungswissenschaftlers Rolf Schulmeister und die der Bremer Lehramtsstudentin Alexa Tegler beleuchtet werden. Auf der Grundlage der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes soll im Anschluss der Aspekt der Arbeitsbelastung untersucht werden.
Abschließend folgt auf der Basis der in den einzelnen Abschnitten gewonnen Erkenntnisse eine Stellungnahme zur genannten Frage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mythos vor dem Hintergrund des Bolognaprozesses
- Die Umsetzung der Forderungen des Bolognaprozesses in Deutschland
- Das Leistungspunktesystem
- Modularisierung
- Analyse des Mythos
- Verschulung
- Arbeitsbelastung
- Fazit
- Literatur und Quellen
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Alltagsmythos, dass mit der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen das Studium verschult worden ist und die Arbeitsbelastung gestiegen sei. Der Fokus liegt auf der Analyse des Mythos vor dem Hintergrund des Bolognaprozesses, insbesondere der Umsetzung des Leistungspunktesystems und der Modularisierung in Deutschland. Die Arbeit untersucht, ob die Einführung dieser Elemente tatsächlich zu einer Verschulung des Studiums und einer erhöhten Arbeitsbelastung geführt hat.
- Der Bolognaprozess und seine Umsetzung in Deutschland
- Das Leistungspunktesystem und seine Auswirkungen auf das Studium
- Modularisierung und ihre Relevanz für die Arbeitsbelastung
- Die These der Verschulung des Studiums
- Die These der gestiegenen Arbeitsbelastung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Alltagsmythos vor und erläutert die Relevanz des Bolognaprozesses für die Analyse. Sie gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die behandelten Themen.
Das Kapitel „Der Mythos vor dem Hintergrund des Bolognaprozesses“ beleuchtet die Entstehung und Umsetzung des Bolognaprozesses in Deutschland. Es werden die wichtigsten Forderungen des Prozesses, insbesondere die Einführung des Leistungspunktesystems und die Modularisierung, erläutert. Die Auswirkungen dieser Elemente auf die Gestaltung des Studiums werden diskutiert.
Das Kapitel „Analyse des Mythos“ untersucht die These der Verschulung und der gestiegenen Arbeitsbelastung. Es werden verschiedene Perspektiven auf diese Themen beleuchtet, darunter die Sichtweise der Hochschulrektorenkonferenz, eines Bildungswissenschaftlers und einer Studentin. Die Ergebnisse der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes werden herangezogen, um die Arbeitsbelastung von Studierenden zu analysieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Bolognaprozess, die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen, das Leistungspunktesystem, die Modularisierung, die Verschulung des Studiums, die Arbeitsbelastung von Studierenden und die Auswirkungen des Bolognaprozesses auf die Hochschulbildung in Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Nothing (Autor:in), 2011, „Mit B.A. / M.A. ist das Studium verschult worden und die Arbeitsbelastungen sind gestiegen.“ Der Bolognaprozess als Alltagsmythos, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/276276