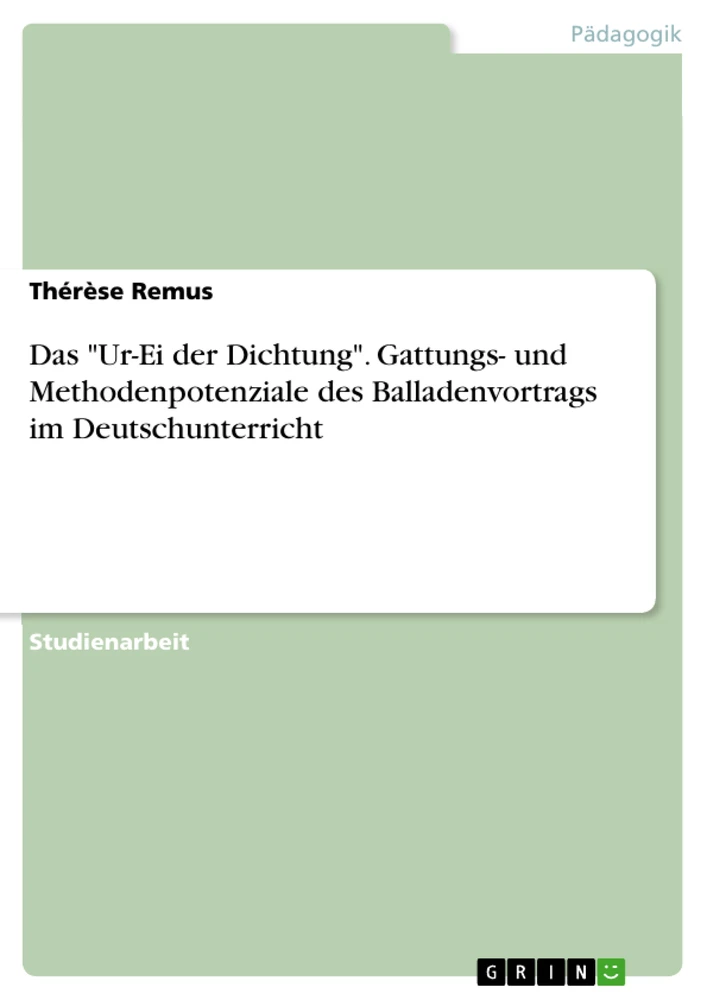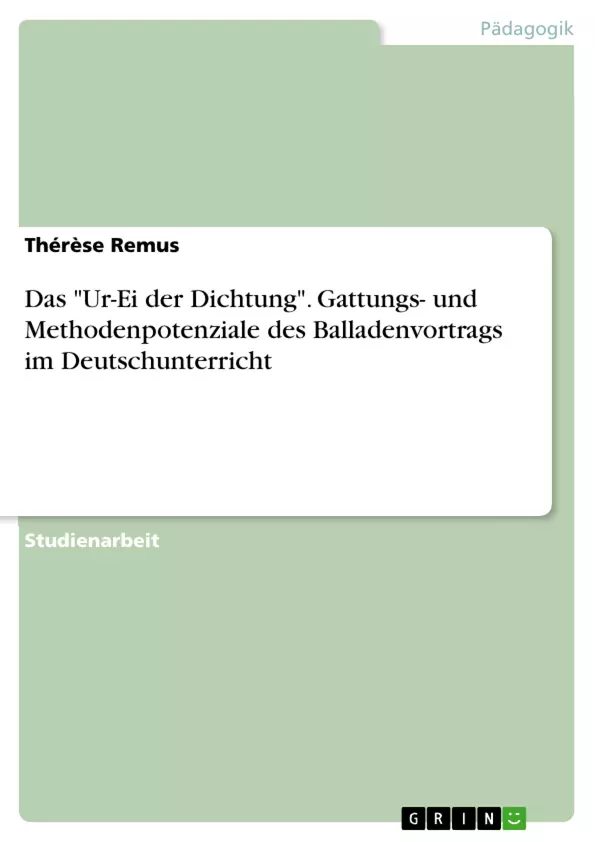Die Unterrichtsstunde, die Ausgangspunkt dieser Arbeit ist, hielt die Autorin in einer siebenten Klasse des Mittelschulzweigs einer Schule. Thematisch war die Doppelstunde eingebettet in das Thema „Ballade“, wobei sie die Unterrichtsreihe einleiten sollte. Der Stunde vorausgegangen waren Deutschstunden, in denen die SchülerInnen Prosa- und Reimfabeln behandelt und einige Schüler die Texte ihrer Wahl in einem Stuhlkreis auswendig vorgetragen oder nacherzählt hatten. Für viele Schüler war es dabei ganz offensichtlich ein Grauen, selbst in dieser entspannten Situation ihren Text vorzutragen. Für wenige schien es ein wirkliches Vergnügen zu sein, den Zuhörern ihren Text näherzubringen. Einige wenige Schüler hatten über die übliche Nervosität hinausgehende gravierende Schwierigkeiten, ihren Text zu behalten, mussten sich oft vorsagen lassen und schienen mit der Situation hilflos überfordert zu sein.
Die Intention des hier vorgestellten Ansatzes ist es, den Schülern Möglichkeiten aufzuzeigen, die ihnen den Prozess des Textauswendiglernens erleichtern können. Dies entspricht den Anforderungen eines alltagsbezogenen Unterrichts, der auf die Pragmatik realistischer Zukunftssituationen Bezug nimmt.
Die Idee war, kleine Skizzen anzufertigen, die Schlüsselmomente des Textgeschehens visualisieren und als Stütze für den mündlichen Vortrag dienen können. Im Folgenden sollen die praktischen Beobachtungen, sowie Potenzial und Schwierigkeiten der Memorierstrategie ausgewertet werden. Das Schüler-Feedback deutete außerdem an, dass dem Prozess, den Text in visuelle Reize zu übersetzen, viel mehr als das Potenzial einer reinen Memorier-Technik innewohnt. Die anschließende Reflexion erschloss noch weitere Dimensionen, die sich durch die Unterrichtsstunde mit Blick auf den Gegenstand Balladenvortrag eröffnen. So soll dieser im Folgenden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, wobei auch Aussichten auf einen Balladenunterricht gestellt werden, der sich anschließen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Die Ballade im Deutschunterricht
- Gattungsanalytisches Potenzial
- Kontextualisierung
- Literarisches Verstehen
- Der Balladenvortrag
- Verstehen durch Vortragen
- Fachübergreifende Relevanz von Lese- und Vortragsstrategien
- Der Balladenvortrag als Gegenstand einer produktionsorientierten Literaturdidaktik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Bedeutung und das Potenzial des Balladenvortrags im Deutschunterricht, wobei die Fokussierung auf den methodischen Aspekt des Textauswendiglernens liegt. Die Reflexionen basieren auf einer Unterrichtsstunde in der siebten Klasse, die die Thematik „Ballade“ einleiten sollte. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Memorierstrategien, die den Schülern den Prozess des Textauswendiglernens erleichtern sollen.
- Die Rolle der Ballade im Deutschunterricht
- Verschiedene Dimensionen des Balladenvortrags
- Entwicklung von Memorierstrategien für den Balladenvortrag
- Die Relevanz von Lese- und Vortragsstrategien im Unterricht
- Die Verbindung zwischen Ballade und anderen Textformaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorbemerkungen: Der Text beschreibt die Ausgangssituation, die durch die Schwierigkeiten der Schüler beim Auswendiglernen und Vortragen von Texten während des Unterrichtspraktikums motiviert wurde. Der Fokus liegt auf der Suche nach Methoden, die den Schülern den Prozess des Auswendiglernens erleichtern können.
- Die Ballade im Deutschunterricht: Dieses Kapitel behandelt die Relevanz der Ballade im Deutschunterricht und beleuchtet ihr gattungsanalytisches Potenzial. Die Diskussion bezieht sich auf Goethes Definition der Ballade als „Ur-Ei der Dichtung“ und die Frage, inwieweit sich die Ballade als ein „Ur-Ei der Dichtung“ betrachten lässt.
- Der Balladenvortrag: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf dem Balladenvortrag und seinen unterschiedlichen Facetten. Der Text beleuchtet die Bedeutung des Vortrags als Mittel zum Verstehen, die fachübergreifende Relevanz von Lese- und Vortragsstrategien und die Nutzung des Balladenvortrags als Gegenstand einer produktionsorientierten Literaturdidaktik.
Schlüsselwörter
Ballade, Deutschunterricht, Vortragsstrategien, Memoriertechniken, Textauswendiglernen, Gattungsanalyse, produktionsorientierte Literaturdidaktik, Auswendiglernen, Unterrichtspraxis, Schülermotivation.
- Quote paper
- Thérèse Remus (Author), 2012, Das "Ur-Ei der Dichtung". Gattungs- und Methodenpotenziale des Balladenvortrags im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275647