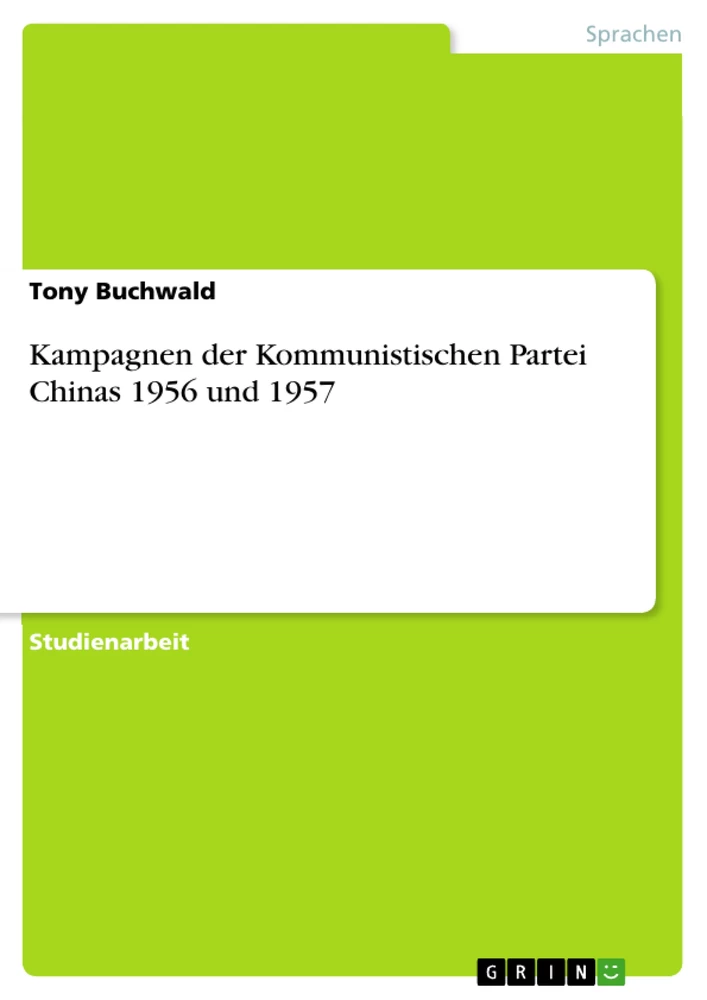Die Intellektuellen hatten in China seit Einführung des Konfuzianismus als Staatsdoktrin eine gesonderte Stellung in der Gesellschaft. Es lag in ihrer Verantwortung, die Regierung zu kritisieren, auf Missstände hinzuweisen und so gegen schlechte Staatsführung anzugehen. Dies war in ihrem ethischen Denken dermaßen verankert, dass sie selbst darauf hinweisen mussten, wenn ihnen dadurch Bestrafung und Tod drohten. Somit standen stets das System und dessen korrekte Ausführung im Vordergrund. Dieser Umstand änderte sich auch in Zeiten der Volksrepublik China nicht. Allerdings änderte sich die Vorgehensweise der Regierung, mit ebensolcher Kritik umzugehen bzw. änderte sich die Art, wie man mit Intellektuellen allgemein umging. Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) übte eine widersprüchliche Politik gegenüber dieser speziellen Gesellschaftsschicht aus. Zum einen versuchte sie durch Indoktrination, das Vertrauen in das von der KP angestrebte sozialistische System zu stärken. Zum anderen spornte sie die Intellektuellen an, in ihrem Metier besondere Produktivität an den Tag zu legen. Stets war die KP-Führung darauf aus, mit Hilfe ihrer Kooperation die Wirtschaft zu stärken und die Entwicklung voran zu treiben. Dazu kam, dass die Vierte-Mai-Bewegung 1919 einen enormen Einfluss auf die gebildete Schicht hatte, der aus westlicher Kultur und Ideologie bestand. Somit standen die Intellektuellen zwischen der Tradition des Konfuzianismus, dem Erbe des Vierten Mai und unter dem Druck der Partei. Dementsprechend inkonsequent änderte sich daher auch ihre Rolle in der Gesellschaft.
Diese Arbeit befasst sich mit der Zeit von 1956 bis 1957, in der sie vom Rückgrat der Gesellschaft zur isolierten Schicht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hundert-Blumen-Bewegung
- Erste Phase
- Zweite Phase
- Die Anti-Rechts Bewegung
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Zeit von 1956 bis 1957 in China, in der die Rolle der Intellektuellen in der Gesellschaft von einem Rückgrat zu einer isolierten Schicht wandelte. Sie analysiert die Hundert-Blumen-Bewegung und die anschließende Anti-Rechts-Bewegung, zwei Kampagnen der KPCh, die die Beziehung zwischen der Partei und den Intellektuellen prägten.
- Die widersprüchliche Politik der KPCh gegenüber den Intellektuellen
- Die Hundert-Blumen-Bewegung als Versuch, die Intellektuellen in die Gesellschaft einzubringen
- Die Anti-Rechts-Bewegung als Reaktion auf die Kritik der Intellektuellen
- Die Rolle von Mao Zedong in beiden Kampagnen
- Die Auswirkungen der Kampagnen auf die Intellektuellen und die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Rolle der Intellektuellen in der chinesischen Gesellschaft und die widersprüchliche Politik der KPCh gegenüber ihnen ein.
Das erste Kapitel behandelt die Hundert-Blumen-Bewegung, die in zwei Phasen unterteilt wird. Die erste Phase beschreibt den Aufruf der KPCh zur Kritik und den anfänglichen Skeptizismus der Intellektuellen. Die zweite Phase schildert die verstärkte Kritik der Intellektuellen an der KPCh und die Reaktion der Partei darauf.
Das zweite Kapitel analysiert die Anti-Rechts-Bewegung, die als Reaktion auf die Hundert-Blumen-Bewegung entstand. Die KPCh verurteilte die Kritik der Intellektuellen als „rechtsgerichtet" und setzte sie unter Druck. Die Auswirkungen der Kampagne auf die Intellektuellen und die Gesellschaft werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Hundert-Blumen-Bewegung, die Anti-Rechts-Bewegung, die KPCh, die Intellektuellen, die Kritik, die Indoktrination, die wirtschaftliche Entwicklung, die politische Kultur, die soziale Kontrolle, der Konfuzianismus, der Vierte Mai, die Bürokratie, das sozialistische System, die Machtverhältnisse und die Auswirkungen der Kampagnen auf die chinesische Gesellschaft.
- Quote paper
- Tony Buchwald (Author), 2009, Kampagnen der Kommunistischen Partei Chinas 1956 und 1957, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275054