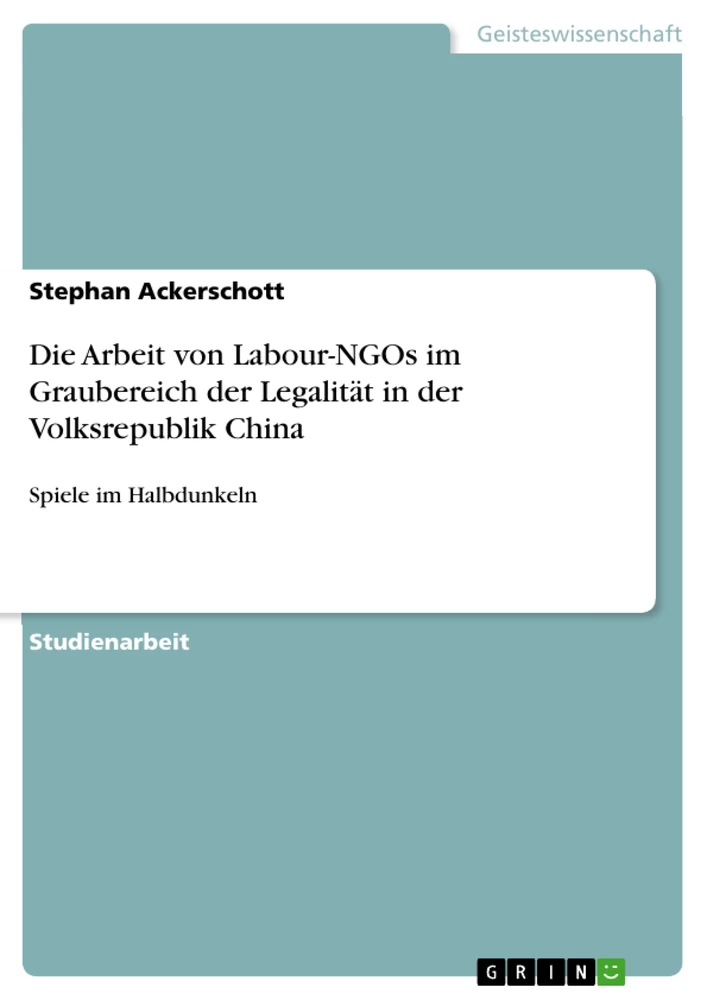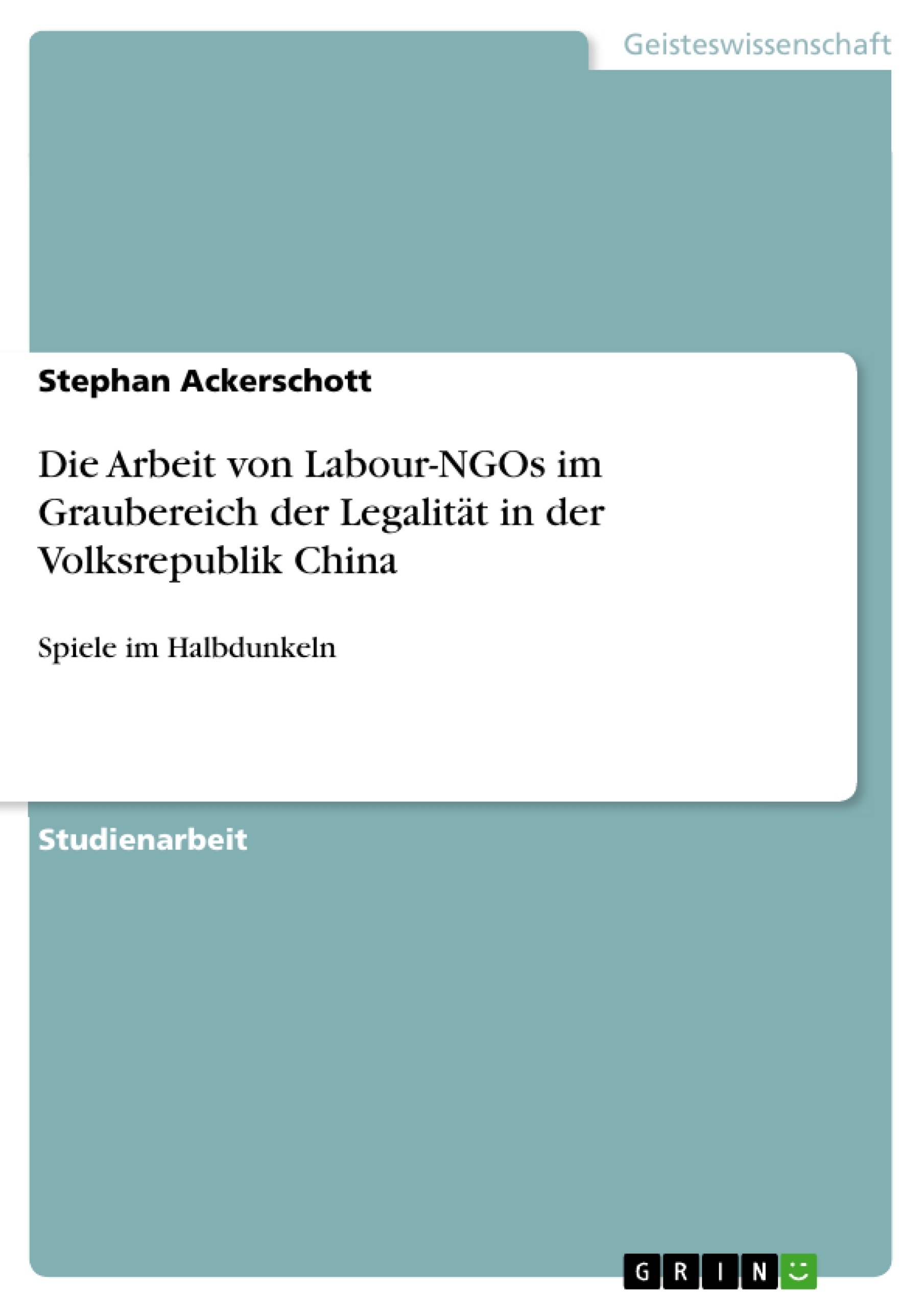Inhaltsverzeichnis II
Abkürzungsverzeichnis 3
1 Einleitung 4
2 Das Spiel und seine Struktur 5
2.1. NGOs - Neue Spieler in einem alten Spiel? 5
2.2. Spielgebote und -verbote 7
3 „Spiel-Theoretische“ Überlegungen… 8
3.1. Eine mögliche Erklärung, warum Akteure, wie, handeln 9
3.2. Empowerment – Stärkung der (individuellen) Machtbasis 11
4 Das „chinesische“ Spiel 13
5 Fazit 19
Literaturverzeichnis 21
Zeitschriftenartikel 21
Internetquellen 22
Eidesstattliche Versicherung 22
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Spiel und seine Struktur
- NGOs - Neue Spieler in einem alten Spiel?
- Spielgebote und -verbote
- "Spiel-Theoretische" Überlegungen...
- Eine mögliche Erklärung, warum Akteure, wie, handeln
- Empowerment — Stärkung der (individuellen) Machtbasis
- Das "chinesische" Spiel
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Zeitschriftenartikel
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Arbeit von Labour-NGOs in der Volksrepublik China und untersucht die Bedingungen, unter denen diese Organisationen agieren und existieren. Ziel ist es, die Einflussmöglichkeiten von Labour-NGOs auf den Arbeitssektor zu analysieren und potentielle Wege zu ihrer Verbesserung aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die strukturellen Rahmenbedingungen und Herausforderungen, denen Labour-NGOs in China gegenüberstehen, und analysiert die Rolle von Machtverhältnissen und Empowerment-Strategien im Kontext dieser Organisationen.
- Die Rolle von NGOs im Arbeitssektor der Volksrepublik China
- Die strukturellen Herausforderungen für Labour-NGOs in China
- Die Bedeutung von Machtverhältnissen und Empowerment-Strategien
- Die Einflussfaktoren auf die Arbeit von Labour-NGOs
- Potentielle Wege zur Verbesserung der Einflussmöglichkeiten von Labour-NGOs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik, die die Bedeutung von NGOs in China im Kontext der letzten gesellschaftlichen Umwälzungen beleuchtet. Kapitel 2 beleuchtet die strukturellen Aspekte des Arbeitssektors in China und differenziert die verschiedenen Akteure, die in diesem Spiel um Einfluss und Macht agieren. Dabei werden die verschiedenen Arten von NGOs, ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen, denen sie im Kontext des chinesischen Rechtssystems gegenüberstehen, näher betrachtet. Kapitel 3 analysiert die Spielregeln und Handlungsmechanismen im Arbeitssektor aus einer "spieltheoretischen" Perspektive und erklärt, warum Akteure, wie sie handeln. Hierbei wird die Bedeutung von Machtverhältnissen und Empowerment-Strategien hervorgehoben.
Kapitel 4 widmet sich dem "chinesischen" Spiel und untersucht die spezifischen Bedingungen, unter denen Labour-NGOs in China agieren. Es werden die Herausforderungen, die durch die staatliche Kontrolle und die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen entstehen, beleuchtet. Zudem werden die unterschiedlichen Registrierungsformen für NGOs in China und die damit verbundenen Rechte und Pflichten erläutert. Die Arbeit analysiert die Rolle von Labour-NGOs im Kontext der chinesischen Arbeitspolitik und zeigt die Schwierigkeiten auf, die diese Organisationen bei der Durchsetzung der Rechte der Arbeitnehmerschaft erleben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Labour-NGOs, Arbeitssektor, Volksrepublik China, Empowerment, Machtverhältnisse, strukturelle Rahmenbedingungen, rechtliche Herausforderungen, Spieltheorie, "chinesisches" Spiel, "Legaler Widerstand", staatliche Kontrolle, Repressionen, Arbeitsrechte, Gewerkschaften, Unternehmen, politische Indoktrinierung, Demokratisierungsprozess.
- Quote paper
- Stephan Ackerschott (Author), 2014, Die Arbeit von Labour-NGOs im Graubereich der Legalität in der Volksrepublik China, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/274768