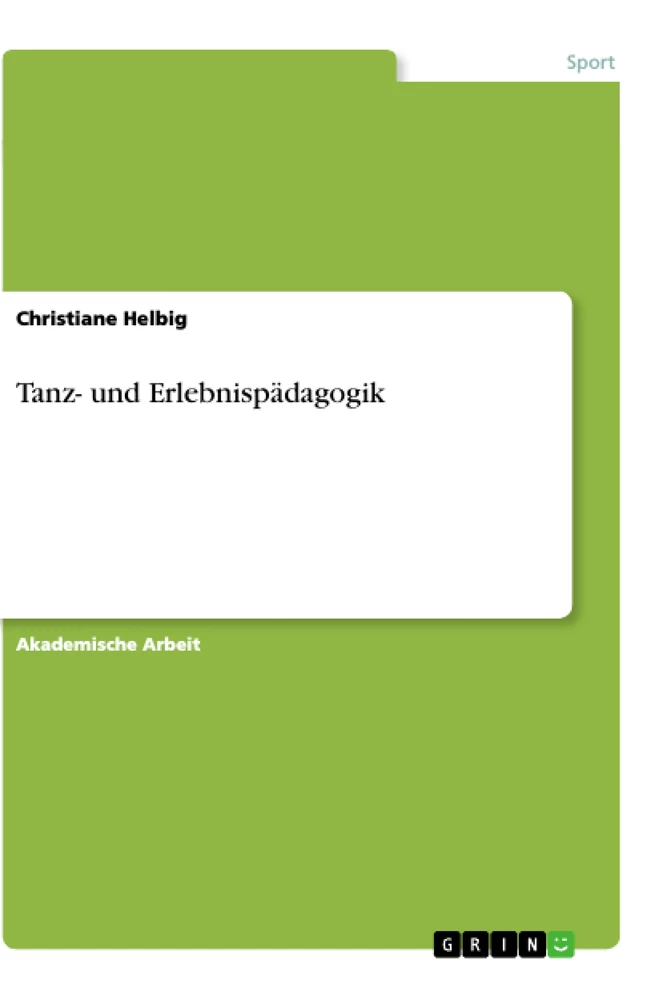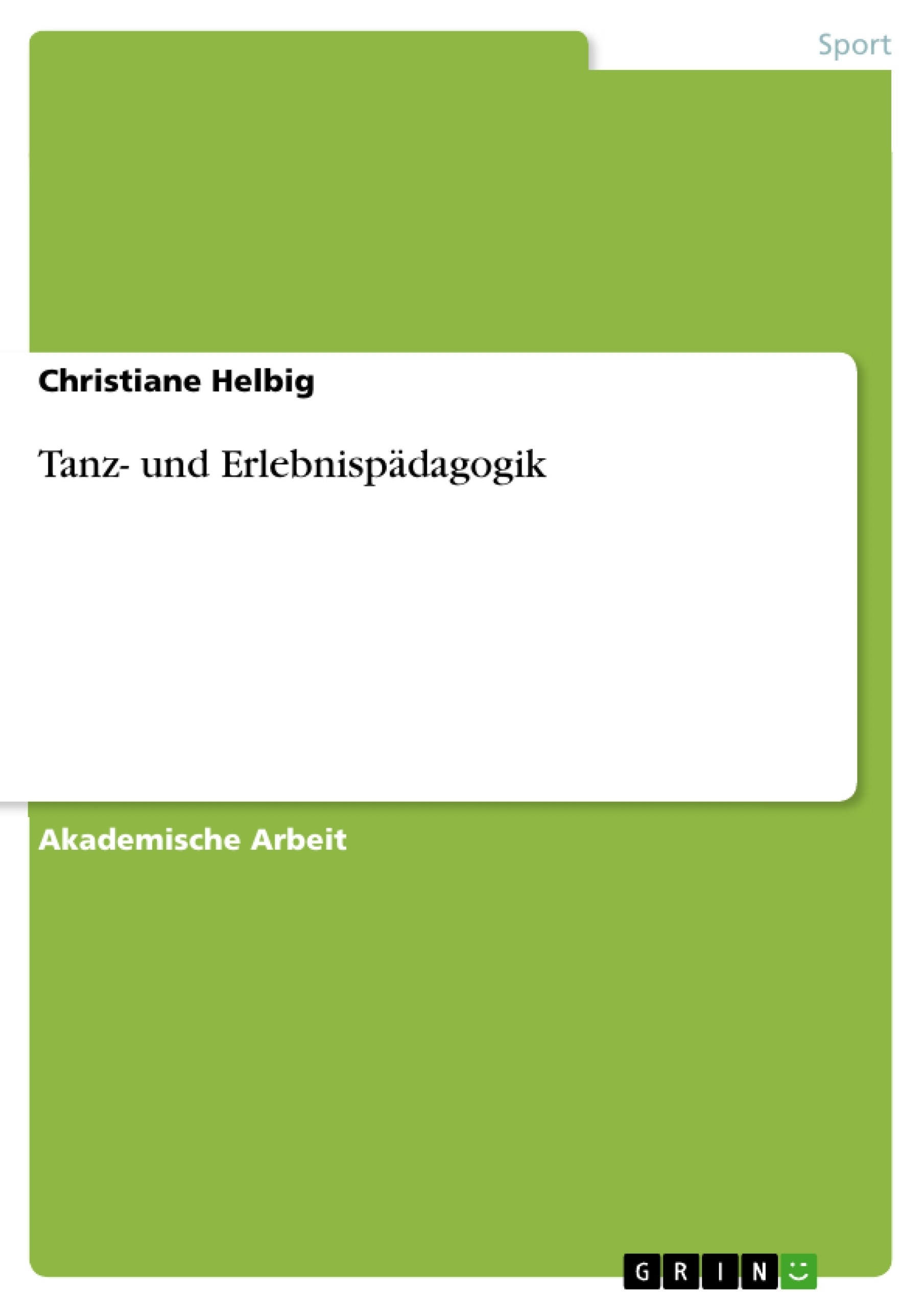Tanz ist eine pädagogisch betrachtet rhythmisch geformte Bewegung. Er gilt als Ausdrucksmittel, dass dem menschlichen Bedürfnis bzw. Trieb nach Darstellung und Kommunikation entspricht. Ziel folgender Ausführungen ist es daher, Tanz als Lehr- und Lerngehalt in seinen Möglichkeiten und Grenzen für Erziehung und Bildung abzustecken und eine thematische Auseinandersetzung im Zusammenhang mit erlebnispädagogischen Möglichkeiten im Tanzen mit Kindern und Jugendlichen vorzulegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wesen der Tanzpädagogik
- Körperlichkeit und Emotionalität in Erziehung und Bildung
- Ziele und Bildungsinhalte der Tanzpädagogik
- Sachorientierter Bereich
- Subjektiv-emotionaler Bereich
- Sozialer Bereich
- Kognitiver Bereich
- Methodik und Vermittlungsformen der Tanzpädagogik
- Das Wesen der Erlebnispädagogik
- Theoriegeschichtliche Rekonstruktion
- Historische Entstehungsgrundlagen
- Kurt Hahn's Schulbewegung
- Erlebnisarmut in einer Erlebnisgesellschaft
- Erziehung und Erleben
- Ziele, Vermittlung und Grenzen der Erlebnispädagogik
- Theoriegeschichtliche Rekonstruktion
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Werk befasst sich mit der Tanz- und Erlebnispädagogik und zielt darauf ab, den Tanz als Lehr- und Lerngehalt in seinen Möglichkeiten und Grenzen für Erziehung und Bildung zu beleuchten. Der Fokus liegt insbesondere auf den erlebnispädagogischen Möglichkeiten im Tanzen mit Kindern und Jugendlichen.
- Das Wesen der Tanzpädagogik und ihre Bedeutung in der Bildung
- Die Rolle von Körperlichkeit und Emotionalität im Tanzen
- Die verschiedenen Bereiche der Tanzpädagogik (sachorientiert, subjektiv-emotional, sozial, kognitiv)
- Die theoretischen Grundlagen und historische Entwicklung der Erlebnispädagogik
- Die Integration von Erlebnispädagogischen Elementen im Tanz für Kinder und Jugendliche
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Tanzpädagogik ein und beleuchtet die Bedeutung des Tanzes in der menschlichen Gesellschaft. Es werden verschiedene Tanzformen und deren assoziierte Emotionen betrachtet. Der Zusammenhang zwischen Tanz und "Fun" wird erörtert, wobei die Unterscheidung zwischen oberflächlichem Spaß und tiefem, ganzheitlichem Vergnügen hervorgehoben wird.
- Das Wesen der Tanzpädagogik: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Wesen der Tanzpädagogik und betrachtet die Rolle von Körperlichkeit und Emotionalität in Erziehung und Bildung. Es werden die Ziele und Bildungsinhalte der Tanzpädagogik in verschiedenen Bereichen, wie dem sachorientierten, subjektiv-emotionalen, sozialen und kognitiven Bereich, näher beleuchtet. Zusätzlich werden die Methodik und Vermittlungsformen der Tanzpädagogik vorgestellt.
- Das Wesen der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Erlebnispädagogik, ihrer Theoriegeschichte und Entstehungsgrundlagen. Es werden wichtige Personen wie Kurt Hahn und seine Schulbewegung sowie das Thema der Erlebnisarmut in der heutigen Gesellschaft behandelt. Das Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Erziehung und Erleben und stellt die Ziele, die Vermittlung und die Grenzen der Erlebnispädagogik dar.
Schlüsselwörter
Tanzpädagogik, Erlebnispädagogik, Körperlichkeit, Emotionalität, Bildung, Erziehung, Ziele, Bildungsinhalte, Methodik, Vermittlung, Theoriegeschichte, Kurt Hahn, Erlebnisarmut, Erziehung und Erleben, Grenzen, Kinder, Jugendliche, Fun, Flow, Tanzsprache, Bewegung, Rhythmus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Tanzpädagogik?
Tanzpädagogik nutzt rhythmische Bewegung als Ausdrucksmittel, um körperliche, emotionale, soziale und kognitive Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Wie lässt sich Erlebnispädagogik in den Tanz integrieren?
Durch erlebnispädagogische Ansätze wird Tanzen zu einem ganzheitlichen Erlebnis, das über die reine Technik hinausgeht und persönliche Grenzerfahrungen sowie Gruppendynamik ermöglicht.
Welche Rolle spielt Körperlichkeit in der Erziehung?
Körperlichkeit wird als zentrales Element der Identitätsbildung gesehen. Der Tanz ermöglicht es, Emotionen physisch auszudrücken und ein gesundes Körperbewusstsein zu entwickeln.
Wer war Kurt Hahn und was hat er mit Erlebnispädagogik zu tun?
Kurt Hahn gilt als Begründer der modernen Erlebnispädagogik. Seine Ansätze zur Charakterbildung durch Herausforderungen und Naturerlebnisse bilden die theoretische Basis für viele pädagogische Konzepte.
Was ist der Unterschied zwischen "oberflächlichem Spaß" und echtem Erleben im Tanz?
Während oberflächlicher "Fun" oft kurzlebig ist, zielt die Tanzpädagogik auf tiefe Erlebnisse wie den "Flow"-Zustand ab, bei dem die Kinder ganz in der Bewegung und im Moment aufgehen.
- Quote paper
- Christiane Helbig (Author), 2006, Tanz- und Erlebnispädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/274729