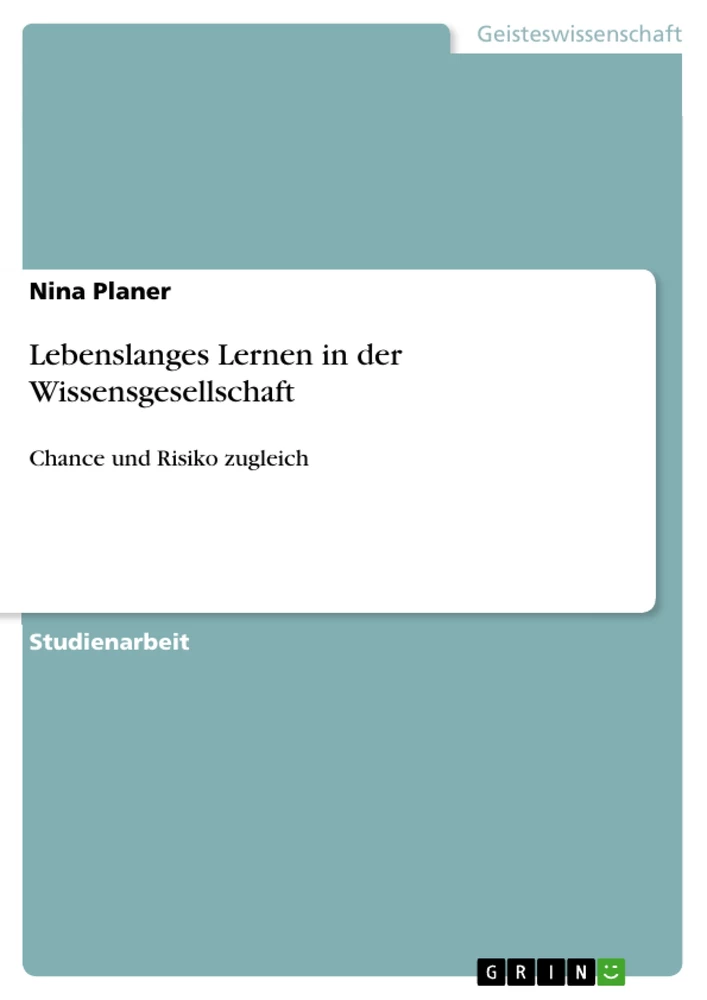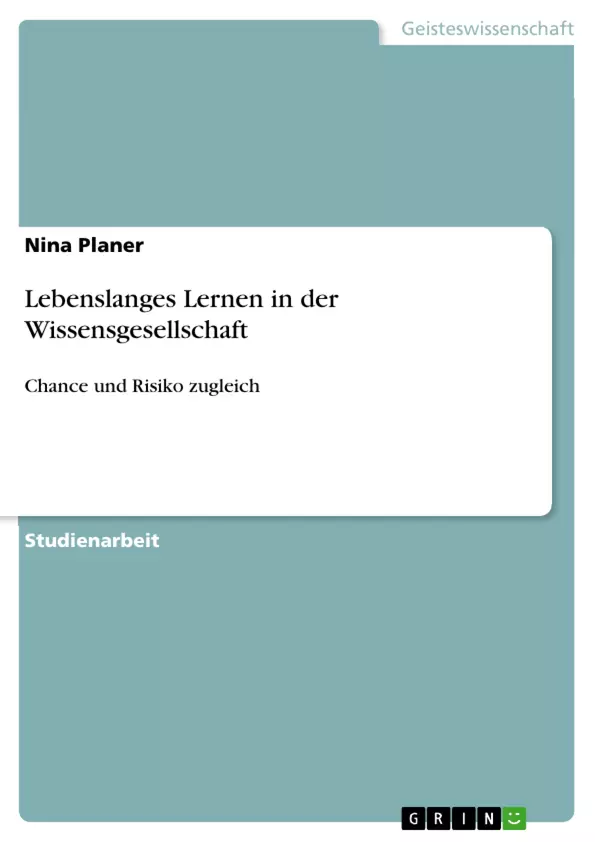Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Thematik des lebenslangen Lernens. Dieses wird in Bezug zur Wissensgesellschaft gesetzt, indem der Zusammenhang zwischen beiden und die Auswirkungen der existierenden Wissensgesellschaft auf das Konzept des lebenslangen Lernens erörtert werden. Verschiedene Fragen stehen diesbezüglich offen, die versucht werden im Laufe der Arbeit zu beantworten. Unteranderem, ob die Zunahme der Bedeutung vom lebenslangen Lernen mit der Diagnose Wissensgesellschaft erklärt werden kann? Welche Auswirkungen dies auf die einzelnen Akteure hat und ob die Thematik neben vermuteten Chancen auch Risiken birgt?
Zu Beginn der Arbeit findet eine Erklärung der gesellschaftlichen Veränderungen durch die Darstellung verschiedener Theorien zur Wissensgesellschaft statt. Dazu werden zunächst Ausschnitte zweier klassischer Theorien und anschließend substanzielle Aspekte zweier aktuellen Perspektiven vorgestellt, um erstens den Wandel von Industrie- zur Wissensgesellschaft zu erklären und somit die Bedeutungszunahme des Wissens und zweitens den Zusammenhang zwischen Wissensgesellschaft und lebenslangen Lernen darzulegen. Einer der Hauptbestandteile der Arbeit liegt in der Diagnose der Bedeutung des lebenslangen Lernens. Im dritten Kapitel werden neben den Wirkungen der Wissensgesellschaft auf dieses Konzept auch die Chancen, die sich durch lebenslanges Lernen ergeben aufgezeigt. Ziel dieser Arbeit ist aber neben den genannten Aspekten auch, das bisherige Konzept kritisch zu hinterfragen. Ist lebenslanges Lernen tatsächlich die vollkommene Lösung, der durch die Wissensgesellschaft entstandenen Probleme und Herausforderungen? Um diese Frage beantworten zu können, wird sich in Abschnitt 3.3 auch mit möglichen Risiken auseinandergesetzt, die zum einen durch die Realisierung von flächendeckenden lebenslangen Lernen entstehen könnten, zum anderen aber auch Risiken, die mit der Umsetzung dieses Konzepts nicht vollkommen beseitigt werden können.
Die Hausarbeit schließt mit einem Fazit ab, welches neben der Zusammenfassung der Ergebnisse, der abschließenden Meinungsbildung zum Konzept des lebenslangen Lernen, auch mögliche Anpassungs- und Veränderungsvorschläge, die in Zukunft realisiert werden könnten, um entstandene und noch entstehende Probleme zu verringern, beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund zur Wissensgesellschaft
- Wissensgesellschaft nach Peter F. Drucker
- Daniel Bell: Die postindustrielle Gesellschaft als Wissensgesellschaft
- Konzeption einer Wissensgesellschaft von Nico Stehr
- André Gorz: Vom Wissenskapitalismus zur Wissensgesellschaft
- Zwischenfazit
- Konzept des lebenslangen Lernens
- Wie die neuen Herausforderungen der Wissensgesellschaft zum Auftraggeber des lebenslangen Lernens werden
- Chancen die sich durch lebenslanges Lernen ergeben
- Entstehende Risiken im Zusammenhang mit lebenslangen Lernen
- Exkurs: Prozess des Lernens in der Lebensspanne
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Konzept des lebenslangen Lernens im Kontext der Wissensgesellschaft. Sie analysiert die Beziehung zwischen beiden und beleuchtet die Auswirkungen der Wissensgesellschaft auf das lebenslange Lernen. Die Arbeit befasst sich mit Fragen wie:
- Kann die zunehmende Bedeutung des lebenslangen Lernens mit der Diagnose der Wissensgesellschaft erklärt werden?
- Welche Auswirkungen hat die Wissensgesellschaft auf die Akteure?
- Birgt das lebenslange Lernen neben Chancen auch Risiken?
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Erörterung verschiedener Theorien zur Wissensgesellschaft, um den Wandel von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft und die damit verbundene Bedeutungszunahme des Wissens zu erklären. Dazu werden zunächst die klassischen Theorien von Peter F. Drucker und Daniel Bell vorgestellt. Anschließend werden substanzielle Aspekte der Theorien von Nico Stehr und André Gorz analysiert, um den Zusammenhang zwischen Wissensgesellschaft und lebenslangen Lernen zu beleuchten.
Im dritten Kapitel wird das Konzept des lebenslangen Lernens im Kontext der Wissensgesellschaft näher betrachtet. Neben den Auswirkungen der Wissensgesellschaft auf das lebenslange Lernen werden die Chancen aufgezeigt, die sich durch lebenslanges Lernen ergeben. Die Arbeit geht auch auf mögliche Risiken ein, die mit der Umsetzung des Konzepts verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wissensgesellschaft, lebenslanges Lernen, Chancen und Risiken, Individualisierung, soziale Ungleichheit, Bildung, Arbeit und die Auswirkungen der Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK).
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Wissensgesellschaft?
Eine Gesellschaft, in der Wissen die zentrale Ressource für wirtschaftliches Wachstum und soziale Teilhabe ist, und in der Informationstechnologien eine dominierende Rolle spielen.
Warum ist lebenslanges Lernen heute unerlässlich?
Da Wissen immer schneller veraltet, müssen Menschen sich ständig weiterbilden, um am Arbeitsmarkt bestehen zu können und gesellschaftlich integriert zu bleiben.
Welche Risiken birgt das Konzept des lebenslangen Lernens?
Es kann zu einem permanenten Leistungsdruck führen und soziale Ungleichheiten verschärfen, da nicht jeder den gleichen Zugang zu Bildungsressourcen hat.
Wie hängen Individualisierung und Bildung zusammen?
In der Wissensgesellschaft wird Bildung zur individuellen Verantwortung. Jeder ist selbst für den Erhalt seiner „Beschäftigungsfähigkeit“ zuständig.
Was bedeutet „Wissenskapitalismus“ nach André Gorz?
Gorz kritisiert, dass Wissen zunehmend privatisiert und ökonomisch verwertet wird, was den freien Zugang zu Informationen einschränkt.
- Arbeit zitieren
- Nina Planer (Autor:in), 2013, Lebenslanges Lernen in der Wissensgesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/273614