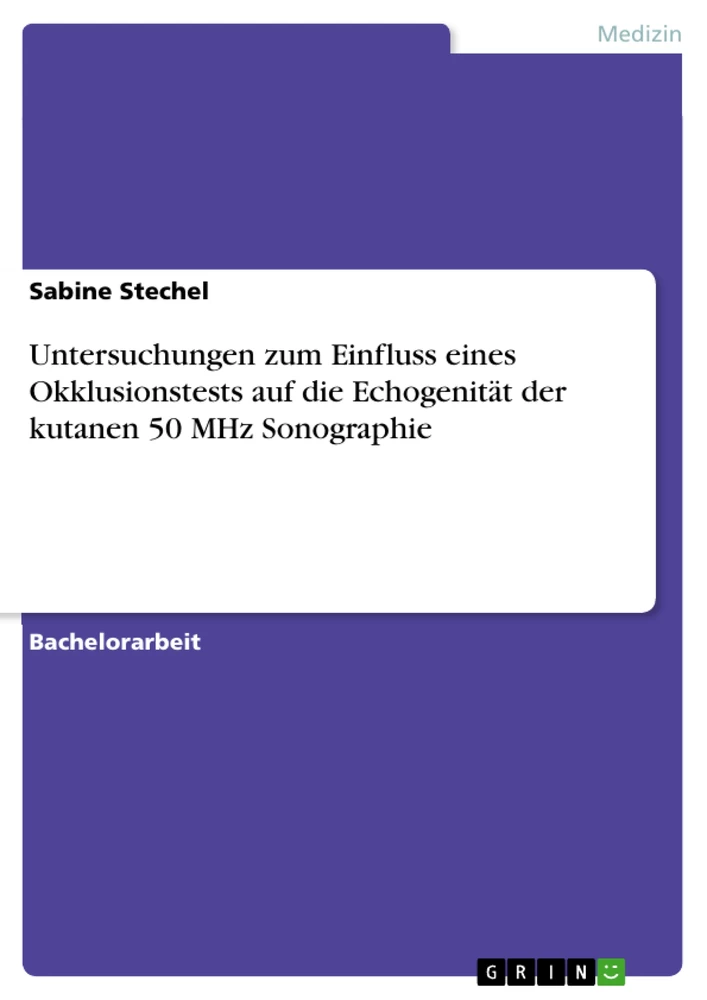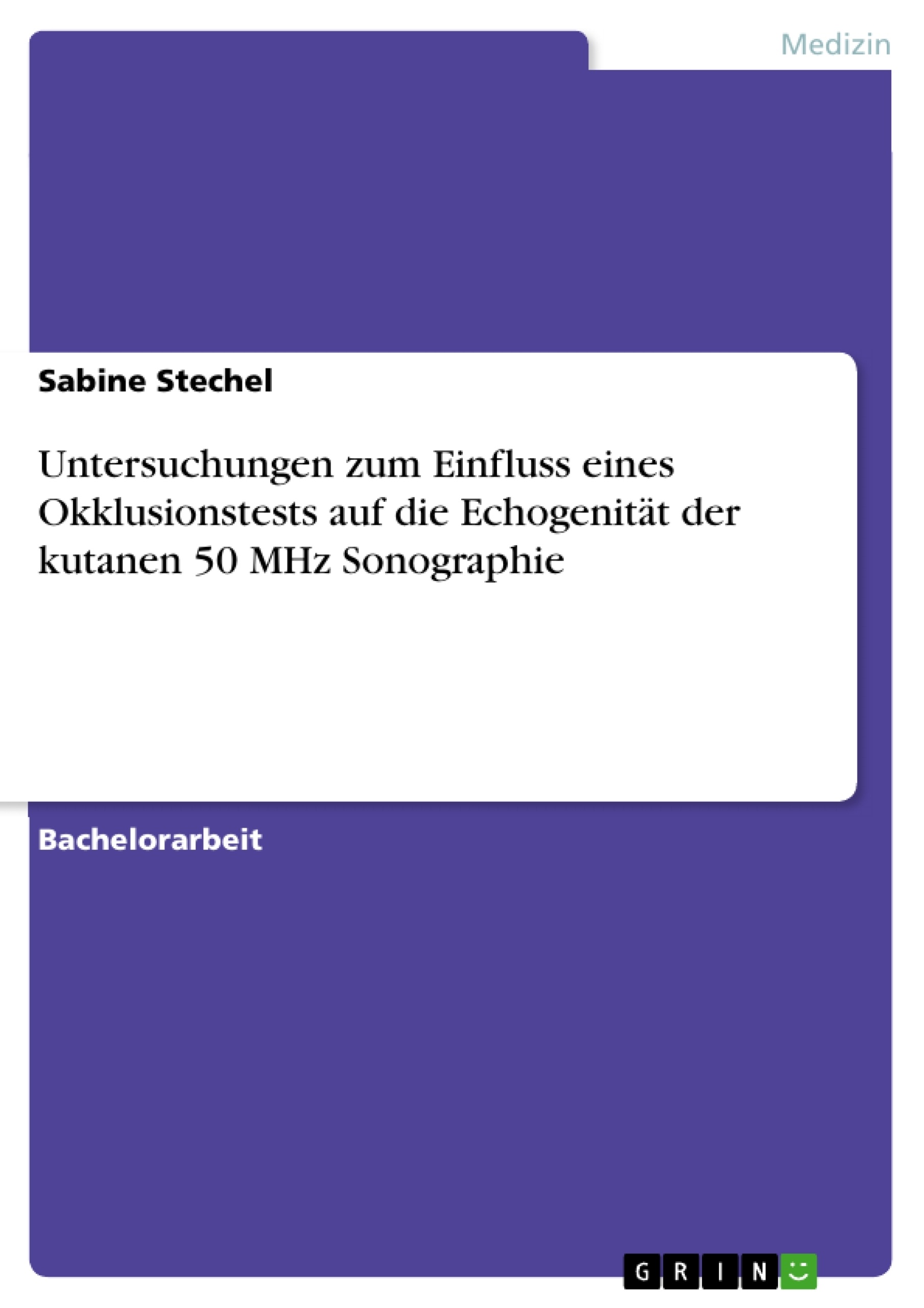Die Ultraschalluntersuchung der Haut erfährt in den letzten Jahren fortwährend mehr Verbreitung. Aufgrund des nicht-invasiven Charakters bietet sie durch geringeren Arbeits- und Kostenaufwand eine gute Alternative zu anderen Untersuchungsverfahren wie beispielsweise der Biopsie oder radiologischen Verfahren [14]. In der Dermatokosmetik wird das Ultraschallverfahren, insbesondere die 20 MHz-Sonographie, seit bereits 25 Jahren beispielsweise im Rahmen von Studien zur Untersuchung, Kontrolle und Evaluation von entzündlichen Dermatosen vielfach eingesetzt [15, 16].
Seit einigen Jahren sind auch höher frequentierte Geräte, mit einer Frequenz von 50 MHz verfügbar. Die physikalischen Eigenschaften des Ultraschalls erlauben, Untersuchungen mit einer hohen axialen Auflösung von 39 µm und einer lateralen Auflösung von 120 µm gegenüber der 20 MHz-Sonographie mit einer axialen Auflösung von 80 µm und einer lateralen Auflösung von 200 µm [17, 18]. Aufgrund der hohen Auflösung erscheint es besonders interessant, die 50 MHz-Sonographie zur Untersuchung der Haut unter Okklusion anzuwenden. Mit den seit 1989 erstmals verfügbaren Geräten wurden unterschiedliche Untersuchungen zur Okklusion der Haut durchgeführt [15]. Studien, die mit 20 MHz-Ultraschall durchgeführt wurden, deuten an, dass eine Okklusion und die daraus resultierende Hydratation einen Einfluss auf die Echogenität, also die Reflexions- beziehungsweise Streuungseigenschaften der Schallwellen, hat [19]. Allerdings sind mit den kommerziell erhältlichen 20 MHz-Ultraschallgeräten epidermale Effekte kaum darstellbar, da die Auflösung hierfür zu gering ist [18].
Gegenstand dieser Untersuchung soll daher der Einfluss einer durch Okklusion induzierten Hydratation auf die Echogenität beziehungsweise auf das B-Bild der kutanen
50 MHz-Sonographie sein. Diese wissenschaftliche Evaluation erfolgt im Rahmen eines Okklusionstests mit einer Finn Chamber® in einem kontrollierten Vorher-Nachher-Studiendesign.
Dabei sollen insbesondere folgende Fragestellungen eingehend untersucht werden:
1. Nimmt die Hautdicke in Folge der zu erwartenden Quellung zu?
2. Ändert sich durch die induzierte Hydratation die Dichte des Echos insgesamt?
3. Nimmt die Breite des Eintrittsechos auf Grund der zu erwartenden Quellung ab?
4. Verändert sich die Dichte des Eintrittsechos nach der Hydratation?
5. Ändert sich die Hautdicke ohne Eintrittsecho nach der Okklusion?
6. Verändert sich die Hautdichte ohne ohne Eintrittsecho in Folge der Quellung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodik
- Probanden
- Studiendesign
- Okklusionstest
- Messmethoden
- Messung der Hydratation der Haut
- Sonographie der Haut
- Statistik
- Ergebnisse
- Hydratation der Haut
- 50 MHz-Sonographie
- Exemplarische Sonogramme zweier Probandinnen
- Hautdicke
- Hautdichte
- Eintrittsecho
- Evaluation der Sonogramme ohne Eintrittsecho
- Diskussion
- Hautdicke
- Hautdichte
- Quantifizierung des Eintrittsechos
- Breite des Eintrittsechos
- Dichte des Eintrittsechos
- Evaluation der Sonogramme ohne Eintrittsecho
- Breite ohne Eintrittsecho
- Dichte ohne Eintrittsecho
- Zusammenfassung
- Literatur
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss eines Okklusionstests auf die Echogenität der kutanen 50 MHz-Sonographie. Ziel ist es, die Veränderungen der Hautstruktur, insbesondere der Epidermis, durch eine induzierte Hydratation mittels einer Finn Chamber@ zu analysieren. Die Studie wurde mit zwölf weiblichen Probandinnen im Hautfunktionslabor der Universität Hamburg durchgeführt.
- Einfluss der Hydratation auf die Echogenität der 50 MHz-Sonographie
- Veränderungen der Hautdicke, Dichte und des Eintrittsechos
- Analyse der Echobreite und Dichte ohne das Eintrittsecho
- Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien zur 20 MHz-Sonographie
- Zusammenhang zwischen der Echogenität und den verschiedenen Hautschichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Okklusionstests in der dermatokosmetischen Forschung ein und erläutert deren Bedeutung für die Untersuchung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Dermatokosmetika und Medikamenten. Besondere Aufmerksamkeit wird den Auswirkungen einer Okklusion auf die Hautbarriere, die Hydratation und die perkutane Absorption gelegt. Die verschiedenen Methoden zur Beurteilung von Okklusionstests, insbesondere die kapazitive Messung der Stratum Corneum-Hydratation und die Ultraschalluntersuchung, werden vorgestellt.
Die Methodik beschreibt detailliert die Durchführung der Studie, einschließlich der Auswahl der Probandinnen, des Studiendesigns und der Messmethoden. Die kapazitive Messung der Stratum Corneum-Hydratation mittels Corneometer@ CM 825 und die sonographischen Aufnahmen mit dem 50 MHz-Ultraschallgerät der Firma taberna pro medicum werden erläutert. Die statistische Auswertung der Daten mit Microsoft Office Excel@ 2007 und SPSS Statistics@ 17,0 wird ebenfalls beschrieben.
Die Ergebnisse präsentieren die Veränderungen der Hautkapazität und der Echogenität der 50 MHz-Sonographie nach der vierstündigen Okklusion. Es wird gezeigt, dass die Hydratation der Haut signifikant ansteigt und sich das Eintrittsecho deutlich verändert. Die Hautdicke und -dichte zeigen keine signifikanten Veränderungen.
Die Diskussion analysiert die Ergebnisse im Kontext der vorhandenen Literatur und beleuchtet die Bedeutung der verschiedenen Parameter für die Beurteilung von Hautveränderungen. Die Ergebnisse werden mit anderen Studien verglichen und mögliche Ursachen für die beobachteten Veränderungen werden diskutiert. Besonderes Augenmerk wird auf den Einfluss der Hydratation auf die Echogenität des Eintrittsechos und auf das echoarme Band unterhalb des Eintrittsechos gelegt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Okklusionstest, die Echogenität, die kutanen 50 MHz-Sonographie, die Hydratation der Haut, die Hautdicke, die Hautdichte, das Eintrittsecho, die Echobreite und die Dichte ohne das Eintrittsecho. Die Arbeit untersucht den Einfluss einer induzierten Hydratation der Haut auf die Echogenität der 50 MHz-Sonographie und analysiert die Veränderungen der Hautstruktur, insbesondere der Epidermis, durch eine Okklusion mittels einer Finn Chamber@.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Untersuchung zur 50 MHz Sonographie?
Ziel ist es, den Einfluss einer durch Okklusion induzierten Hydratation (Feuchtigkeitsanreicherung) auf die Echogenität und das B-Bild der Haut mittels hochfrequenter 50 MHz-Sonographie zu analysieren.
Wie unterscheidet sich die 50 MHz- von der 20 MHz-Sonographie?
Die 50 MHz-Sonographie bietet eine deutlich höhere axiale Auflösung (39 µm statt 80 µm) und laterale Auflösung (120 µm statt 200 µm), wodurch epidermale Effekte besser darstellbar sind.
Was passiert mit der Haut unter Okklusion?
Durch die Okklusion (Abdeckung der Haut) wird die Verdunstung verhindert, was zu einer erhöhten Hydratation und Quellung der oberen Hautschichten, insbesondere des Stratum Corneum, führt.
Welche Veränderungen wurden beim Eintrittsecho festgestellt?
Die Studie zeigt, dass sich das Eintrittsecho nach einer vierstündigen Okklusion signifikant verändert, während die gesamte Hautdicke und -dichte keine signifikanten Änderungen aufwiesen.
Welche Messgeräte wurden in der Studie verwendet?
Zur Messung der Hydratation wurde ein Corneometer CM 825 verwendet, während die sonographischen Aufnahmen mit einem 50 MHz-Ultraschallgerät der Firma taberna pro medicum erfolgten.
- Quote paper
- Sabine Stechel (Author), 2012, Untersuchungen zum Einfluss eines Okklusionstests auf die Echogenität der kutanen 50 MHz Sonographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/272132