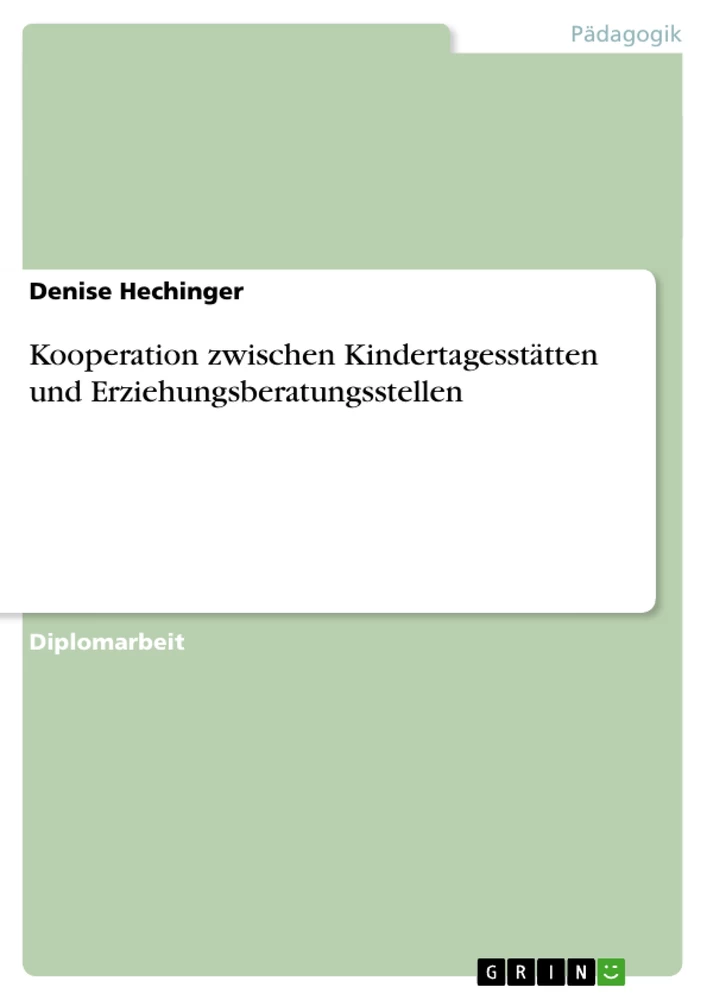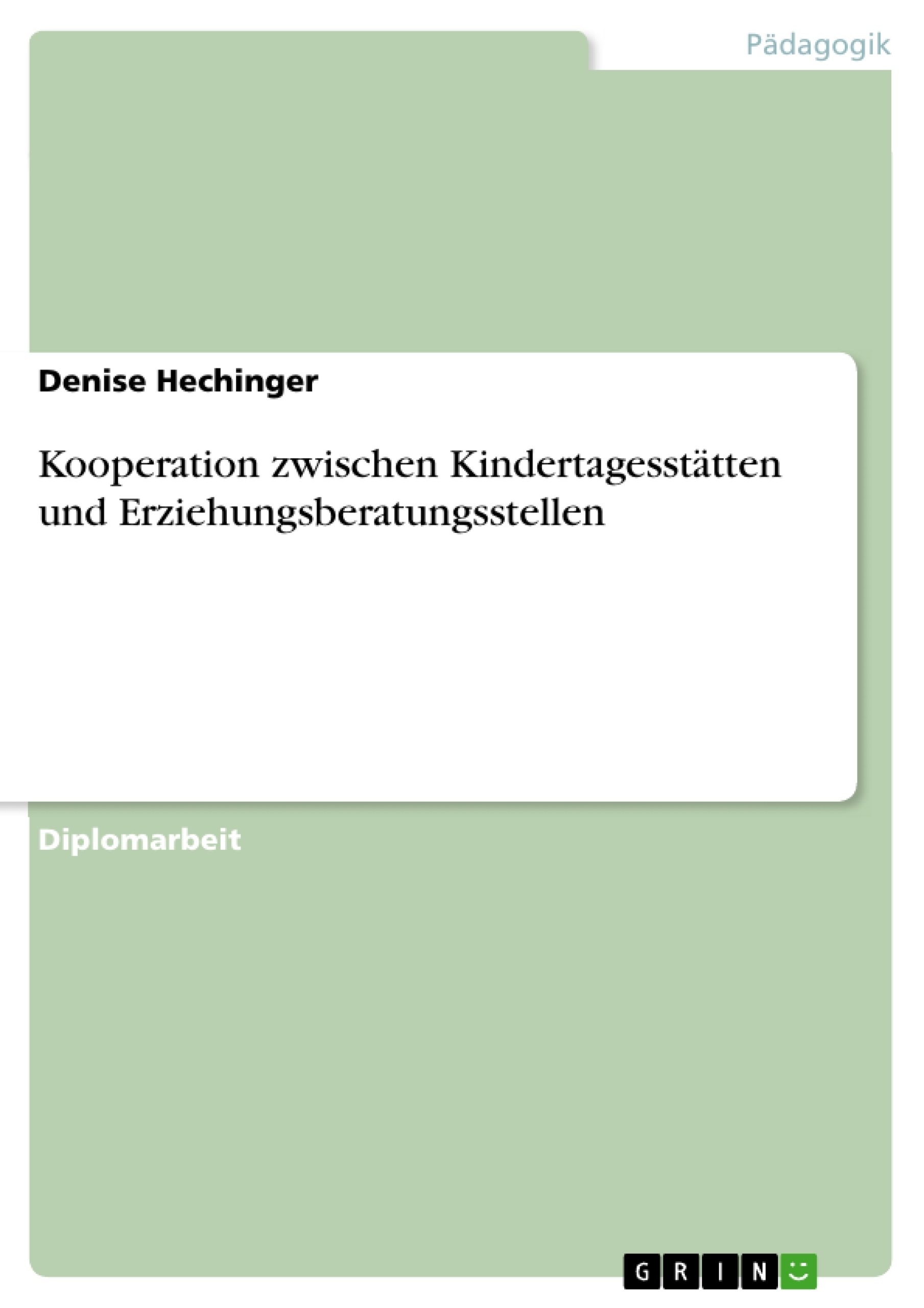Die vorliegende Diplomarbeit, die im Rahmen der Studienrichtung „Pädagogik der frühen
Kindheit“ erstellt wurde, beschäftigt sich mit der Kooperation von Kindertagesstätten
und Erziehungsberatungsstellen.
„Kooperation ist eine mit vielen positiven Erwartungen überladene Problemlösungsstrategie,
auf die in Politik, Wirtschaft und in der psychosozialen Arbeit gerne zurückgegriffen
wird, wenn komplexe Aufgaben bearbeitet werden müssen“ (Santen &
Seckinger 2003, 9). Solch einer komplexen Aufgabe stehen auch Erziehungsberatungsstellen
und Kindertagesstätten (kurz: Kitas) gegenüber, wenn es um die frühzeitige
Unterstützung von Kindern, Eltern und Familien in schwierigen Problemlagen geht. Die
Erziehungsberatung kann, trotz ihres niedrigschwelligen Angebots, nicht alle Eltern
erreichen, da der Gang zur Erziehungsberatung nach wie vor mit Vorurteilen besetzt
ist. Und die Fachkräfte der Kitas sind in ihrem Alltag schon soweit ausgelastet, dass
eine intensive Unterstützung von Familien in schwierigen Problemsituationen nicht
gewährleistet werden kann. Zudem verfügen Erzieherinnen1 häufig nicht über die entsprechenden
Kompetenzen, um die Eltern und Familien angemessen beraten zu können.
Angesichts dieser Voraussetzungen stellt die Kooperation von Kitas und Erziehungsberatungsstellen
eine Möglichkeit dar, Eltern mit Erziehungsschwierigkeiten oder
verhaltensauffälligen Kindern dennoch frühzeitige Unterstützung und die passende
Hilfe anbieten zu können. Denn durch die Zusammenarbeit beider Institutionen können
den Eltern niedrigschwelligere Angebote vor Ort, also in der Kita, gemacht werden
und die Erzieherinnen können durch die fachliche Unterstützung seitens der Erziehungsberatung
in ihrem Arbeitsalltag entlastet werden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aufzuzeigen, wie die Kooperation zwischen Kitas und
Erziehungsberatungsstellen gestaltet werden kann und wie sie in der Praxis umgesetzt
wird. Überdies wird sich sowohl auf theoretischer Ebene mit dem Thema der Kooperation
auseinandergesetzt als auch die Kooperationspraxis von Kitas und Erziehungsberatungsstellen empirisch untersucht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage und Begriffsbestimmungen
- Kooperation sozialer Dienste
- Kooperation, Koordination und Vernetzung
- Interinstitutionelle Kooperation
- Interinstitutionelle Kooperation in der Forschung
- Theorien und Ansätze aus der sozialpsychologischen Kooperationsforschung
- Theorie über Kooperation und Wettbewerb (Morton Deutsch)
- Wirkung aufgaben- und ichbezogener Ziele in Kooperationssituationen (Helen Lewis)
- Thesen zur Dynamik der Intergruppenforschung (Dieter Beck)
- Das Konfigurationsmodell nach van Santen und Seckinger
- Theorien und Ansätze aus der sozialpsychologischen Kooperationsforschung
- Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Erziehungsberatungsstellen
- Die Erziehungsberatung als Kooperationspartner
- Grundlagen
- Aktuelle Entwicklungen im Kontext der Kooperation
- Eignung der Erziehungsberatung als Kooperationspartner
- Die Kindertagesstätte als Kooperationspartner
- Gesetzliche Grundlagen
- Kooperation in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen
- Aktuelle Entwicklungen im Kontext der Kooperation
- Eignung der Kita als Kooperationspartner
- Ziele und Chancen der Kooperation
- Wege der Zusammenarbeit
- Beratungsangebote
- Präventive Angebote
- Sonstige Angebote
- Ausgewählte Modellprojekte zur Kooperationspraxis
- Praxisprojekt: Kindergarten und soziale Dienste
- ERIK (Erziehungshilfe, Rat und Information im Kindergarten)
- Modellprojekt „Zugehende Beratung in Kindertageseinrichtungen“
- Die Erziehungsberatung als Kooperationspartner
- Qualitative Untersuchung zur Kooperationspraxis von Kitas und Erziehungsberatungsstellen
- Zielsetzung und Fragestellungen
- Untersuchungsdesign
- Datenerhebung mittels leitfadengestützter Experteninterviews
- Entwicklung der Interviewleitfäden
- Auswahl der Experten
- Durchführung der Experteninterviews
- Datenaufbereitung und -auswertung
- Transkription
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Gütekriterien qualitativer Forschung
- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- Kooperationsangebote
- Entstehung der Kooperation
- Ist-Zustand der Kooperation
- Veränderungen durch die Kooperation
- Bewertung der Kooperation
- Voraussetzungen gelingender Kooperation
- Wünsche
- Diskussion
- Diskussion zentraler Ergebnisse
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Kooperation zwischen Kindertagesstätten (Kitas) und Erziehungsberatungsstellen. Ziel ist es, die Gestaltung und praktische Umsetzung dieser Kooperation aufzuzeigen und theoretische Aspekte mit der Praxis zu verbinden. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Chancen dieser Zusammenarbeit für die Unterstützung von Kindern, Eltern und Familien.
- Theoretische Grundlagen der Kooperation
- Analyse der Rollen von Kitas und Erziehungsberatungsstellen
- Praktische Umsetzung und Herausforderungen der Kooperation
- Erfolgsfaktoren und Chancen der Zusammenarbeit
- Auswertung empirischer Daten zur Kooperationspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Erziehungsberatungsstellen ein und begründet die Relevanz der Thematik vor dem Hintergrund der Herausforderungen bei der frühzeitigen Unterstützung von Kindern, Eltern und Familien in schwierigen Situationen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Gestaltung und praktische Umsetzung der Kooperation und verbindet theoretische Überlegungen mit empirischen Befunden.
Ausgangslage und Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Kooperation, Koordination und Vernetzung im Kontext sozialer Dienste. Es legt den Fokus auf interinstitutionelle Kooperationen und definiert den Rahmen für die spätere Analyse der Kooperation zwischen Kitas und Erziehungsberatungsstellen.
Interinstitutionelle Kooperation in der Forschung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Theorien und Ansätze der sozialpsychologischen Kooperationsforschung, wie die Theorien von Morton Deutsch, Helen Lewis und Dieter Beck, um ein theoretisches Fundament für das Verständnis von Kooperationsprozessen zu schaffen. Das Konfigurationsmodell von van Santen und Seckinger wird als analytisches Werkzeug vorgestellt.
Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Erziehungsberatungsstellen: Dieses Kapitel untersucht die Rollen von Kitas und Erziehungsberatungsstellen als Kooperationspartner. Es beleuchtet die rechtlichen und pädagogischen Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und die Eignung beider Institutionen für eine Zusammenarbeit. Ziele, Chancen und verschiedene Wege der Zusammenarbeit werden detailliert dargestellt, inklusive Beispiele aus der Praxis (Modellprojekte).
Qualitative Untersuchung zur Kooperationspraxis von Kitas und Erziehungsberatungsstellen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik einer qualitativen Studie zur Kooperationspraxis. Es erläutert die Forschungsfrage, das Untersuchungsdesign, die Datenerhebung (Experteninterviews), die Datenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) und die Berücksichtigung von Gütekriterien qualitativer Forschung.
Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Studie. Es analysiert verschiedene Aspekte der Kooperation, wie Kooperationsangebote, Entstehung der Kooperation, den Ist-Zustand, Veränderungen durch die Kooperation, deren Bewertung, Voraussetzungen für gelingende Kooperation und die Wünsche der Beteiligten.
Schlüsselwörter
Kooperation, Kindertagesstätten, Erziehungsberatung, Interinstitutionelle Zusammenarbeit, frühe Kindheit, Familienhilfe, qualitative Forschung, Experteninterviews, pädagogische Kooperation, Modellprojekte, Elternarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Erziehungsberatungsstellen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Kooperation zwischen Kindertagesstätten (Kitas) und Erziehungsberatungsstellen. Sie analysiert die Gestaltung und praktische Umsetzung dieser Kooperation, verbindet theoretische Aspekte mit der Praxis und beleuchtet Herausforderungen und Chancen für die Unterstützung von Kindern, Eltern und Familien.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf sozialpsychologische Kooperationsforschung, inklusive der Theorien von Morton Deutsch, Helen Lewis und Dieter Beck. Das Konfigurationsmodell von van Santen und Seckinger dient als analytisches Werkzeug. Zusätzlich werden rechtliche und pädagogische Grundlagen der Zusammenarbeit von Kitas und Erziehungsberatungsstellen beleuchtet.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer qualitativen Studie mit leitfadengestützten Experteninterviews. Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Gütekriterien qualitativer Forschung wurden berücksichtigt.
Wer waren die Interviewpartner?
Die Studie umfasst Experteninterviews mit Personen aus Kindertagesstätten und Erziehungsberatungsstellen. Die Auswahl der Experten wird in der Arbeit detailliert beschrieben.
Welche Aspekte der Kooperation werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte der Kooperation, darunter Kooperationsangebote, Entstehung der Kooperation, den Ist-Zustand, Veränderungen durch die Kooperation, deren Bewertung, Voraussetzungen für gelingende Kooperation und die Wünsche der Beteiligten. Ausgewählte Modellprojekte werden ebenfalls vorgestellt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der qualitativen Studie werden im Kapitel „Darstellung und Interpretation der Ergebnisse“ detailliert präsentiert und interpretiert. Sie geben Aufschluss über die Praxis der Kooperation zwischen Kitas und Erziehungsberatungsstellen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit diskutiert die zentralen Ergebnisse und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Handlungsempfehlungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kooperation, Kindertagesstätten, Erziehungsberatung, Interinstitutionelle Zusammenarbeit, frühe Kindheit, Familienhilfe, qualitative Forschung, Experteninterviews, pädagogische Kooperation, Modellprojekte, Elternarbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Ausgangslage und Begriffsbestimmungen, interinstitutioneller Kooperation in der Forschung, der Kooperation zwischen Kitas und Erziehungsberatungsstellen, die qualitative Untersuchung, die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse sowie eine Diskussion mit Ausblick.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Diplomarbeit enthält detaillierte Informationen zu allen Aspekten der Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Erziehungsberatungsstellen.
- Quote paper
- Denise Hechinger (Author), 2013, Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Erziehungsberatungsstellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/271584