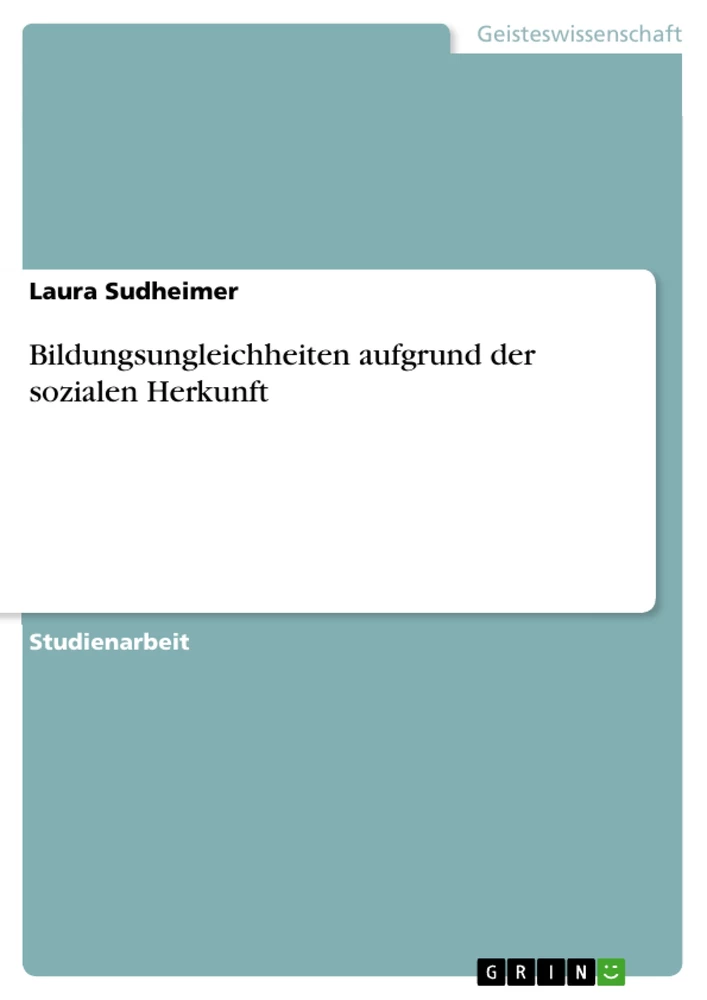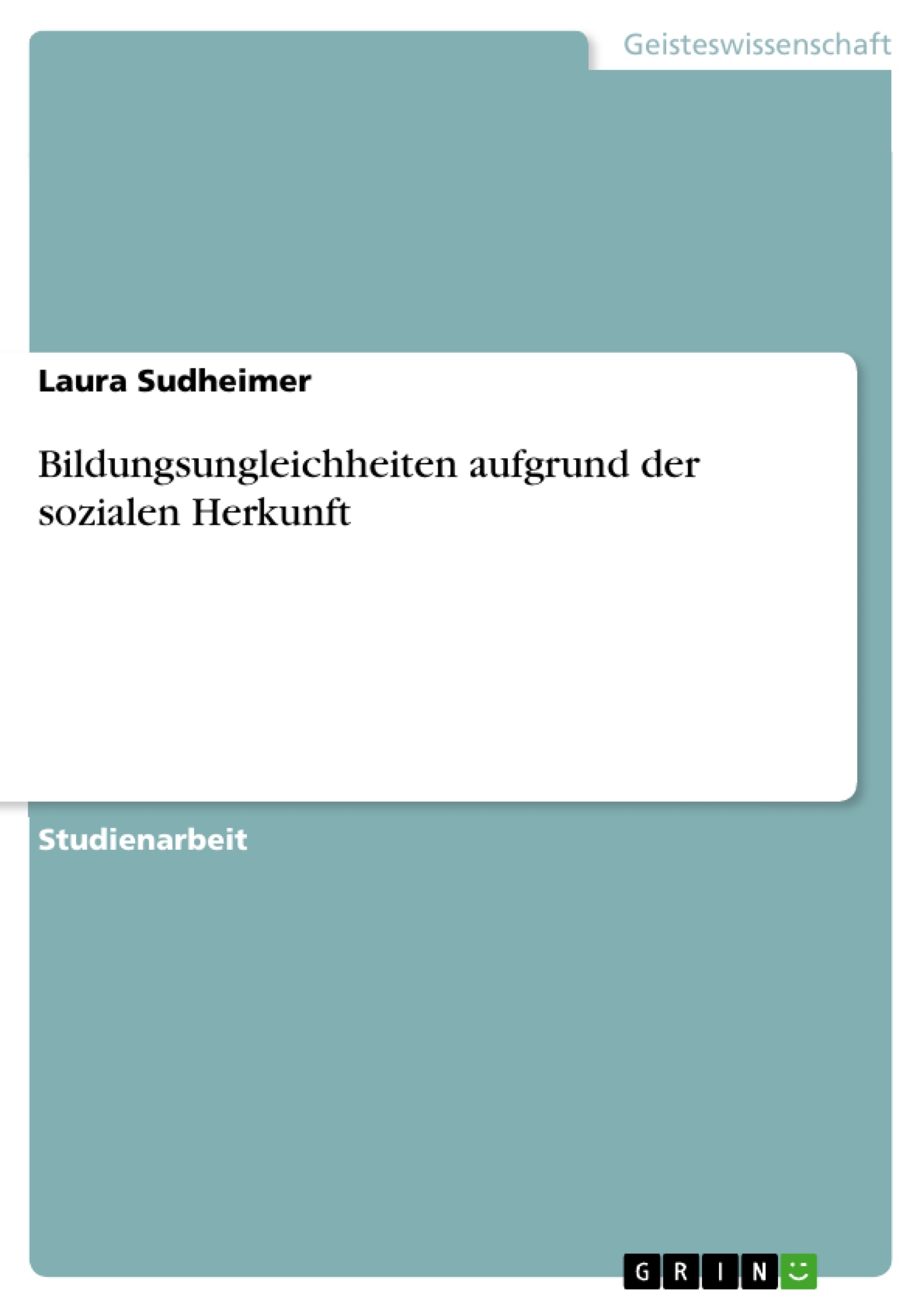Immer wieder wird in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, ob und inwiefern die soziale Herkunft sich auf die Bildungschancen von Schüler/innen auswirkt und somit Ungleichheiten hervorruft.
Die Diskussion begann in Deutschland, wie auch in vielen anderen modernen Gesellschaften, in den 1960er Jahren. Damals existierten Bildungsungleichheiten im deutschen Bildungssystem vor allem aufgrund des Geschlechts, was mittlerweile an Brisanz verloren hat, da Mädchen bis zum Erreichen des ersten Abschlusses die Jungen prozentual überholt haben.1 Das Bildungssystem sollte in Deutschland durch eine Bildungsexpansion verbessert werden. Die Ziele waren vor allem eine höhere Partizipation an Bildung, der Ausbau vom deutschen Bildungssystem und die Ausweitung von Bildungsangeboten für alle Kinder, unabhängig von Geschlecht oder sozialen Herkunft. Es sollten keine Bildungsdefizite wegen der Ungleichverteilung von Bildungsangeboten oder den gegebenen Ressourcen von Schulkindern und deren Eltern, Einfluss auf den Bildungsverlauf und den Erwerb von Bildungszertifikaten entstehen.2
Seit der ersten Pisa-Studie im Jahr 2000, in der den deutschen Schülern schlechte Leistungen im internationalen Vergleich nachgewiesen wurden, gewinnt die Debatte jedoch wieder an gesellschaftspolitischer Relevanz.
Nun lag der Fokus nicht auf Bildungsungleichheiten hervorgerufen durch das Geschlecht, sondern auf Bildungsungleichheuten aufgrund der sozialen Herkunft. Die Bundesrepublik ist im Laufe der Jahre im Zuge der politischen Veränderungen im Land zu einem Einwanderungsland geworden. Die Bevölkerung wurde mit vielen verschiedenen Nationalitäten durchmischt, die mittlerweile in der zweiten bzw. dritten Generation in Deutschland leben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Soziale Ungleichheit, Bildung, Bildungsungleichheit
- Soziale Herkunft
- Kriterien von Bildungsungleichheiten
- Bildungsniveau der Herkunftsfamilie
- Institutionelle Barrieren
- Einkommen
- Migrationshintergrund
- Veränderte Familienformen
- Räumliche und Soziale Trennung
- Folgen von Bildungsungleichheiten
- Theoretische Erklärungsversuche
- Erklärungsversuch nach Boudon
- Kapitalbegriff nach Bourdieu
- Bildungsarmut und Humankapitalschwäche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungsungleichheiten. Ziel ist es, die zentralen Begriffe zu definieren und wesentliche Kriterien und Folgen von Bildungsungleichheiten aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet soziologische Erklärungsansätze, ohne diese jedoch im Detail zu vergleichen.
- Definition von sozialer Ungleichheit, Bildung und Bildungsungleichheit
- Kriterien für Bildungsungleichheiten (z.B. familiäres Bildungsniveau, institutionelle Barrieren)
- Folgen von Bildungsungleichheiten
- Soziologische Erklärungsansätze (Boudon, Bourdieu)
- Bildungsarmut und Humankapitalschwäche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bildungsungleichheiten aufgrund sozialer Herkunft ein und diskutiert die historische Entwicklung der Debatte in Deutschland, beginnend mit den Geschlechterungleichheiten der 1960er Jahre und der zunehmenden Bedeutung des Faktors soziale Herkunft nach der ersten PISA-Studie im Jahr 2000. Die Arbeit konzentriert sich auf die Fragestellung nach den Auswirkungen der sozialen Herkunft auf Bildungschancen und deren soziologischen Erklärungen.
Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel erläutert die zentralen Begriffe der Arbeit: Soziale Ungleichheit wird als ungleiche Verteilung von Ressourcen definiert, während Bildungsungleichheit als eine spezielle Form sozialer Ungleichheit verstanden wird, die sich auf den Zugang zu und den Erfolg im Bildungssystem bezieht. Der Begriff der sozialen Herkunft wird im soziologischen Kontext abgegrenzt und eingeordnet, wobei der Einfluss von Pierre Bourdieu hervorgehoben wird. Diese Definitionen legen die Grundlage für die Argumentation der gesamten Arbeit.
Kriterien von Bildungsungleichheiten: Hier werden verschiedene Kriterien identifiziert, die zu Bildungsungleichheiten beitragen. Dazu gehören das Bildungsniveau der Herkunftsfamilie, institutionelle Barrieren im Bildungssystem, Einkommensunterschiede, Migrationshintergrund, veränderte Familienformen und räumliche sowie soziale Segregation. Diese Kriterien werden als mögliche Ursachen für die Ungleichverteilung von Bildungschancen dargestellt und bilden die Grundlage für die weitere Analyse.
Folgen von Bildungsungleichheiten: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen von Bildungsungleichheiten, die aus den zuvor dargestellten Kriterien resultieren. Es wird detailliert auf die negativen Auswirkungen für betroffene Individuen und die Gesellschaft eingegangen, ohne konkrete Beispiele oder Zahlen zu nennen, die erst in späteren Kapiteln behandelt werden.
Theoretische Erklärungsversuche: In diesem Kapitel werden soziologische Erklärungsansätze für Bildungsungleichheiten skizziert. Die ökonomischen Ressourcen nach Boudon und der Kapitalbegriff nach Bourdieu werden kurz vorgestellt, um mögliche wissenschaftliche Erklärungen für die Entstehung von Bildungsungleichheiten aufzuzeigen. Ein ausführlicher Vergleich oder eine Gegenüberstellung dieser Ansätze erfolgt nicht, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Soziale Herkunft, Bildungssystem, Bourdieu, Boudon, Humankapital, Bildungsarmut, Institutionelle Barrieren, Segregation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Bildungsungleichheiten
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Bildungsungleichheiten aufgrund sozialer Herkunft. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Definition zentraler Begriffe, der Darstellung wichtiger Kriterien und Folgen von Bildungsungleichheiten sowie der Skizzierung soziologischer Erklärungsansätze (Boudon, Bourdieu).
Welche Begriffe werden definiert?
Die zentralen Begriffe umfassen soziale Ungleichheit (ungleiche Verteilung von Ressourcen), Bildungsungleichheit (spezielle Form sozialer Ungleichheit im Bildungssystem) und soziale Herkunft (im soziologischen Kontext definiert, mit Betonung des Einflusses von Pierre Bourdieu).
Welche Kriterien für Bildungsungleichheiten werden genannt?
Zu den genannten Kriterien gehören das Bildungsniveau der Herkunftsfamilie, institutionelle Barrieren im Bildungssystem, Einkommensunterschiede, Migrationshintergrund, veränderte Familienformen und räumliche sowie soziale Segregation.
Welche Folgen von Bildungsungleichheiten werden behandelt?
Das Dokument beschreibt die negativen Auswirkungen von Bildungsungleichheiten auf Individuen und die Gesellschaft, ohne jedoch konkrete Beispiele oder Zahlen zu nennen. Diese werden vermutlich in weiterführenden Kapiteln behandelt (die hier nur zusammengefasst sind).
Welche soziologischen Erklärungsansätze werden vorgestellt?
Es werden die ökonomischen Ressourcen nach Boudon und der Kapitalbegriff nach Bourdieu kurz vorgestellt. Ein detaillierter Vergleich dieser Ansätze findet jedoch nicht statt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Soziale Herkunft, Bildungssystem, Bourdieu, Boudon, Humankapital, Bildungsarmut, Institutionelle Barrieren und Segregation.
Wie ist der Aufbau des Dokuments?
Das Dokument ist strukturiert in Einleitung, Begriffsdefinitionen, Kriterien von Bildungsungleichheiten, Folgen von Bildungsungleichheiten, Theoretische Erklärungsversuche und Fazit (implizit im Schlüsselwort-Abschnitt). Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, den Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungsungleichheiten zu untersuchen, zentrale Begriffe zu definieren und wesentliche Kriterien und Folgen von Bildungsungleichheiten aufzuzeigen. Soziologische Erklärungsansätze werden beleuchtet, jedoch nicht detailliert verglichen.
Gibt es einen Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze?
Nein, ein ausführlicher Vergleich der soziologischen Erklärungsansätze (Boudon und Bourdieu) findet nicht statt. Die Ansätze werden nur kurz skizziert.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument ist aufgrund seines akademischen Inhalts und der Fokussierung auf soziologische Theorien vermutlich für Studenten, Wissenschaftler und alle Interessierten im Bereich der Bildungsforschung und Soziologie gedacht.
- Quote paper
- Laura Sudheimer (Author), 2013, Bildungsungleichheiten aufgrund der sozialen Herkunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/271044