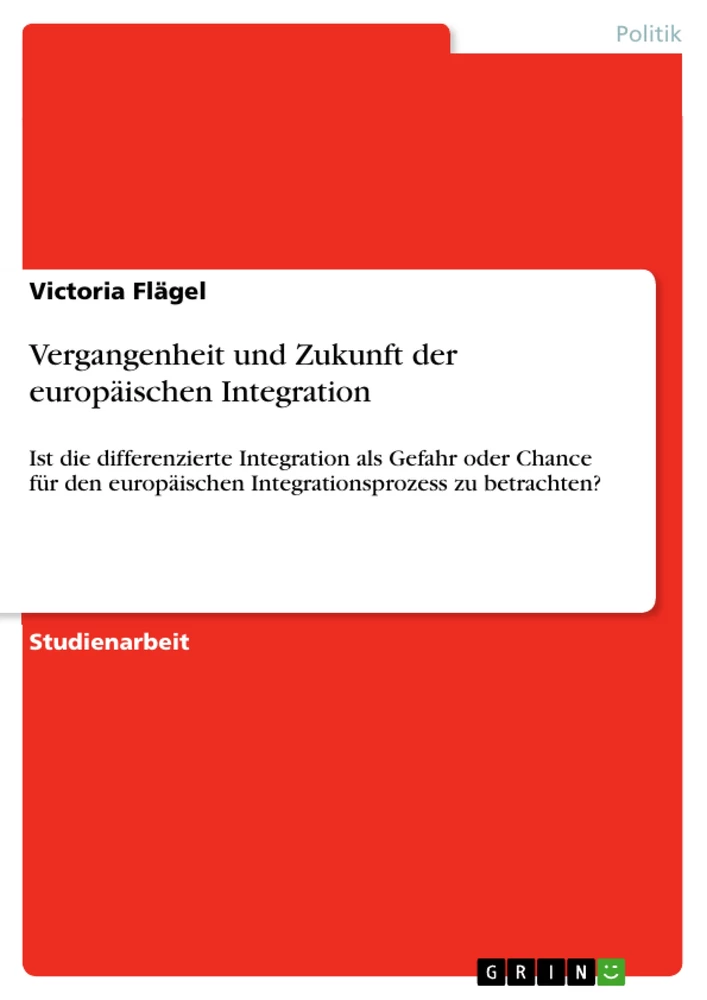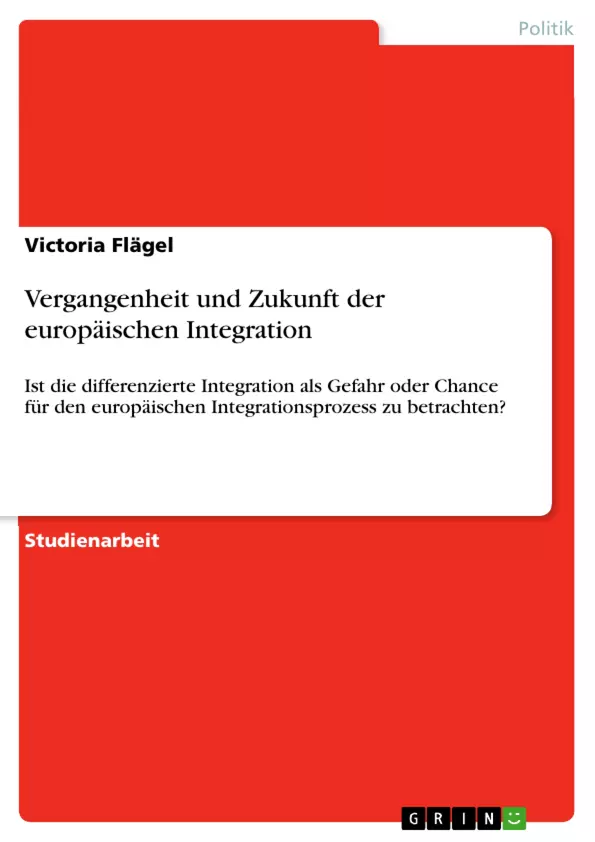Die EU ist ein politisches System sui generis, ein politisches System, welches keinen historischen Vorläufer hat und mit nichts bisher Dagewesenem zu Genüge verglichen oder analysiert werden könnte. Aus einer wirtschaftlichen Gemeinschaft von sechs Staaten, dessen Aufgabenbereich
sich auf die Produktion von Kohle und Stahl beschränkte, entwickelte sich eine politische Union aus mittlerweile 27 Staaten mit staatsähnlichen Befugnissen. Die Entwicklung von der Montanunion bis zur heutigen EU war begleitet von zahlreichen Vertragsänderungen, wie der Einheitlichen Europäischen Akte 1986, den Verträgen von Maastricht 1992, Amsterdam
1997, Nizza 2000 und Lissabon 2007. Die institutionellen und prozessualen Änderungen versuchten stets die wachsende Anzahl der Mitgliedstaaten, d. h. die stete Erweiterung mit der gleichzeitigen Vertiefung dieser wirtschaftlichen und politischen Gemeinschaft in Einklang zu bringen. So könnten einige institutionelle Veränderungen durch die Verträge von Lissabon als Entgegnung auf die immer lauter werdenden Vorwürfe eines Legitimations- und Demokratiedefizits der EU gedeutet werden.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird auf verschiedene, deskriptive Integrationstheorien eingegangen, welche sich mit der Frage beschäftigen, wie und wieso unabhängige Nationalstaaten im Laufe der Zeit immer mehr von ihrer Souveränität und immer mehr Kompetenzen auf eine höhere, supranationale Instanz transferierten. Es wird hauptsächlich Augenmerk auf die klassischen Theorien Föderalismus, (Neo-)Funktionalismus und Intergouvernementalismus gelegt, wobei jeweils nur kurz auf deren Weiterentwicklungen eingegangen wird. Im zweiten Teil werden verschiedene normative Modelle erläutert, welche
jeweils die Frage beantworten, was für ein Europa es in Zukunft geben soll, wohin zukünftig integriert werden soll, welche Art Union wünschenswert ist. Am Anfang wird die differenzierte Integration näher beschrieben, woraufhin die vier populärsten Modelle, welche durch die Idee der differenzierten Integration entstanden, - das „Europa der mehreren Geschwindigkeiten“, das „Europa der konzentrischen Kreise“, das „Europa der variablen Geometrie“ und das „Europa á la carte“ - erläutert werden. Im folgenden Teil werden zwei Beispiele der Methode der differenzierten Integration aufgeführt. Die beiden Beispiele werden jeweils in die vorher behandelten Integrationskonzeptionen eingeordnet, knapp mittels der Integrationstheorien analysiert und ihr Erfolg bewertet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Integrationstheorien
2.1 Der Föderalismus
2.2 Der (Neo-) Funktionalismus
2.3 Der Intergouvernementalismus
3. Welches Europa? Konzepte der Integration
3.1 Differenzierte Integration und Verstärkte Zusammenarbeit
3.2 Das „Europa der mehreren Geschwindigkeiten“
3.3 Das „Europa der konzentrischen Kreise“
3.4 Das „Europa der variablen Geometrie“
3.5 Das „Europaäla carte“
4. Beispiele differenzierter Integration
4.1 Die europäische Währungsunion
4.2 Das Schengener Abkommen
5. Fazit
Anhang I
Anhang II
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Victoria Flägel (Autor:in), 2012, Vergangenheit und Zukunft der europäischen Integration, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/269264