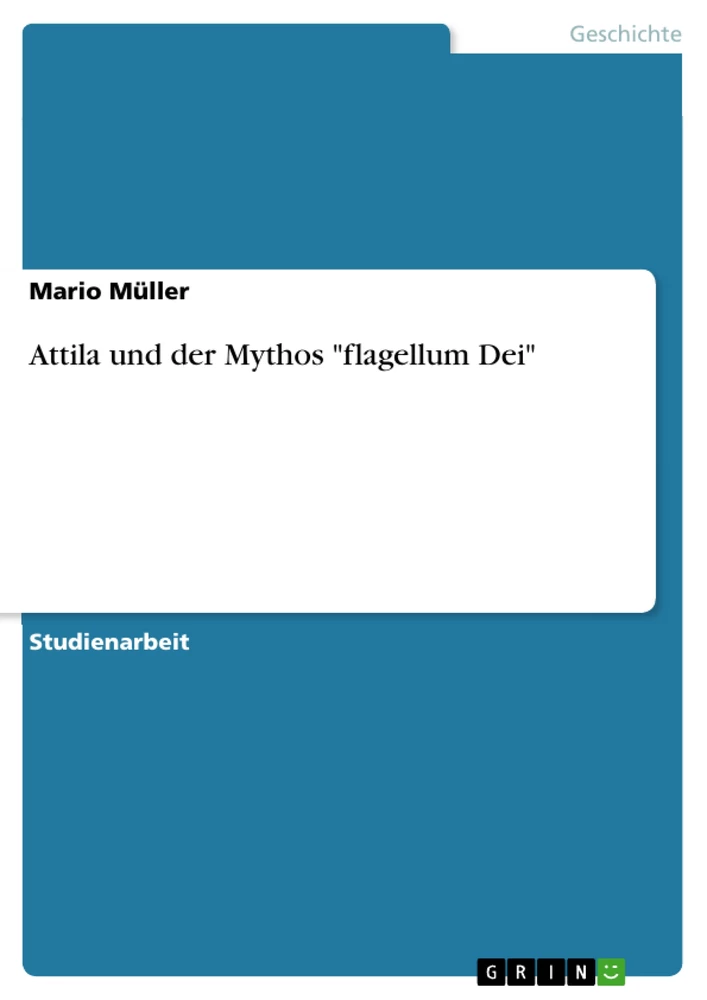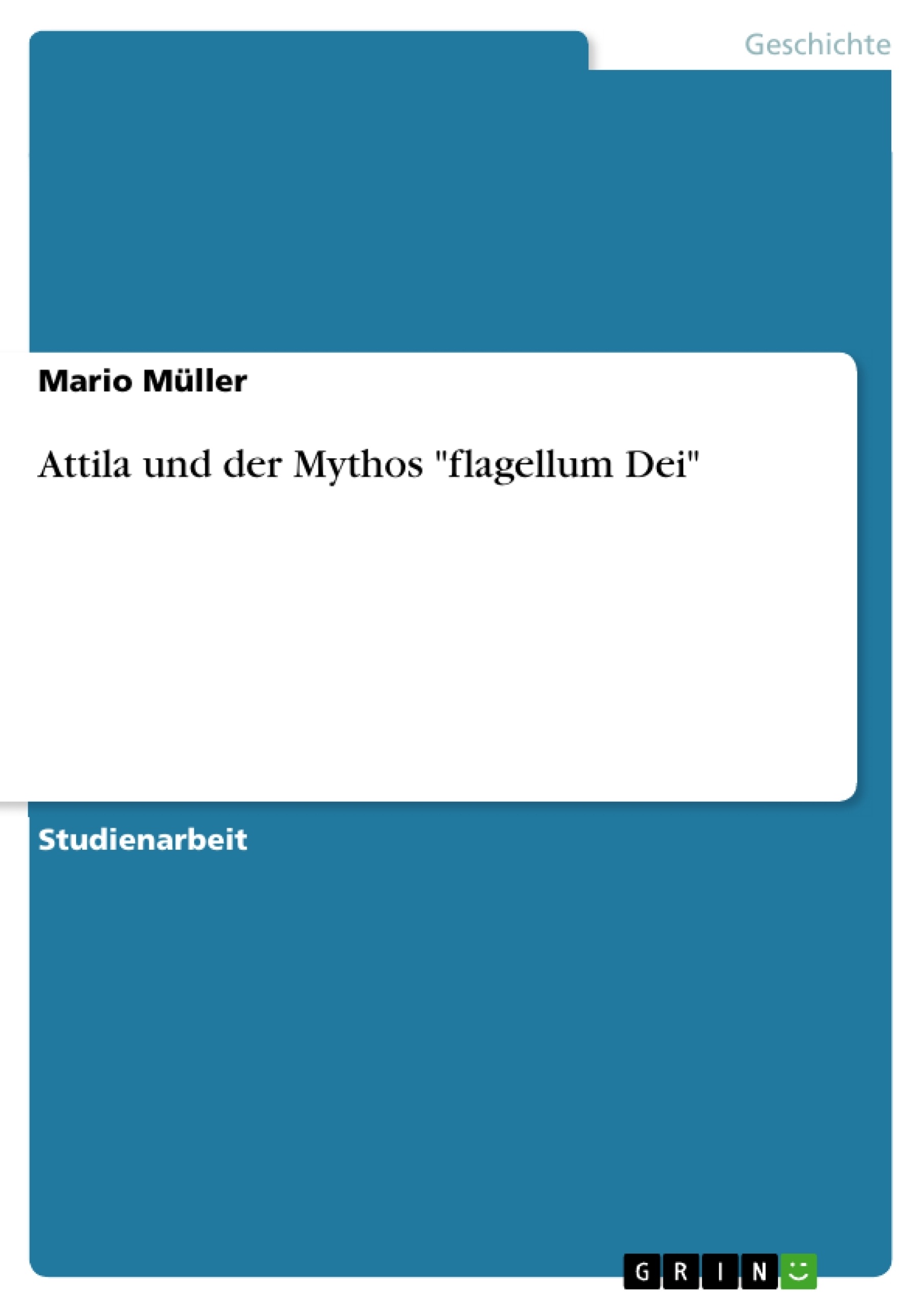In der vorliegenden Arbeit soll die Entstehung des negativen Attilabildes anhand der frühen Quellen zu seiner Person untersucht und eine sich steigernde verleumdende Tendenz dargestellt werden, an deren Ende die Bezeichnung „Geißel Gottes“ stand. Dabei werden ausgewählte Zeugnisse unter Berücksichtigung der zentralen Fragestellung zitiert und im Abgleich zueinander analysiert. Weiter werden die entsprechenden antiken beziehungsweise mittelalterlichen Autoren kurz biographisch vorgestellt, mit besonderem Augenmerk auf deren Bezug zum Christentum.
Zu Beginn wird ein schemenhafter Überblick über die wissenschaftliche Literatur und die verwendeten Quellen, die für das vorliegende Thema relevant sind, gegeben (I). Da ein Herrscherbild immer im Kontext der Handlungen und Taten einer jeweiligen historischen Person steht, ist es nötig, zu Beginn der Untersuchung kurz einen biographischen Abriss von Attilas Leben zu skizzieren (II) – auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Studien. Folgend wird der Frage nach dem Ursprung der abschätzigen Hunnendarstellung nachgegangen und anschließend werden verschiedene antike Autorenmeinungen über Attila wiedergegeben und kritisch hinterfragt (III). Schlussendlich steht eine punktuelle Richtigstellung des historischen Geschehens an, das heißt, dass dem Mythos auf der Grundlage der neuesten Forschungsergebnisse die sakrale Relevanz genommen wird (IV).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Literatur- und Quellenlage
- II. Biographischer Abriss
- III. Das Hunnen- und Attilabild in den spätantiken und frühmittelalterlichen Quellen
- III.1 Das Hunnenbild des Ammianus Marcellinus
- III.2 Das Attilabild des Jordanes
- III.3 Gregor von Tours und das christliche Attilabild
- III.4 Attila und die Hunnen als Gog und Magog und „flagellum Dei“
- IV. Die positive Seite der „Geißel Gottes“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des negativen Bildes Attilas in frühmittelalterlichen und spätantiken Quellen und analysiert die steigernde Verleumdung, die letztlich zur Bezeichnung als „Geißel Gottes“ führte. Die Analyse basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit ausgewählten Quellen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Autoren und ihres Bezugs zum Christentum.
- Analyse des negativen Attilabildes in den Quellen
- Untersuchung der Entwicklung der Bezeichnung „flagellum Dei“
- Kritische Betrachtung der antiken und frühmittelalterlichen Autoren und ihrer Perspektiven
- Einordnung des Attilabildes in den historischen Kontext
- Hinterfragung der sakralen Relevanz des Mythos
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die historische Figur Attilas als sowohl bekannt als auch stark diffamiert vor. Sie betont Attilas Einfluss auf den Untergang des Weströmischen Reiches und die bis heute anhaltende negative Rezeption seines Images, insbesondere die Bezeichnung als „Geißel Gottes“, die in verschiedenen Publikationen und Filmen aufgegriffen wurde. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Entstehung dieses negativen Bildes anhand früher Quellen an, wobei eine steigernde verleumderische Tendenz dargestellt und ausgewählte Zeugnisse im Abgleich analysiert werden sollen.
I. Literatur- und Quellenlage: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wissenschaftliche Literatur und die verwendeten Quellen zum Thema der Hunnen und Attila. Trotz der ungünstigen Quellenlage (Fehlen hunnischer Zeugnisse), wird auf eine breite, wenn auch überschaubare, wissenschaftliche Literatur hingewiesen, wobei aktuelle und ältere, aber dennoch relevante Werke namhafter Historiker genannt werden. Die antiken Quellen, die für die Fragestellung relevant sind, werden chronologisch aufgelistet, beginnend mit Ammianus Marcellinus, Jordanes, Gregor von Tours und Isidor von Sevilla.
II. Biographischer Abriss: Dieses Kapitel skizziert einen kurzen biographischen Abriss von Attilas Leben auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Studien. Da ein Herrscherbild immer im Kontext der Handlungen und Taten steht, bildet dieser Abriss die Grundlage für die spätere Analyse des Attilabildes in den Quellen.
III. Das Hunnen- und Attilabild in den spätantiken und frühmittelalterlichen Quellen: Dieser Abschnitt untersucht den Ursprung der abschätzigen Hunnendarstellung und analysiert die Meinungen verschiedener antiker Autoren über Attila kritisch. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven von Ammianus Marcellinus, Jordanes und Gregor von Tours beleuchtet, um ein differenziertes Bild der Quellenlage zu vermitteln und den Weg zur Bezeichnung als „Geißel Gottes“ nachzuvollziehen.
IV. Die positive Seite der „Geißel Gottes“: Dieses Kapitel widmet sich einer punktuellen Richtigstellung des historischen Geschehens. Auf der Grundlage neuester Forschungsergebnisse wird die sakrale Relevanz des Mythos von der „Geißel Gottes“ hinterfragt und differenzierter betrachtet, um ein ausgewogeneres Bild von Attila und seiner Herrschaft zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Attila, Hunnen, „flagellum Dei“, Geißel Gottes, Spätantike, Frühmittelalter, Quellenkritik, Herrscherbild, Ammianus Marcellinus, Jordanes, Gregor von Tours, Römisches Reich, negative Rezeption, historische Darstellung, Mythos.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Attila – Die „Geißel Gottes“?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des negativen Bildes Attilas in spätantiken und frühmittelalterlichen Quellen. Sie analysiert die steigernde Verleumdung, die letztlich zur Bezeichnung Attilas als „Geißel Gottes“ führte, und hinterfragt die sakrale Relevanz dieses Mythos.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit ausgewählten spätantiken und frühmittelalterlichen Quellen, darunter die Werke von Ammianus Marcellinus, Jordanes, Gregor von Tours und Isidor von Sevilla. Die Arbeit berücksichtigt die jeweiligen Autoren und ihren Bezug zum Christentum.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse des negativen Attilabildes in den Quellen, Untersuchung der Entwicklung der Bezeichnung „flagellum Dei“, kritische Betrachtung der antiken und frühmittelalterlichen Autoren und ihrer Perspektiven, Einordnung des Attilabildes in den historischen Kontext und Hinterfragung der sakralen Relevanz des Mythos.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Literatur- und Quellenlage, ein Kapitel mit einem biographischen Abriss Attilas, ein Kapitel zur Analyse des Hunnen- und Attilabildes in den Quellen, ein Kapitel zur „positiven Seite“ der „Geißel Gottes“ und ein Fazit. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter.
Welche Aspekte des Attilabildes werden besonders untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere die negative Darstellung Attilas in den Quellen, die Entwicklung der Bezeichnung „Geißel Gottes“ und die unterschiedlichen Perspektiven der antiken Autoren. Sie berücksichtigt auch den historischen Kontext und hinterfragt die sakrale Bedeutung des Mythos.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit wird in der HTML-Datei nicht explizit genannt. Es wird empfohlen, die vollständige Arbeit zu lesen, um das Fazit zu erfahren.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter: Attila, Hunnen, „flagellum Dei“, Geißel Gottes, Spätantike, Frühmittelalter, Quellenkritik, Herrscherbild, Ammianus Marcellinus, Jordanes, Gregor von Tours, Römisches Reich, negative Rezeption, historische Darstellung, Mythos.
Welche Art von Quellenlage wird beschrieben?
Die Arbeit beschreibt eine ungünstige Quellenlage, da es kaum hunnische Zeugnisse gibt. Sie stützt sich daher auf eine breite, wenn auch überschaubare wissenschaftliche Literatur und ausgewählte antike Quellen.
- Quote paper
- Mario Müller (Author), 2013, Attila und der Mythos "flagellum Dei", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/268662