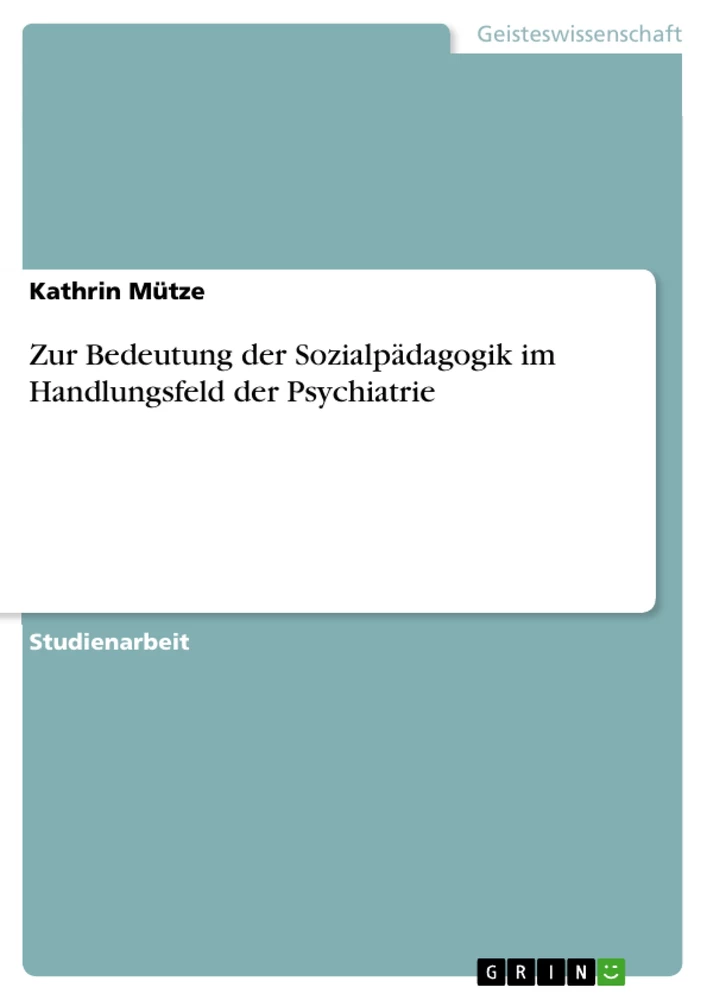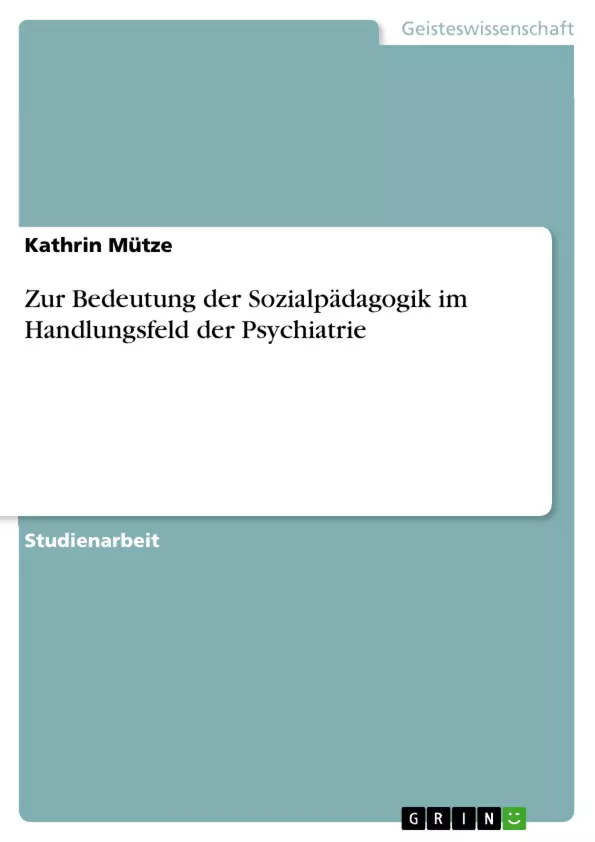„Die Psychiatrie ist keineswegs allein die Wissenschaft von der ärztlichen Behandlung seelischer Störungen“ (Clausen, Dresler, & Eichenbrenner 1997, Soziale Arbeit im Arbeitsfeld Psychiatrie, S.15), vielmehr sind psychische Krankheiten hinsichtlich ihres Doppelcharakters zu verstehen – als eine Form „gesellschaftlich stigmatisierter Abweichung von eingelebten alltäglichen Erwartungen und der vom psychisch kranken Menschen oft schmerzlich empfundenen Störungen seines Erlebens, Wahrnehmens, Denkens und Scheiterns seiner Bemühungen, vertrauten Kontakt zu anderen Menschen und zur Welt aufrechtzuerhalten.“ (von Kardorff 2005, S.1434) Anhand beider Zitate wird sehr schnell deutlich: das ärztlich-pflegerisch geprägte Gesundheitssystem gerät zunehmend an seine Grenzen. Auch der Bericht der Weltgesundheitsorganisation zur psychischen Gesundheit belegte anhand neuer wissenschaftlicher Forschungsergebnisse im Jahr 2001 sehr eindrücklich den engen Zusammenhang biologischer, psychischer und sozialer Prozesse und Strukturen in ihrer Bedeutung für die Gesundheit (vgl. WHO 2001). Vor diesem Hintergrund ist der aktuelle Fachdiskurs der Sozialen Arbeit zum Thema Psychiatrie zu verstehen, der mit seinem Plädoyer, mit der Klinischen Sozialarbeit eine neue Fachsozialarbeit zu entwickeln und zu systematisieren, dem Umstand Rechnung trägt, dass Sozialarbeit an der Behandlung von psychischen Krankheiten durch ihre Profession mitwirken kann und für eine „problemangemessene Behandlung immer bedeutsamer“ (Ansen 2011, S.796) wird. Kritiker der klinischen Sozialarbeit sehen dagegen in dieser Entwicklung einen Angriff auf die berufliche Identität, von der man sich letztlich nur erhoffe „mehr personale und gesellschaftliche Anerkennung zu finden als dies das ‚Grundständige‘ des Berufs biete“ (Crefeld 2002, S.24). Während der Auseinandersetzung mit diesem Diskurs kam die Frage auf, welchen theoretischen Beitrag die Sozialpädagogik im Arbeitsfeld der Psychiatrie tatsächlich leisten kann. Da es für den Umfang dieser Arbeit einer Eingrenzung bedarf, soll die Fragestellung auf ein Konzept heruntergebrochen werden. Im Rahmen mehrerer Seminare und auch in der eigenen praktischen Arbeit konnte das Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch kennengelernt werden, welches als „Votum gegen die Abstraktion und Generalisierung von Lebensverhältnissen“ (Thiersch et al. 2010, S.181) verstärkt das Interesse an einer differenzierteren Betrachtung geweckt hat. [...]
Inhalt
Einleitung
1. Klinische Sozialarbeit im Fachdiskurs
2. Das multiprofessionelle Handlungsfeld der Psychiatrie
2.1. Aufgabenbereiche von SozialpädagogInnen
3. Lebensweltorientierung nach Thiersch als originär sozialpädagogisches Konzept
3.1. Grundlagen lebensweltorientierten Handelns
3.2. Praxis lebensweltorientierter Sozialer Arbeit im Handlungsfeld der Psychiatrie
4. Fazit und Ausblick
5. Anhang
5.1. Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Master of Arts Kathrin Mütze (Autor:in), 2013, Zur Bedeutung der Sozialpädagogik im Handlungsfeld der Psychiatrie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/268542