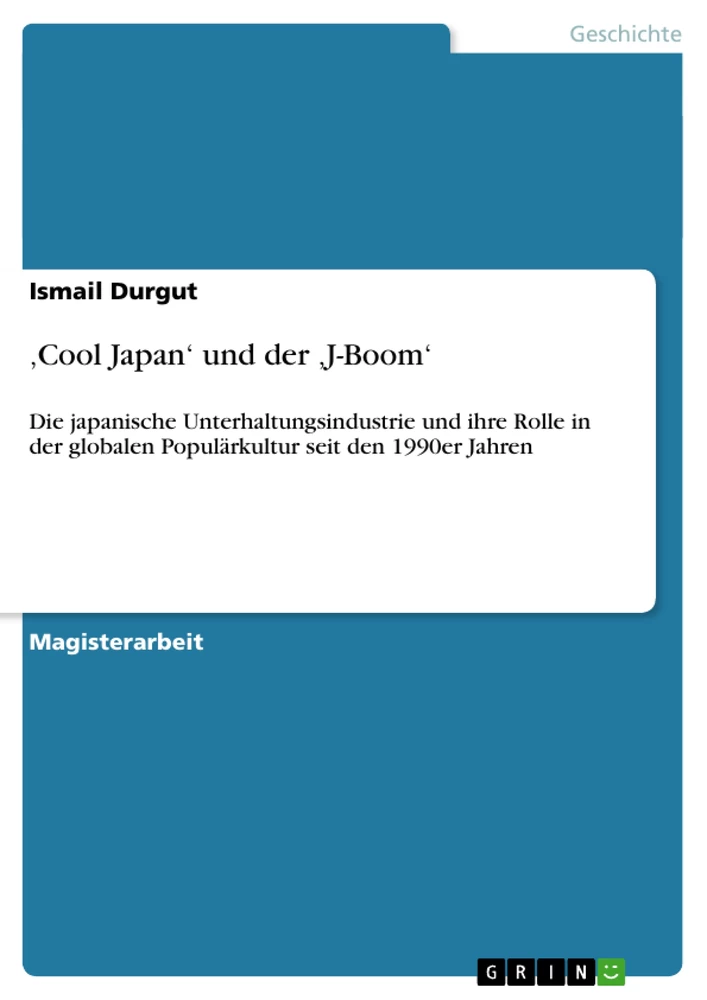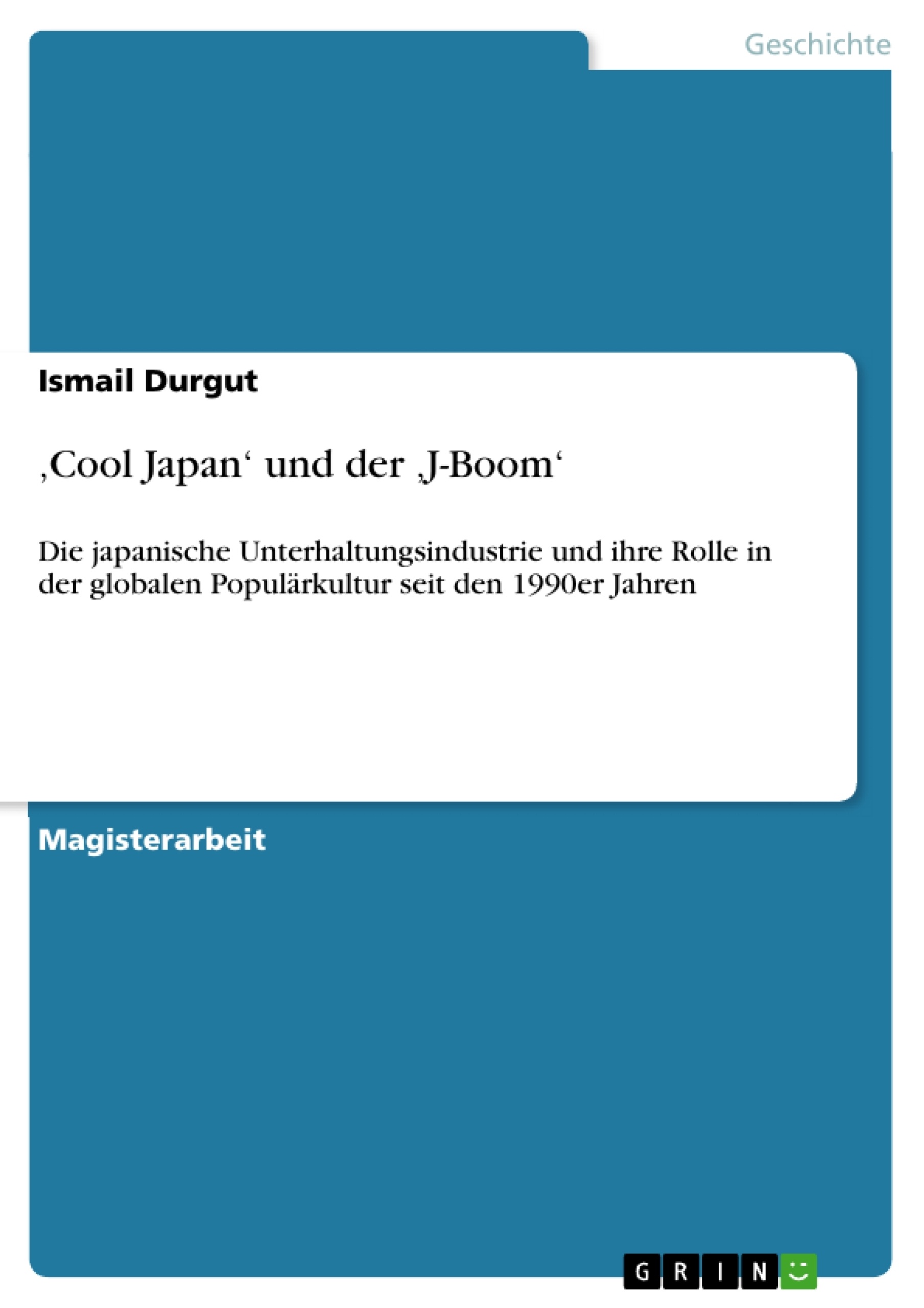Bis in die 1990er Jahre kannte ‚der Westen‘ zwei sehr unterschiedliche Gesichter Japans. Das eine war das traditionelle Japan, der ‚exotische ferne Osten‘, ein Land der schwertführenden Samurai, der Kimonos, der Geishas und des Zen-Buddhismus, dessen Faszination und Charme in seiner geographischen, zeitlichen und kulturellen Ferne zum ‚westlichen‘ Alltag lag. Das andere war ein modernes Japan, das zunächst als militärische und später ökonomische Macht seine Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen hatte. Für die globale Populärkultur spielte das Land jedoch kaum eine Rolle, abgesehen von den Fernsehern, Stereoanlagen, Kassettenrekordern und anderen elektrischen und elektronischen Geräten, die in höchster Qualität in Japan hergestellt wurden, um popkulturelle Medien aus Amerika, Großbritannien, Frankreich, Italien und anderen vorwiegend ‚westlichen‘ Ländern abzuspielen und diese zu Teilen unseres Alltags und unserer Erlebniswelt werden zu lassen. Obwohl die japanische Unterhaltungsindustrie in der Nachkriegszeit sehr lebhaft und auf den heimischen und zum Teil auf benachbarten Märkten kommerziell erfolgreich war, wussten im europäisch-amerikanischen Raum nur wenige davon. Im internationalen Bewusst-sein verharrte Japan als eine ernste Nation mit ernsten Menschen, die ihre traditionellen Künste pflegten und in der Wirtschaft modernste Methoden anwandten, jedoch kaum als eine Quelle für moderne Unterhaltung oder gar als Produktionsland nachgefragter Produkte der Kreativindustrie, die heute unzweifelhaft einen Teil unseres Alltags bilden.
Obwohl sich Japan in der sogenannten ‚verlorenen Dekade‘ der 1990er Jahre ökonomischen Schwierigkeiten und politischen Problemlagen gegenübersah, sowie 1995 zwei nationale Schockerlebnisse bewältigen musste – zum einen den durch die Aum-Sekte verübten Giftgasanschlag in der Tokioter U-Bahn, zum anderen das Erdbeben von Kobe –, konnte die japanische Unterhaltungsindustrie in den letzten zwei Jahrzehnten internationale Vermarktungserfolge in beachtlichem Ausmaß verzeichnen. Die Erfolge konnten sowohl in ökonomischer Hinsicht wie auch in symbolischem Kapital, das heißt als ‚Soft Power‘, verbucht werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konsum und Unterhaltung im 20. Jahrhundert
- 2.1 Die Konsumgesellschaft(en)
- 2.1.1 Merkmale der Konsumgesellschaft
- 2.1.2 Die Vereinigten Staaten von Amerika: Die erste Konsumgesellschaft der Welt
- 2.1.3 Westeuropa: Wirtschaftlicher Aufschwung und moderne Lebensweisen
- 2.1.4 Ostasien: Die Konsumgesellschaften Japans und Südkoreas und die Neureichen Chinas
- 2.2 Die Ökonomie der Unterhaltung
- 2.2.1 Unterhaltung im 20. Jahrhundert und die Medien
- 2.2.2 Kulturtransfer und Kulturimperialismus
- 2.2.3 Die Aufwertung der Pop- und Jugendkultur(en)
- 3. Die japanische Unterhaltungsindustrie
- 3.1 Film und Fernsehen
- 3.1.1 Der japanische (Real-)Film
- 3.1.2 Anime: Der japanische Animationsfilm
- 3.1.3 J-Dorama: „trendy“ Fernsehserien aus Japan
- 3.1.4 Japanische Gameshows
- 3.2 Bücher und Magazine
- 3.2.1 J-Bungaku: Zeitgenössische japanische Literatur
- 3.2.2 Manga: Der japanische Comic
- 3.3 J-Music
- 3.4 „Pop-Art“, Mode und Lifestyle
- 3.4.1 Murakami Takashi und die japanische „Pop-Art“
- 3.4.2 Mode und Lifestyle
- 3.5 Spielwaren
- 3.5.1 Kinderspielwaren
- 3.5.2 Video- und Computerspiele
- 3.6 Sport
- 4. Die globale Rezeption der japanischen Populärkultur seit den 1990er Jahren
- 4.1 „J-Culture“ auf dem US-amerikanischen Kulturmarkt
- 4.1.1 Anime und Manga in den USA
- 4.1.2 Die Zusammenarbeit zwischen japanischen und US-amerikanischen Unternehmen der Unterhaltungsindustrie
- 4.1.3 Der Einfluss der japanischen Populärkultur auf die US-amerikanische Unterhaltungsindustrie
- 4.1.4 Das US-amerikanische „Anime- und Manga-Fandom“
- 4.2 Europäische Rezeptionen, „hybrider“ und direkter Formen japanischer Popkultur
- 4.2.1 Anime in Westeuropa
- 4.2.2 Manga in Westeuropa
- 4.2.3 Europäisches „Fandom“ und „J-Culture“
- 4.3 Der „J-Boom“ in Ost- und Südostasien
- 4.3.1 Die Gründe für den asiatischen „J-Boom“
- 4.3.2 Formen der japanischen Populärkultur im ost- und südostasiatischen Raum
- 4.3.3 Der Einfluss der japanischen Populärkultur in Ost- und Südostasien
- 5. Die Governance der Unterhaltungsindustrie durch die japanische Regierung
- 5.1 „Soft Power“: die Bedeutung des globalen Handels mit kulturellen Gütern für die Politik
- 5.2 Die „Japan Brand“-Strategie und „Cool Japan“-Initiative der japanischen Regierung
- 5.3 Die Effekte der Governance durch die japanischen Regierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Entwicklung und den globalen Einfluss der japanischen Unterhaltungsindustrie seit den 1990er Jahren, insbesondere den Phänomen des „Cool Japan“ und des „J-Boom“. Die Arbeit analysiert die Faktoren, die zum internationalen Erfolg japanischer Popkultur beigetragen haben, und beleuchtet die Rolle der japanischen Regierung in diesem Prozess.
- Die Entwicklung der japanischen Unterhaltungsindustrie im 20. Jahrhundert
- Der Aufstieg von Anime, Manga und J-Pop als globale Phänomene
- Die Rezeption japanischer Popkultur in verschiedenen Regionen der Welt
- Die ökonomischen und politischen Aspekte des „Cool Japan“-Konzepts
- Der Einfluss der japanischen Regierung auf die globale Verbreitung der japanischen Popkultur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand vor: den Aufstieg der japanischen Unterhaltungsindustrie auf dem globalen Markt seit den 1990er Jahren. Sie kontrastiert das traditionelle Bild Japans im Westen mit dem neuen Image als Produzent von Popkultur und beschreibt den überraschenden Erfolg trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten in den 1990er Jahren. Der Fokus liegt auf dem Wandel des japanischen Images von einer vorwiegend industriellen und technologischen zu einer auch kulturell einflussreichen Nation. Die Einleitung legt den Grundstein für die weitere Analyse des „Cool Japan“-Phänomens und des „J-Boom“.
2. Konsum und Unterhaltung im 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Konsumgesellschaft und der Unterhaltungsindustrie im 20. Jahrhundert, wobei der Fokus auf den USA, Westeuropa und Ostasien liegt. Es werden die Merkmale der Konsumgesellschaft analysiert und der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum, technologischem Fortschritt und der Entwicklung neuer Unterhaltungsformen aufgezeigt. Die Kapitel analysiert den Kulturtransfer und den Kulturimperialismus im Kontext der globalen Verbreitung von Unterhaltungsprodukten. Insbesondere wird der Weg geebnet für das Verständnis der japanischen Unterhaltungsindustrie im globalen Kontext.
3. Die japanische Unterhaltungsindustrie: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Bereiche der japanischen Unterhaltungsindustrie, darunter Film, Fernsehen (Anime, J-Dorama), Literatur (Manga, J-Bungaku), Musik (J-Music), Mode, Spielwaren und Sport. Es beschreibt die spezifischen Merkmale und den Erfolg jedes Bereichs auf dem heimischen Markt und bereitet den Boden für die Analyse der globalen Verbreitung dieser kulturellen Produkte. Die vielfältigen Aspekte der japanischen Unterhaltungsindustrie werden detailliert dargestellt, um das ganzheitliche Bild des „J-Lifestyles“ zu liefern.
4. Die globale Rezeption der japanischen Populärkultur seit den 1990er Jahren: Dieses Kapitel untersucht die internationale Rezeption der japanischen Popkultur in den USA, Europa und Ost- und Südostasien. Es analysiert die Gründe für den Erfolg von Anime, Manga und anderen japanischen Unterhaltungsprodukten auf den jeweiligen Märkten und den Einfluss dieser Produkte auf die lokalen Kulturlandschaften. Der „J-Boom“ in Asien wird eingehend untersucht und die unterschiedlichen Formen der Rezeption und Adaption japanischer Popkultur in verschiedenen Regionen werden verglichen.
5. Die Governance der Unterhaltungsindustrie durch die japanische Regierung: Das Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der japanischen Regierung im Prozess der Globalisierung der japanischen Popkultur. Es analysiert die „Soft Power“-Strategie und die „Cool Japan“-Initiative und untersucht deren Auswirkungen auf die Verbreitung japanischer Kulturprodukte im Ausland. Der Einfluss staatlicher Maßnahmen auf den wirtschaftlichen und kulturellen Erfolg der japanischen Unterhaltungsindustrie wird kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Cool Japan, J-Boom, japanische Unterhaltungsindustrie, Anime, Manga, J-Pop, J-Music, globale Populärkultur, Konsumgesellschaft, Kulturtransfer, Soft Power, ökonomische Entwicklung, politische Strategien, globale Rezeption, Fandom.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Die japanische Unterhaltungsindustrie und ihr globaler Einfluss
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung und den globalen Einfluss der japanischen Unterhaltungsindustrie seit den 1990er Jahren, insbesondere die Phänomene „Cool Japan“ und „J-Boom“. Sie analysiert die Faktoren, die zum internationalen Erfolg japanischer Popkultur beigetragen haben, und beleuchtet die Rolle der japanischen Regierung in diesem Prozess.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der japanischen Unterhaltungsindustrie im 20. Jahrhundert, den Aufstieg von Anime, Manga und J-Pop als globale Phänomene, die Rezeption japanischer Popkultur in verschiedenen Regionen der Welt, die ökonomischen und politischen Aspekte des „Cool Japan“-Konzepts und den Einfluss der japanischen Regierung auf die globale Verbreitung der japanischen Popkultur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den Forschungsgegenstand vor und beschreibt den Wandel des japanischen Images. Kapitel 2 (Konsum und Unterhaltung im 20. Jahrhundert) bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Konsumgesellschaft und der Unterhaltungsindustrie. Kapitel 3 (Die japanische Unterhaltungsindustrie) analysiert verschiedene Bereiche der japanischen Unterhaltungsindustrie (Film, Fernsehen, Literatur, Musik, Mode, Spielwaren, Sport). Kapitel 4 (Globale Rezeption der japanischen Populärkultur) untersucht die internationale Rezeption in den USA, Europa und Ost- und Südostasien. Kapitel 5 (Governance der Unterhaltungsindustrie) konzentriert sich auf die Rolle der japanischen Regierung und die Strategien „Soft Power“ und „Cool Japan“.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cool Japan, J-Boom, japanische Unterhaltungsindustrie, Anime, Manga, J-Pop, J-Music, globale Populärkultur, Konsumgesellschaft, Kulturtransfer, Soft Power, ökonomische Entwicklung, politische Strategien, globale Rezeption, Fandom.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von einer Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte. Es folgen Kapitelzusammenfassungen und abschließend eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Regionen werden in Bezug auf die Rezeption japanischer Popkultur betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Rezeption japanischer Popkultur in den USA, Europa und Ost- und Südostasien.
Welche Rolle spielt die japanische Regierung in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Rolle der japanischen Regierung bei der Globalisierung der japanischen Popkultur, insbesondere durch die Strategien „Soft Power“ und „Cool Japan“, und deren Auswirkungen auf die Verbreitung japanischer Kulturprodukte.
Was ist der „J-Boom“ und „Cool Japan“?
„J-Boom“ bezeichnet den starken Anstieg der Popularität japanischer Popkultur in verschiedenen Regionen der Welt. „Cool Japan“ ist eine japanische Regierungsstrategie zur Förderung des Exports japanischer Kulturprodukte.
Welche Aspekte der japanischen Unterhaltungsindustrie werden detailliert untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert Film, Fernsehen (Anime, J-Drama), Literatur (Manga, J-Bungaku), Musik (J-Music), Mode, Spielwaren und Sport.
An wen richtet sich diese Arbeit?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die japanische Popkultur, globale Kulturphänomene und die Rolle der Regierung in der Kulturpolitik interessiert.
- Arbeit zitieren
- Ismail Durgut (Autor:in), 2013, ‚Cool Japan‘ und der ‚J-Boom‘, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/268432