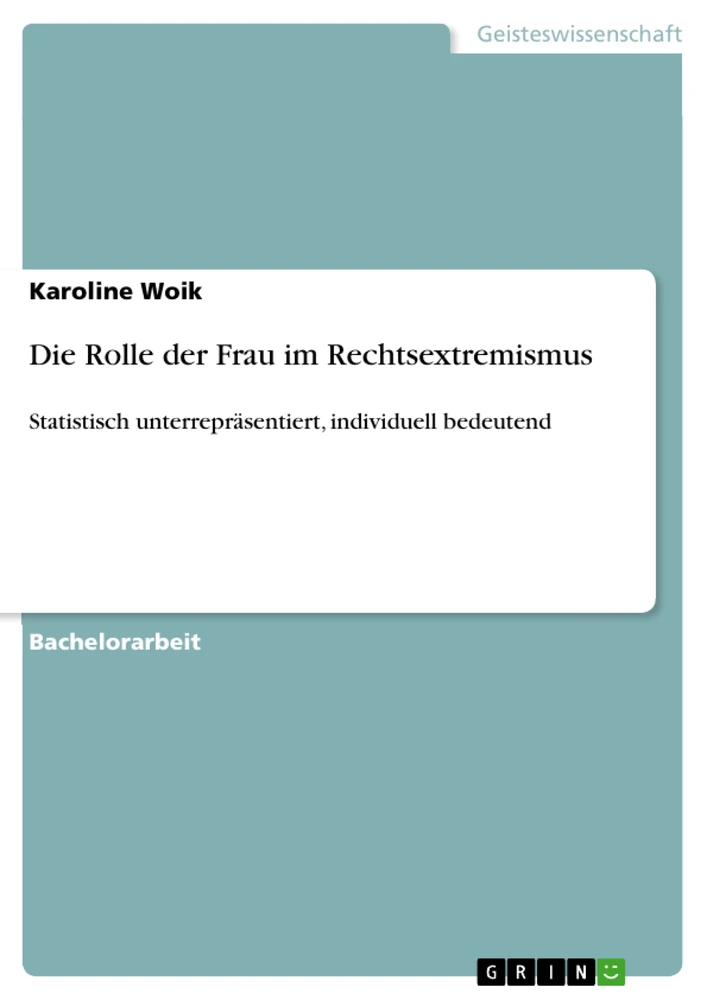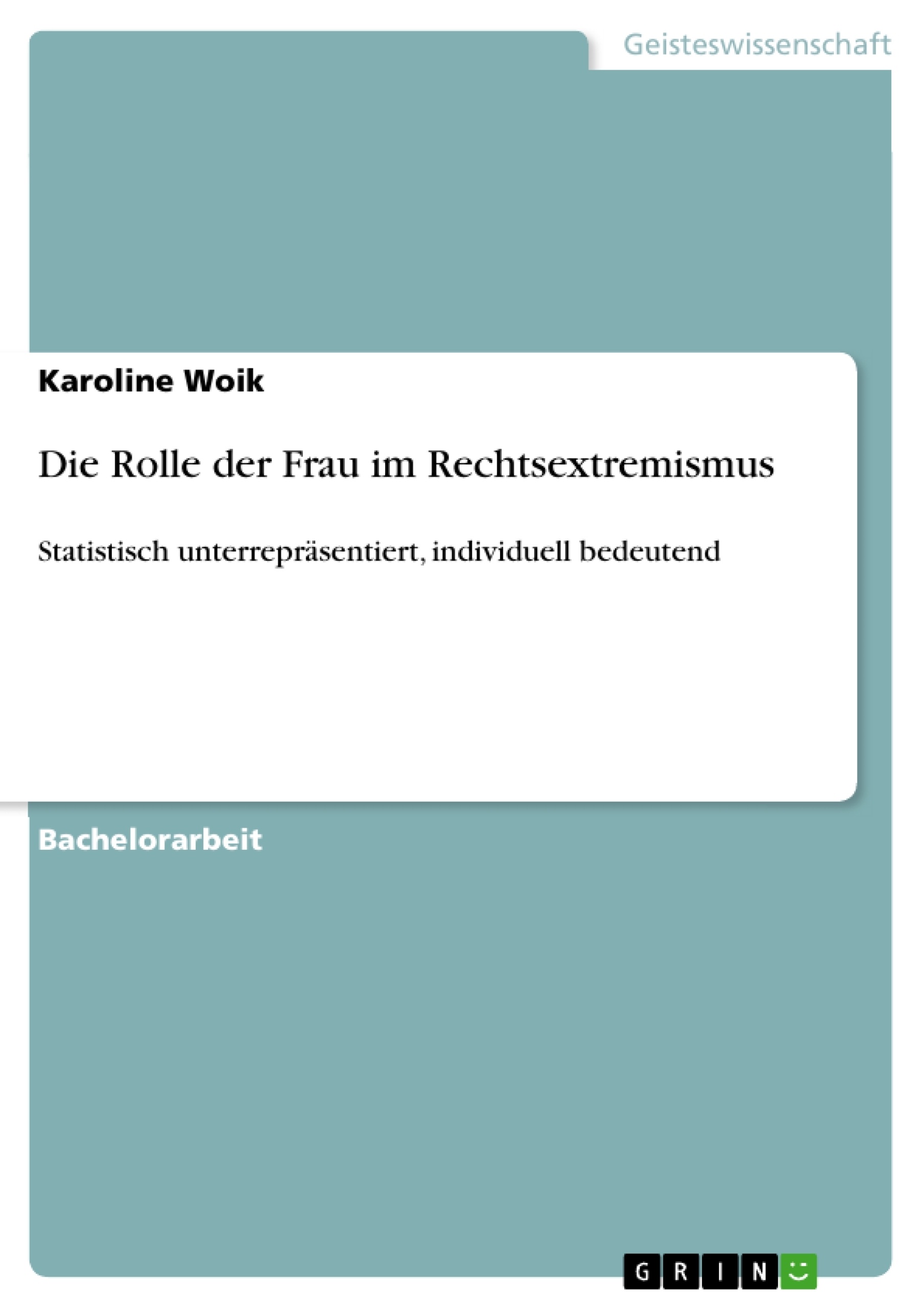Es war eine der mysteriösesten Mordserien Deutschlands: Neun Männer wurden regelrecht hingerichtet, nach gleichem Muster, immer durch Schüsse in den Kopf. Die Straftaten, Anschläge und Morde der Zwickauer Terrorzelle bestätigen: Deutschland hat ein Neonaziproblem. Die Rechtsextremisten dringen zunehmend in soziale Milieus der Mitte ein, zu denen sie früher kaum Zugang hatten. Aber woran kann das liegen? Hat die NPD so einen starken Imagewandel vollzogen, dass sie nun bei vielen Menschen als eine familienfreundliche, sozial engagierte und publikumsorientierte Partei gilt? Die Antwort liegt auf der Hand. Es ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer Strategie. Die Strategie lautet: gezieltes Einsetzen von Frauen als Machtmittel, um die rechtsextreme Ideologie in die Mitte zu tragen! Ist der moderne Rechtsextremismus demnach ohne Frauen nicht denkbar? Rechte Frauen werden vor allem als Mitläuferinnen wahrgenommen. Sie werden nach wie vor unterschätzt, obwohl fest steht, dass Rechtsextremismus nicht mehr nur noch Männersache ist. Zunehmend drängen auch etliche Frauen in die scheinbar männerdominierte Szene. Aber welche Aufgaben übernehmen die Frauen und wie prägen sie die Neonazi-Szene? Agieren sie nur hinter den Kulissen und entziehen sich somit unserem Blickfeld oder wollen sie ihre politischen Ziele direkt an der Seite der Männer umsetzen? Auch am Fall Beate Zschäpe wird deutlich, dass die Rolle von weiblichen Neonazis bislang nicht richtig eingeschätzt wurde. In den Medien und der Öffentlichkeit dominiert das Bild des rechtsextremen Mannes. Die Existenz von weiblichen Aktivistinnen wird weitgehend ignoriert. Dabei sind sie nicht weniger rassistisch und fremdenfeindlich. Das medial vermittelte Bild von Neonazi-Frauen als unpolitische Mitläuferinnen führt zu einer Verharmlosung ihrer Rolle. Obwohl es vor allem sie sind, die die Szene organisieren und stabilisieren. Vor dem beschriebenen Hintergrund soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit anhand von Sekundärliteratur und veröffentlichten Studien untersucht werden, wieweit der Einfluss von rechtsextremen Frauen reicht. Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit ist, dass mittlerweile die NPD erkannt hat, dass die weiblichen Mitglieder als „Aushängeschilder“ ihrer Partei enorm wichtig sind. Woraus die neue Strategie der NPD wächst. Eine die noch sehr gefährlich werden kann: Die NPD scheint immer mehr mit Köpfchen zu agieren anstatt mit Springerstiefeln und Glatzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Problematik des weiblichen Rechtsextremismus.
- 2 Der Begriff des Rechtsextremismus
- 3 Beteiligung von Frauen am Rechtsextremismus
- 3.1 Frauenbeteiligung am latenten Rechtsextremismus
- 3.2 Frauenbeteiligung am organisierten Rechtsextremismus
- 3.3 Frauenbeteiligung am gewalttätigen Rechtsextremismus
- 4 Rechtsextreme Strömungen und ihr Frauenbild.
- 4.1 Das Frauenbild im Nationalsozialismus.
- 4.2 Das Frauenbild im Neonazismus..
- 4.3 Das Frauenbild im,Autonomen Nationalismus“.
- 5 Das Frauenbild im modernen Rechtsextremismus
- 5.1 Das Frauenbild rechtsextremer Männer am Beispiel des Parteiprogramms der NPD
- 5.2 Selbstbilder rechtsextremer Frauen
- 5.2.1 Das Skingirl und der Skingirl Freundeskreis Deutschland..
- 5.2.2. Die völkische Mutter und die Gemeinschaft Deutscher Frauen..
- 5.2.3 Die, Autonome Nationalistin' und der Arbeitskreis Mädelschar
- 5.2.4 Die NPD-Politikerin und der Ring Nationaler Frauen
- 6.,,Nationalismus ist auch Mädelsache“.\n_\n-\n
- 6.1 Neue Strategie – Ein, Weg in die Mitte der Gesellschaft'?
- 6.2 Weibliche Funktionen im modernen Rechtsextremismus.
- 6.3 Widerspruch zwischen Ideologie und Partizipation und der Irrtum einer Gleichberechtigung.
- 7 Schlussbetrachtung und Fazit ..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Rolle der Frau im modernen Rechtsextremismus und untersucht den Einfluss sowie die Partizipation von Mädchen und Frauen in der neonazistischen Szene. Sie analysiert verschiedene Organisationen, aktuelle Entwicklungen und Strategien dieser Szene.
- Das Frauenbild im Rechtsextremismus
- Die Beteiligung von Frauen an verschiedenen Dimensionen des Rechtsextremismus
- Die Rolle von Frauen in rechtsextremen Organisationen
- Aktuelle Strategien des Rechtsextremismus, die Frauen einbeziehen
- Die Auswirkungen der Partizipation von Frauen auf die rechtsextreme Ideologie und Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung in die Problematik des weiblichen Rechtsextremismus: Dieses Kapitel stellt die Relevanz des Themas im Kontext aktueller Ereignisse wie des NSU dar und beleuchtet die bisherige mediale und wissenschaftliche Wahrnehmung des Themas.
- Kapitel 2: Der Begriff des Rechtsextremismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Rechtsextremismus und skizziert seine zentralen Merkmale und Ideologien.
- Kapitel 3: Beteiligung von Frauen am Rechtsextremismus: In diesem Kapitel wird der quantitative Anteil von Frauen an den verschiedenen Dimensionen des Rechtsextremismus untersucht, darunter der latente, organisierte und gewalttätige Rechtsextremismus.
- Kapitel 4: Rechtsextreme Strömungen und ihr Frauenbild: Dieses Kapitel beleuchtet das Frauenbild in verschiedenen rechtsextremen Strömungen, indem es das Frauenbild im Nationalsozialismus, im Neonazismus und im,Autonomen Nationalismus" analysiert und die historischen Entwicklungen des Frauenbildes in diesen Strömungen darstellt.
- Kapitel 5: Das Frauenbild im modernen Rechtsextremismus: Dieses Kapitel analysiert das Frauenbild im modernen Rechtsextremismus, indem es das Frauenbild rechtsextremer Männer am Beispiel des Parteiprogramms der NPD untersucht und verschiedene Selbstbilder rechtsextremer Frauen beleuchtet, wie z.B. das Skingirl, die völkische Mutter und die,Autonome Nationalistin'.
- Kapitel 6: ,,Nationalismus ist auch Mädelsache“: Dieses Kapitel analysiert die neuen Strategien des Rechtsextremismus, die Frauen einbeziehen und beleuchtet die weiblichen Funktionen im modernen Rechtsextremismus, sowie den Widerspruch zwischen Ideologie und Partizipation.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Frauen, Neonazismus, Frauenbild, Ideologie, Partizipation, Organisation, Strategien, Selbstbild, Geschichte, Nationalsozialismus, NPD, Skingirls, völkische Mutter, Autonome Nationalistin.
- Quote paper
- Karoline Woik (Author), 2012, Die Rolle der Frau im Rechtsextremismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/267833