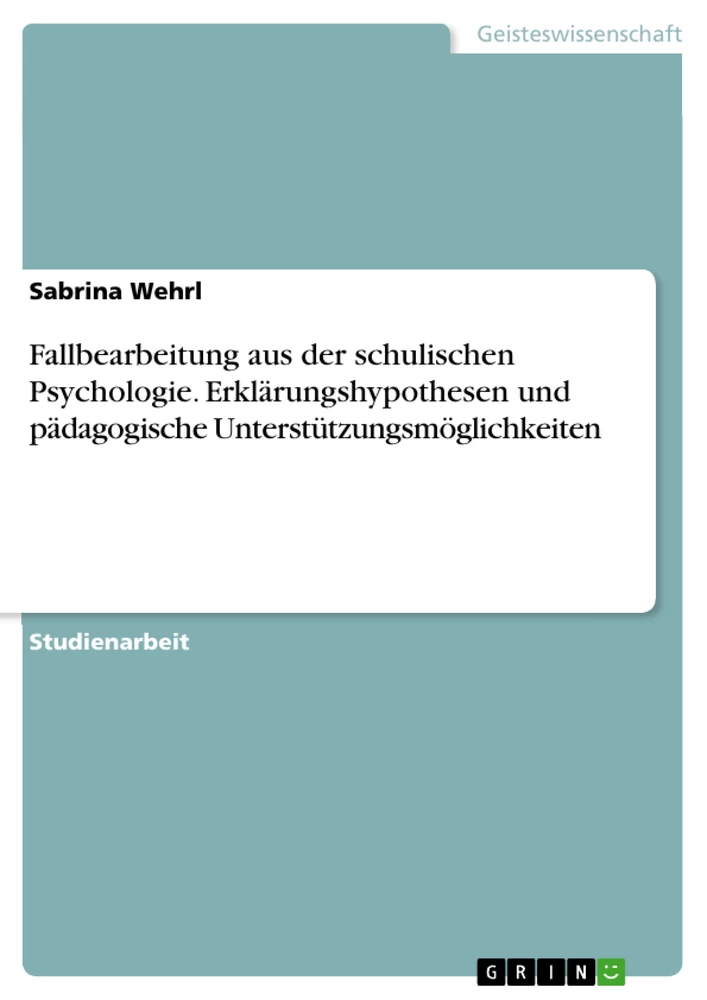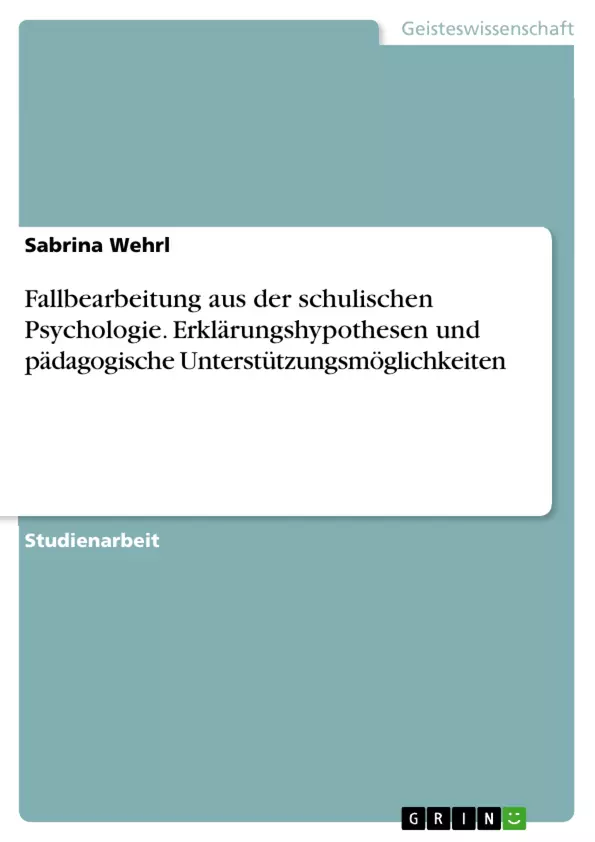Nach den Informationen der Falldarstellung leidet die Schülerin an einem starken inneren Druck. Diese Art der Anspannung ist vermutlich sehr komplex und wird sowohl durch äußere, als auch innere Faktoren verursacht. Wie sich in vielen Studien herauskristallisiert hat, gibt es keine einheitlichen Faktoren, auf welche man Schulversagen zurückführen könnte. Stattdessen kommen viele „unterschiedliche Bedingungen infrage, die den Schulerfolg gefährden können".
Eine Möglichkeit, schulische Leistungsentwicklung von Kindern zu erklären, ist die Analyse von internen und externen Bedingungen. Während zu den internen Faktoren beispielsweise die Intelligenz, die Motivation und das Lernverhalten zählen, spielen bei den externen Faktoren unter anderem die Schichtzugehörigkeit, die Familienstruktur und das elterliches Engagement eine große Rolle. Im Folgenden wird versucht, einige Erklärungshypothesen für J.s schulische Situation aufzustellen, um anschließend anhand pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie in J.s Fall zukünftig vorgegangen werden könnte.
2.1 Erklärungshypothese 1: Familiäre Situation
2.2 Erklärungshypothese 2: Vorkenntnisdefizite
2.3 Erklärungshypothese 3: Geringes Fähigkeitsselbstkonzept
2.4 Erklärungshypothese 4: Außenseiterrolle in der Klasse
3. Aufzeigen pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten, um Jessicas häusliche sowie schulische Situation zu verbessern
Inhaltsverzeichnis
- Falldarstellung
- Beratungsanlass
- Gespräche
- Gespräch mit der Schülerin
- Gespräche mit Schülern
- Gespräche mit den Eltern
- Informationen von Lehrkräften
- Schulische Dokumente
- Mögliche Erklärungshypothesen für die schulische Situation
- Erklärungshypothese 1: Familiäre Situation
- Erklärungshypothese 2: Vorkenntnisdefizite
- Erklärungshypothese 3: Geringes Fähigkeitsselbstkonzept
- Erklärungshypothese 4: Außenseiterrolle in der Klasse
- Aufzeigen pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten, um häusliche sowie schulische Situation der Schülerin zu verbessern
- Erziehungs-/Familienberatung
- Professioneller Nachhilfeunterricht
- Maßnahmen auf Schul- und Klassenebene: Anti-Mobbing-Arbeit auf Basis des Gegen Gewalt-Konzepts
- Kontaktauffahme und Erstgespräch
- Gespräch mit den Tätern
- Beratungsstunde
- Nachbesprechung und Abschlussmnde
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Falldarstellung analysiert die schulische Situation einer Sechstklässlerin, die aufgrund einer schwierigen familiären Situation, insbesondere der Trennung ihrer Eltern, unter starkem inneren Druck leidet und in ihren Schulleistungen nachlässt. Zudem wird die Außenseiterrolle der Schülerin in der Klassengemeinschaft und das damit verbundene Mobbing thematisiert.
- Einfluss der familiären Situation auf die schulische Leistung
- Bedeutung von Vorkenntnissen und Lernmotivation
- Das Fähigkeitsselbstkonzept und seine Auswirkungen auf den Lernerfolg
- Mobbing an Schulen und die Rolle der Lehrkraft
- Pädagogische Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler in schwierigen Situationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Falldarstellung beschreibt die Situation einer Sechstklässlerin, die aufgrund der Trennung ihrer Eltern auffallend still und von ihren Mitschülern gemobbt wird. Ihre Schulleistungen lassen stark nach. Die Lehrkraft sucht das Gespräch mit der Schülerin, den Eltern und den Mitschülern, um die Ursachen für Jessicas Verhalten und die Verschlechterung ihrer Noten zu verstehen. Es werden verschiedene Erklärungshypothesen aufgestellt, die auf die familiäre Situation, Vorkenntnisdefizite, ein geringes Fähigkeitsselbstkonzept und die Außenseiterrolle in der Klasse verweisen.
Im zweiten Teil der Arbeit werden verschiedene pädagogische Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt, die Jessicas häusliche und schulische Situation verbessern könnten. Dazu gehören eine Erziehungs-/Familienberatung, professioneller Nachhilfeunterricht und Maßnahmen auf Schul- und Klassenebene, wie die Anti-Mobbing-Arbeit auf Basis des Gegen Gewalt-Konzepts. Dieses Konzept beinhaltet verschiedene Schritte: Kontaktaufnahme mit dem Opfer und Erstgespräch, Gespräch mit den Tätern, Beratungsstunde mit der gesamten Lerngruppe, Nachbesprechungen mit Opfern, Tätern, Trainern und eine Abschlussstunde in der Lerngruppe.
Im Fazit wird die Komplexität von Jessicas Situation hervorgehoben und die Bedeutung eines positiven sozialen Miteinander an der Schule und in den Klassen betont. Die Aufgabe der Lehrkräfte besteht darin, nach Ursachen für den schulischen Leistungsabfall von Kindern zu forschen und ihnen als Wissensvermittler, Erzieher und Berater zur Seite zu stehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Welche Faktoren können zu schulischem Versagen führen?
Man unterscheidet interne Faktoren (Intelligenz, Motivation) und externe Faktoren (familiäre Situation, Schichtzugehörigkeit, Mobbing).
Welche Erklärungshypothesen werden für den Fall "Jessica" aufgestellt?
Die schwierige familiäre Situation (Elterntrennung), Vorkenntnisdefizite, ein geringes Fähigkeitsselbstkonzept und eine Außenseiterrolle in der Klasse.
Wie wirkt sich Mobbing auf die Schulleistung aus?
Mobbing erzeugt starken inneren Druck und soziale Isolation, was die Konzentration auf schulische Inhalte massiv behindern kann.
Welche konkreten Unterstützungsmöglichkeiten werden vorgeschlagen?
Erziehungs- und Familienberatung, professioneller Nachhilfeunterricht sowie Anti-Mobbing-Arbeit auf Basis des „Gegen Gewalt“-Konzepts.
Was ist die Aufgabe der Lehrkraft bei Leistungsabfall?
Lehrkräfte sollten als Berater und Erzieher nach den tieferliegenden Ursachen forschen und nicht nur den Wissensstand bewerten.
- Quote paper
- Sabrina Wehrl (Author), 2013, Fallbearbeitung aus der schulischen Psychologie. Erklärungshypothesen und pädagogische Unterstützungsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/267356