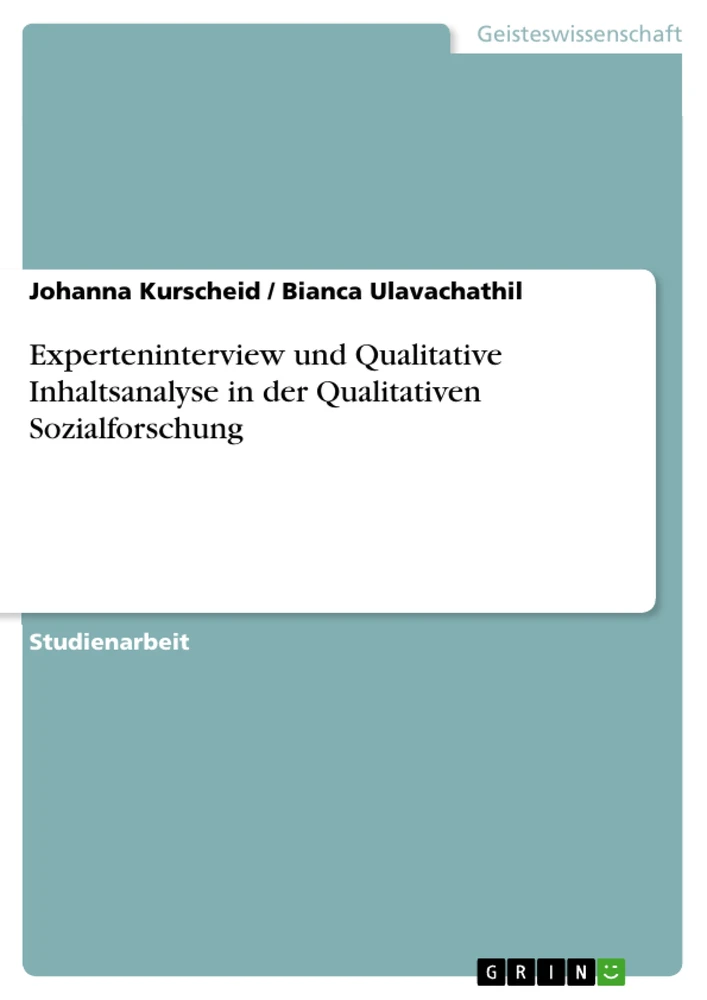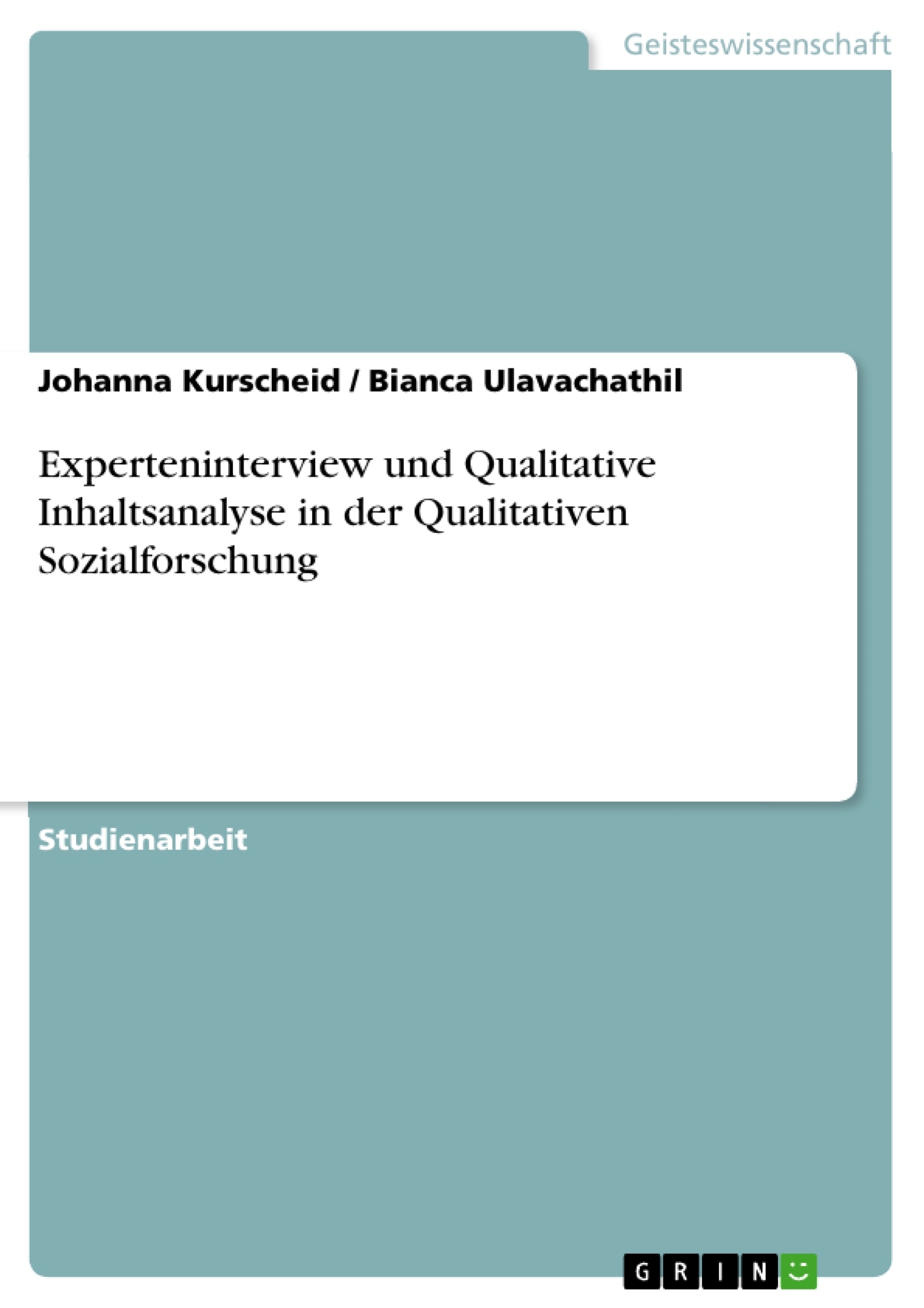Im folgenden werden wir beschreiben, was qualitative Sozialforschung und ihre Kennzeichen sowie ihre Grundprinzipien sind, gefolgt von einer Darstellung des Experten- oder Leitfadeninterviews und der qualitativen Inhaltsanalyse. Abschließend stellen wir die Studie „Wege aus der Jugendkriminalität - Eine qualitative Studie zu Hintergründen und Bedingungen einer erfolgreichen Reintegration von mehrfachauffälligen Jungtätern“ von Wolfgang Stelly und Jürgen Thomas dar.
Inhaltsverzeichnis
- Qualitative Sozialforschung
- Das Experteninterview
- Die Rolle des Interviewpartners als Experte
- Das Expertenwissen und Forschungsinteresse
- Das Expertengespräch als Leitfadeninterview
- Das Konstruieren von relevanten Fragen
- Die Vorbereitung des Interviews
- Die Durchführung des Experteninterviews
- Die Qualitative Inhaltsanalyse
- Eine Beispielstudie
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Gliederung der verfassten Gruppenarbeit von Kurscheid, Johanna und Ulavachathil, Bianca
- Relevante Seiten der Beispielstudie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit bietet eine Einführung in die qualitative Sozialforschung, mit einem Fokus auf das Experteninterview und die qualitative Inhaltsanalyse. Ziel ist es, die Methoden und Prinzipien dieser Forschungsansätze zu erläutern und an einem Beispiel zu veranschaulichen.
- Qualitative Forschungsmethoden
- Das Experteninterview als Forschungsmethode
- Qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren
- Anwendung der Methoden in der Praxis
- Analyse einer Beispielstudie
Zusammenfassung der Kapitel
Qualitative Sozialforschung: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der qualitativen Sozialforschung, ihre Kennzeichen und Prinzipien. Es wird betont, dass qualitative Forschung darauf abzielt, Lebenswelten aus der Perspektive der handelnden Menschen zu beschreiben und ein Verständnis für soziale Wirklichkeit, Deutungsmuster und Strukturmerkmale zu erlangen. Der Fokus liegt auf der Ergründung der Ursachen und des Sinns sozialen Handelns und der Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen. Die Vielseitigkeit des Erkenntnisgewinns wird hervorgehoben, sowohl theoretisch als auch praktisch, mit Bezug auf Motive, Werthaltungen, soziale Organisationen und Kulturelemente. Es werden zudem die grundlegenden Richtlinien und Prinzipien für einen qualitativen Forschungsprozess vorgestellt, die Offenheit gegenüber dem Untersuchungsgegenstand, die Entwicklung einer präzisen Forschungsfrage und die Berücksichtigung der interpretativen Natur der Forschung betonen. Die Bedeutung der Kommunikation und des Dialogs im Forschungsprozess wird ebenfalls hervorgehoben.
Das Experteninterview: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Experteninterview als Methode der qualitativen Sozialforschung. Es definiert das Experteninterview als Befragung von Personen mit speziellem Wissen und Entscheidungskompetenz zu einem bestimmten Forschungsthema. Die Rolle des Interviewpartners als Experte wird genauer beleuchtet, wobei die Definition von Experten nach Bogner et al. zitiert wird, die Experten als Personen beschreiben, die ihr Praxis- oder Erfahrungswissen sinnvoll und handlungsleitend strukturieren können. Der Abschnitt skizziert die methodischen Aspekte des Experteninterviews, beginnend mit der Definition der Rolle des Experten, über die Konstruktion relevanter Fragen bis hin zur Durchführung des Interviews. Die Bedeutung der klaren Definition des Forschungsgegenstandes und der Auswahl geeigneter Experten wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Qualitative Sozialforschung, Experteninterview, Qualitative Inhaltsanalyse, Forschungsmethoden, Qualitative Datenanalyse, Soziale Wirklichkeit, Subjektive Perspektiven, Interpretative Forschung
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Qualitative Sozialforschung - Experteninterview und Qualitative Inhaltsanalyse
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet eine umfassende Einführung in die qualitative Sozialforschung, mit besonderem Fokus auf das Experteninterview und die qualitative Inhaltsanalyse. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel (Qualitative Sozialforschung und Das Experteninterview), sowie ein Schlüsselwortverzeichnis. Zusätzlich wird eine Beispielstudie erwähnt, deren relevante Seiten im Anhang aufgeführt sind.
Welche Forschungsmethoden werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt hauptsächlich zwei qualitative Forschungsmethoden: das Experteninterview und die qualitative Inhaltsanalyse. Es wird erklärt, wie diese Methoden angewendet werden und welche Prinzipien dahinterstecken. Die Grundlagen der qualitativen Sozialforschung werden ebenfalls erläutert.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel ist es, die Methoden und Prinzipien des Experteninterviews und der qualitativen Inhaltsanalyse zu erläutern und an einem Beispiel zu veranschaulichen. Die Studierenden sollen ein Verständnis für die Anwendung dieser Methoden in der Praxis erlangen.
Welche Themen werden im Kapitel "Qualitative Sozialforschung" behandelt?
Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der qualitativen Sozialforschung, ihre Kennzeichen und Prinzipien. Es geht um das Ziel, Lebenswelten aus der Perspektive der Betroffenen zu beschreiben und ein Verständnis für soziale Wirklichkeit, Deutungsmuster und Strukturmerkmale zu erlangen. Die Bedeutung der Offenheit, einer präzisen Forschungsfrage und der interpretativen Natur der Forschung wird hervorgehoben.
Was wird im Kapitel "Das Experteninterview" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Experteninterview als Methode der qualitativen Sozialforschung. Es definiert das Experteninterview, beleuchtet die Rolle des Interviewpartners als Experte und skizziert die methodischen Aspekte, von der Definition der Rolle des Experten über die Konstruktion relevanter Fragen bis hin zur Durchführung des Interviews. Die Bedeutung der klaren Definition des Forschungsgegenstandes und der Auswahl geeigneter Experten wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Qualitative Sozialforschung, Experteninterview, Qualitative Inhaltsanalyse, Forschungsmethoden, Qualitative Datenanalyse, Soziale Wirklichkeit, Subjektive Perspektiven, Interpretative Forschung.
Gibt es eine Beispielstudie?
Ja, die Hausarbeit erwähnt eine Beispielstudie, um die Anwendung der beschriebenen Methoden zu veranschaulichen. Relevante Seiten dieser Studie sind im Anhang aufgeführt.
Was ist im Anhang enthalten?
Der Anhang enthält die Gliederung der verfassten Gruppenarbeit von Kurscheid, Johanna und Ulavachathil, Bianca, sowie die relevanten Seiten der Beispielstudie.
Für wen ist diese Hausarbeit gedacht?
Diese Hausarbeit ist für Studierende gedacht, die sich mit qualitativen Forschungsmethoden, insbesondere dem Experteninterview und der qualitativen Inhaltsanalyse, auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Johanna Kurscheid (Author), Bianca Ulavachathil (Author), 2013, Experteninterview und Qualitative Inhaltsanalyse in der Qualitativen Sozialforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/267306