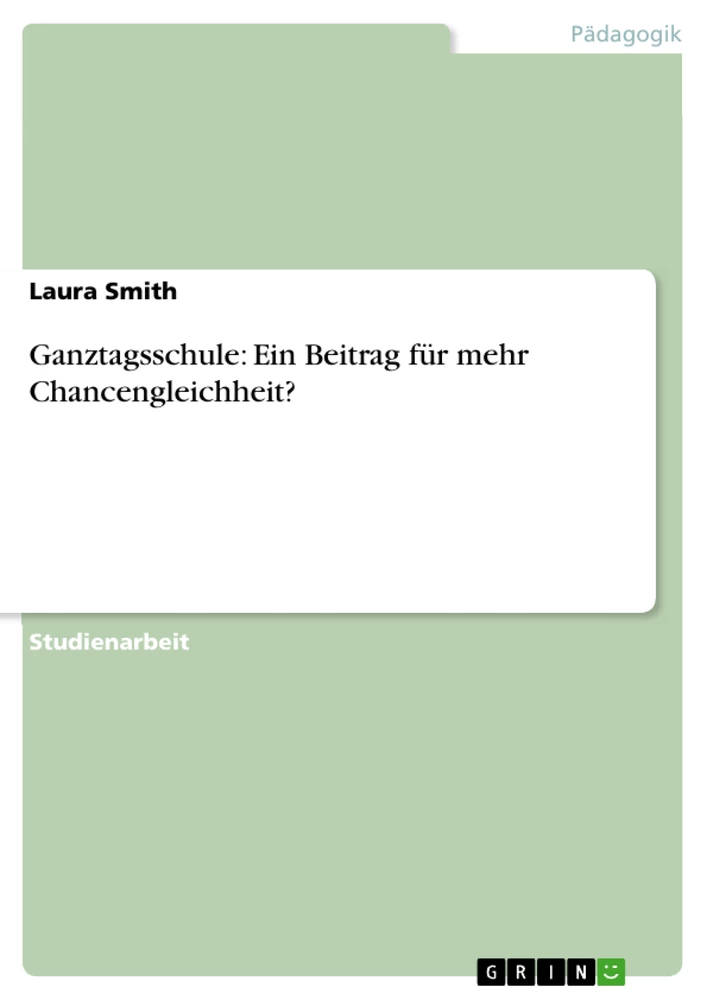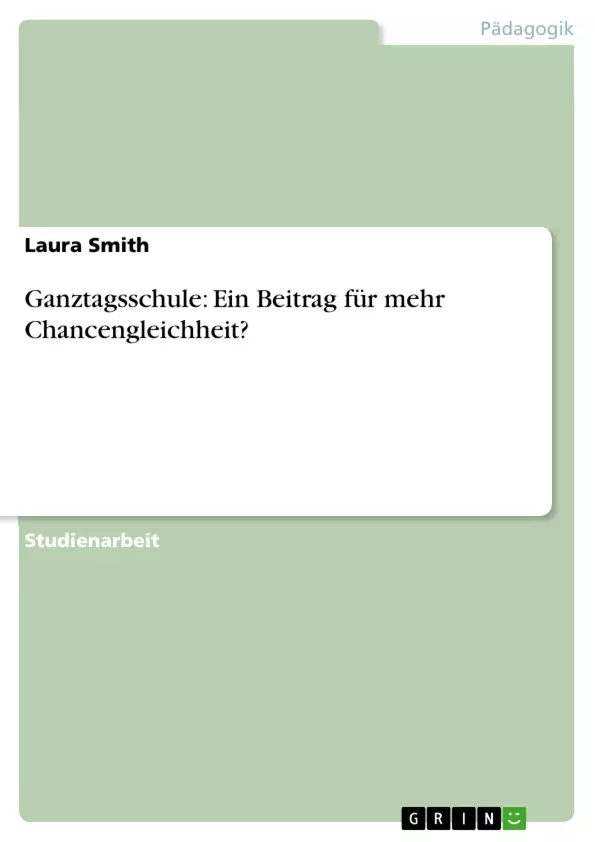Vor dem Hintergrund der verheerenden deutschen PISA-Ergebnisse wurde das deutsche Bildungssystem zunehmend Gegenstand politischer Debatten. Kritiker führten den Misserfolg der Schüler auf die überwiegend vorherrschende Halbtagsschule zurück, denn führend in den PISA-Studien waren vor allem die europäischen und außereuropäischen Ländern, in denen die Ganztagsschule bereits zahlreich etabliert ist. Somit wurde der Ruf nach Reformen immer lauter, wobei die Ganztagsschule in den Fokus der Diskussionen geriet. Einen erheblichen Beitrag zur Initiierung und Implementierung der Ganztagsschule leistete das Investitionsprogramm ‚Zukunft Bildung und Betreuung‘ (IZBB) von 2003. Im Rahmen dieser Planung flossen finanzielle Mittel in Höhe von 4 Milliarden in den Auf- bzw. Ausbau von Ganztagsschulen. Diese beträchtliche Summe an Ausgaben ist im Gegenzug mit einer Reihe an Erwartungen verbunden: So hofft man „[a]ngesichts bestehender sozialer Ungleichheiten im Zugang zu unserem Bildungseinrichtungen, im Bildungserfolg und regionaler Disparitäten im Bildungsangebot […] mehr soziale[r] Gerechtigkeit […] [zu verwirkliche[n]- das heißt schulisch gesprochen: die bestmögliche Förderung des Einzelnen bei der Realisierung von mehr Chancengerechtigkeit für alle, um durch Bildung mehr Lebens-, Berufs- und Sozialchancen zu vermitteln.“ Fraglich ist allerdings, inwieweit diese Zielorientierung im Ganztagsschulbereich in der Praxis tatsächlich realisierbar ist. In meiner Arbeit verfolge ich speziell diese Fragestellung, ob mehr Chancengerechtigkeit durch Ganztagsschulen gegeben wird. Zunächst greife ich die PISA- Studie von 2000 auf, da diese Ausgangspunkt der bildungspolitischen Diskussionen war und diese die Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem aufdeckte. Außerdem ist es wichtig in Erfahrung zu bringen, wie Kinder, die von Armut betroffen sind, aufwachsen und welche Auswirkungen dies auf den schulischen Alltag der Kinder hat. Der Schwerpunkt der Seminararbeit liegt auf die kompensatorischen Merkmale von Ganztagsschule und ihren Beitrag zu der Sicherung von mehr Chancengerechtigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem
- Kinderarmut in Deutschland
- Ganztagsschule als Hoffnungsträger für die Zukunft
- Entlastung der Eltern?
- Verbesserung der individuellen Förderung?
- In den Unterricht integrierte Förderung
- Gezielte ergänzende Fördermaßnahmen
- Förderung im Rahmen des Zusatz- und Neigungsprogramms
- Rahmenbedingungen der Individuellen Förderung
- Erste Ergebnisse der Individuellen Förderung
- Zusammenschau
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob Ganztagsschulen einen Beitrag zur Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem leisten können. Sie untersucht die Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem und die Auswirkungen von Kinderarmut auf den schulischen Alltag. Anschließend werden die kompensatorischen Merkmale der Ganztagsschule und ihr Beitrag zur Sicherung von mehr Chancengleichheit analysiert.
- Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem
- Kinderarmut und ihre Folgen
- Potenzial der Ganztagsschule zur Verbesserung der Bildungschancen
- Individuelle Förderung in der Ganztagsschule
- Verzahnung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die PISA-Studie von 2000 als Ausgangspunkt für die bildungspolitische Diskussion über die Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Sie stellt die Frage, ob Ganztagsschulen einen Beitrag zur Realisierung von mehr Chancengleichheit leisten können.
Das Kapitel "Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem" analysiert die Ergebnisse der PISA-Studie und zeigt auf, dass Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern überdurchschnittlich häufig von schulischen Misserfolgen betroffen sind. Es wird die Bedeutung des Elternhauses für den schulischen Erfolg sowie die Unterschiede in der Unterstützung und Förderung von Kindern aus verschiedenen sozialen Schichten beleuchtet.
Das Kapitel "Kinderarmut in Deutschland" beschreibt die stetig wachsende Zahl der armutsgefährdeten Kinder in Deutschland. Es werden die Auswirkungen von Armut auf die materielle, kulturelle, soziale und gesellschaftliche Lebenslage von Kindern sowie die Folgen für ihre schulische Entwicklung dargestellt.
Das Kapitel "Ganztagsschule als Hoffnungsträger für die Zukunft" beleuchtet die Erwartungen, die mit der Entwicklung von Ganztagsschulen verbunden sind. Es wird die Hoffnung geäußert, dass durch die Ganztagsschule die soziale Herkunft nicht länger entscheidend für den schulischen Werdegang sein soll. Außerdem werden die sozial- und familienpolitischen Argumente für die Ganztagsschule, wie die Entlastung von Eltern und die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, erläutert.
Das Kapitel "Entlastung der Eltern?" analysiert die familienpolitischen Argumente für die Ganztagsschule und zeigt auf, dass sie eine große Entlastung für berufstätige Eltern, insbesondere für Alleinerziehende, darstellt. Es wird die Bedeutung eines verlässlichen Betreuungsangebots für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Rolle der Ganztagsschule bei der Armutsprävention hervorgehoben.
Das Kapitel "Verbesserung der individuellen Förderung?" befasst sich mit dem Konzept der individuellen Förderung in der Ganztagsschule. Es werden verschiedene Bereiche der individuellen Förderung, wie die im Unterricht integrierte Förderung und gezielte ergänzende Fördermaßnahmen, sowie die Förderung im Rahmen des Zusatz- und Neigungsprogramms vorgestellt. Außerdem werden die Rahmenbedingungen der individuellen Förderung, wie der Einsatz von multiprofessionellen Teams, die Diagnose- und Förderkompetenzen des Personals und die Verzahnung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten, beleuchtet.
Die "Zusammenschau" fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und stellt die Bedeutung der Ganztagsschule für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern aus sozial schwachen Familien heraus. Es werden die Stärken und Schwächen der Ganztagsschule sowie die Bedeutung der institutionellen Qualität individueller Förderung zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem, die Ganztagsschule, die individuelle Förderung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Armutsprävention und die soziale Inklusion. Der Text beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Ganztagsschule im Hinblick auf die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern aus sozial schwachen Familien und die Förderung der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem.
- Arbeit zitieren
- Laura Smith (Autor:in), 2013, Ganztagsschule: Ein Beitrag für mehr Chancengleichheit?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/266488