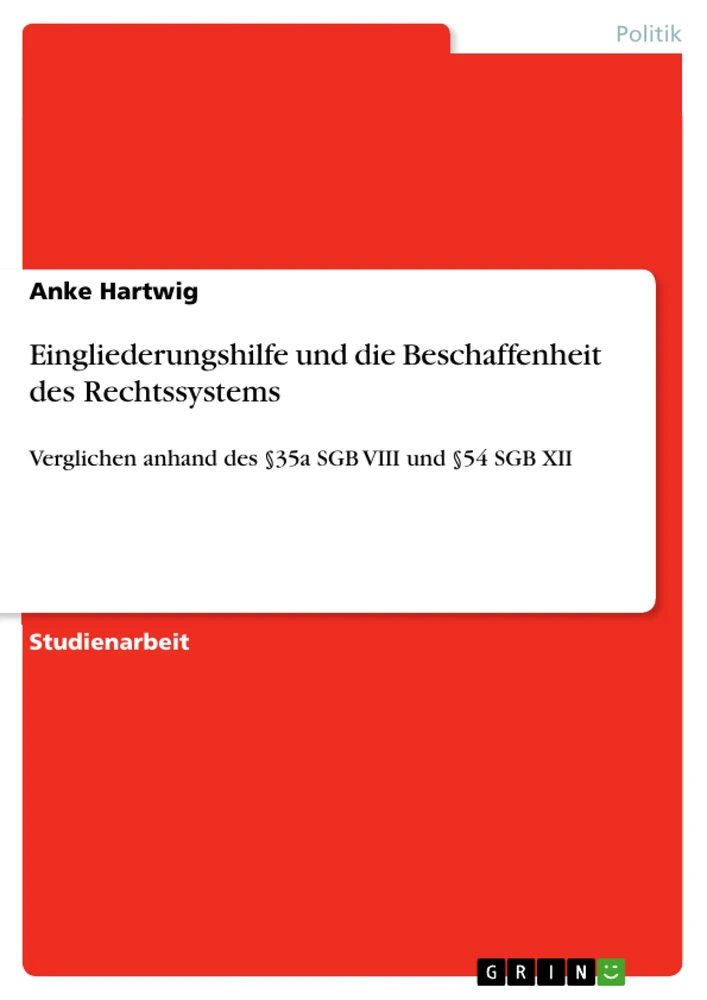Ich bin selbst im Bereich der Hilfen zur Erziehung, in der ambulanten Jugendhilfe, tätig und überdies bei einem Träger der Behindertenhilfe beschäftigt. Immer wieder kommt es zu Fällen, die sich nicht klar einer Leistung zuordnen lassen. Insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste, im Fachdienst junge Menschen, sind im Bezug auf die Personengruppe der jungen Menschen mit Behinderungen, Grenzen zu spüren. Sozialpädagogischen Fachkräften fällt es schwer Behinderungsbilder oder ihre Auswirkungen auf Wahrnehmung und Entwicklung einzuschätzen und zuzuordnen. Sie beziehen sich auf Diagnosen, beispielsweise vom Kinderzentrum, und behelfen sich mit der Bewilligung von Eingliederungshilfen bei einem Träger der Behindertenhilfe.
Frühzeitige Hilfen bleiben jedoch häufig aus. Grund dafür ist, das die Prüfung der Einkommensverhältnisse im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen von drei bis sogar zwölf Monaten andauern kann. In einzelnen Fällen wird jedoch nicht Eingliederungshilfe, sondern Jugendhilfe gewährt. Grund hierfür ist jedoch nicht immer der Bedarf im Bereich der Hilfen zur Erziehung, sondern oftmals das schnellere Bewilligungsverfahren und die ausbleibende Zuzahlungspflicht, da die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern hier ausbleibt.
Gerecht oder ungerecht? Ich möchte mich auf den folgenden Seiten mit den Möglichkeiten des Rechtssystem auseinandersetzen und die Problematik der inhaltlichen Ausgestaltung dieser Gesetze verdeutlichen. Dazu werde ich insbesondere den § 35a SGB VIII in den Mittelpunkt nehmen und mich mit den Hintergründen und der Entstehung des Paragraphen auseinandersetzen. Ebenso soll die Problematik der klaren differenzierten Zuordnung von Hilfen und die konkrete Ermittlung von Bedarfen auf praktischer Ebene verdeutlicht werden. Was macht es so schwierig den richtigen Träger, die entsprechende Leistung und die dafür notwendige Grundlage ausfindig zu machen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufgabe der Eingliederungshilfe
- 2.1 Anspruchsvoraussetzung
- 2.2 Anspruchsberechtigung
- 2.3 Leistungsumfang
- 3. Begriffsbestimmung „seelische Behinderung“
- 4. „zweigeteilte Diagnose“ in § 35a SGB VIII
- 5. Entstehung des § 35a SGB VIII als eigenständiger Leistungstatbestand
- 6. Abgrenzung zum SGB XII
- 7. Änderungsvorschläge und Kritik
- 7.1 Angleichung des § 35a SGB VIII an SGB XII
- 7.2 Rückführung des § 35a SGB VIII in erzieherische Hilfen
- 7.3 Abschaffung des § 35a SGB VIII
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischen Behinderungen und deren Einordnung im deutschen Rechtssystem. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des § 35a SGB VIII und seiner Abgrenzung zum SGB XII. Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen bei der Zuordnung von Leistungen und die Ermittlung des Bedarfs in der Praxis aufzuzeigen.
- Begriffsbestimmung der seelischen Behinderung im Kontext der Eingliederungshilfe
- Die Rolle des § 35a SGB VIII in der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischen Behinderungen
- Die Abgrenzung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII von anderen Leistungen, insbesondere dem SGB XII
- Kritikpunkte und Änderungsvorschläge im Bereich der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischen Behinderungen
- Praktische Herausforderungen bei der Zuordnung von Leistungen und der Ermittlung des Bedarfs in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Diese Einleitung skizziert die Problematik der Zuordnung von Leistungen im Kontext der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischen Behinderungen. Es werden die Herausforderungen für Sozialpädagogische Fachkräfte aufgezeigt, die bei der Einschätzung von Behinderungsbildern und deren Auswirkungen auf die Entwicklung von jungen Menschen auftreten. Des Weiteren werden die unterschiedlichen Bewilligungsverfahren von Eingliederungshilfe und Jugendhilfe erläutert und die Frage nach deren Gerechtigkeit aufgeworfen.
- Kapitel 2: Aufgabe der Eingliederungshilfe
Dieses Kapitel befasst sich mit den Anspruchsvoraussetzungen, der Anspruchsberechtigung und dem Leistungsumfang der Eingliederungshilfe. Es werden die Definition der Behinderung nach § 35a SGB VIII und § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX erläutert sowie die Rolle von medizinischer Diagnostik und sozialpädagogischer Einschätzung bei der Feststellung einer seelischen Behinderung beleuchtet. Des Weiteren werden die verschiedenen Anspruchsberechtigten und ihre Rechtsansprüche auf Eingliederungshilfe beschrieben.
- Kapitel 3: Begriffsbestimmung „seelische Behinderung“
Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs der Behinderung und die Integration psychischer Beeinträchtigungen als mögliche Behinderungsform.
Schlüsselwörter
Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII, SGB XII, seelische Behinderung, Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung, Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Diagnostik, sozialpädagogische Fachkraft, Anspruchsvoraussetzung, Anspruchsberechtigung, Leistungsumfang, Abgrenzung, Änderungsvorschläge, Kritik, Praxis, Bedarfsfeststellung.
- Quote paper
- Anke Hartwig (Author), 2013, Eingliederungshilfe und die Beschaffenheit des Rechtssystems, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/266443