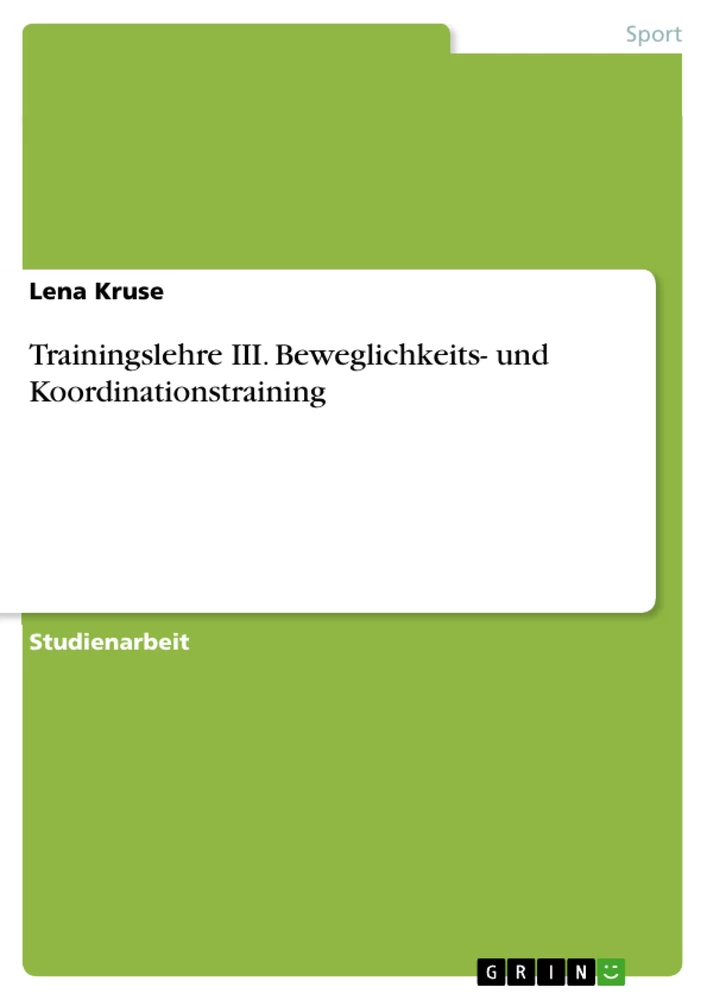Um die Beweglichkeit der Probandin zu testen, habe ich einen manuellen Beweglichkeitstest, einen sogenannten Muskelfunktionstest nach Janda, durchgeführt. Dabei wird eine Messung der Gelenkbewegung vorgenommen, um die Beweglichkeit sowie die Kraftfähigkeit einzelner Muskelgruppen zu testen. Muskelschwächen und Beweglichkeitsdefizite werden erfasst. Die maximale Gelenkamplitude wird anhand des subjektiven Schmerzempfindens der Testperson festgelegt. Es ist zu beachten, dass diese Bestimmung aufgrund der individuellen Ausführung lediglich semi-objektiv einzuordnen ist.
Nachfolgend soll darauf aufbauend ein Dehnprogramm erstellt werden, um mögliche Beweglichkeitsdefizite auszugleichen.
Inhaltsverzeichnis
- AUFGABE 1) PERSONENDATEN
- 1.1 Richtwerttabellen
- AUFGABE 2) BEWEGLICHKEITSTESTUNG
- 2.1 Testung der Brustmuskulatur (M. pectoralis major)
- 2.2 Testung der Hüftbeugemuskulatur (M. iliopsoas)
- 2.3 Testung Kniestreckmuskulatur (M. rectus femoris)
- 2.4 Testung Kniebeugemuskulatur (Mm. ischiocrurales)
- 2.5 Testung Wadenmuskulatur (Mm. triceps surae)
- 2.6 Testübersicht
- 2.7 Bewertung Testergebnisse
- AUFGABE 3) BEWEGLICHKEITSTRAINING
- 3.1 Belastungsgefüge
- 3.1.1 Begründung Belastungsgefüge
- 3.2 Übungsauswahl für das Beweglichkeitstraining
- 3.2.1 Dehnübung 1 — Waden
- 3.2.2 Dehnübung 2 — Beinbeuger
- 3.2.3 Dehnübung 3 — Beinstrecker
- 3.2.4 Dehnübung 4 — Beinbeuger
- 3.2.5 Dehnübung 5 — Hüftbeuger
- 3.2.6 Dehnübung 6 — Gesäß
- 3.2.7 Dehnübung 7 — Gerade Bauchmuskulatur
- 3.2.8 Dehnübung 8 — Schräge Bauchmuskulatur
- 3.2.9 Dehnübung 9 — Brust
- 3.2.10 Dehnübung 10 - Oberer Rücken
- 3.2.11 Dehnübung 11 — Brust
- 3.3 Erläuterungen Dehnübungen
- AUFGABE 4) KOORDINATIONSTRAINING
- 4.1 Belastungsgefüge
- 4.2 Begründung Belastungsgefüge
- 4.3 Übungsauswahl für Koordinationstraining
- 4.3.1 Übung 1
- 4.3.2 Übung 2
- 4.3.3 Übung 3
- 4.3.4 Übung 4
- 4.3.5 Übung 5
- 4.3.6 Übung 6
- 4.3.7 Übung 7
- 4.3.8 Übung 8
- 4.3.9 Übung 9
- 4.3.10 Übung 10
- 4.4 Begründung Übungsauswahl
- AUFGABE 5) LITERATURRECHERCHE
- 5.1 Studie Nummer 1 - Bewegungsreichweite, Zugkraft und Muskelaktivität bei eigen- bzw. fremdregulierter Dehnung
- 5.2 Studie Nummer 2 - Wie beeinflussen unterschiedliche Dehnintensitäten kurzfristig die Veränderung der Bewegungsreichweite?
- TABELLENVERZEICHNIS
- LITERATURVERZEICHNIS
- 7.1 Studien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Einsendeaufgabe im Fachmodul Trainingslehre 111 des Studiengangs B.A. in Fitnessökonomie dient der Analyse und praktischen Umsetzung von Beweglichkeits- und Koordinationstraining. Die Aufgabe beinhaltet die Durchführung und Auswertung eines Beweglichkeitstests an einer Probandin, die Erstellung eines individuellen Dehnprogramms sowie die Entwicklung eines Koordinationstrainings.
- Beweglichkeitstestung und -bewertung
- Erstellung eines individuellen Dehnprogramms
- Entwicklung eines Koordinationstrainings
- Anwendung verschiedener Dehn- und Trainingsmethoden
- Bedeutung von Beweglichkeit und Koordination für Gesundheit und Fitness
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einsendeaufgabe beginnt mit der Erfassung allgemeiner und biometrischer Daten der Probandin. Anschließend werden die Ergebnisse des Beweglichkeitstests detailliert dargestellt und die daraus resultierenden Defizite in der Brustmuskulatur und Kniebeugemuskulatur analysiert.
Kapitel 3 widmet sich dem Beweglichkeitstraining. Es wird ein Belastungsgefüge für die Probandin definiert, das auf ihrer sportlichen Vorerfahrung und den festgestellten Beweglichkeitseinschränkungen basiert. Im Anschluss daran werden elf verschiedene Dehnübungen vorgestellt und detailliert beschrieben, die speziell auf die Bedürfnisse der Probandin zugeschnitten sind.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Koordinationstraining. Auch hier wird zunächst ein Belastungsgefüge definiert, das die koordinativen Fähigkeiten der Probandin berücksichtigt. Es werden zehn Übungen vorgestellt, die eine progressive Steigerung des Schwierigkeitsgrades durch Variation der Hilfsmittel und des Belastungsniveaus aufweisen.
Zum Abschluss werden zwei wissenschaftliche Studien zum Thema Dehnen vorgestellt und ihre Ergebnisse zusammengefasst. Die erste Studie untersucht die Effektivität verschiedener Dehnmethoden, während die zweite Studie den Einfluss unterschiedlicher Dehnintensitäten auf die Bewegungsreichweite beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Beweglichkeit, Koordination, Trainingslehre, Dehnprogramm, Koordinationstraining, Beweglichkeitstest, Muskelfunktionsdiagnostik, Belastungsgefüge, Dehnmethoden, Dehnintensität, Trainingsanfänger, sportliche Aktivität, Gesundheit, Fitness, wissenschaftliche Studien.
- Quote paper
- Lena Kruse (Author), 2013, Trainingslehre III. Beweglichkeits- und Koordinationstraining, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/266020