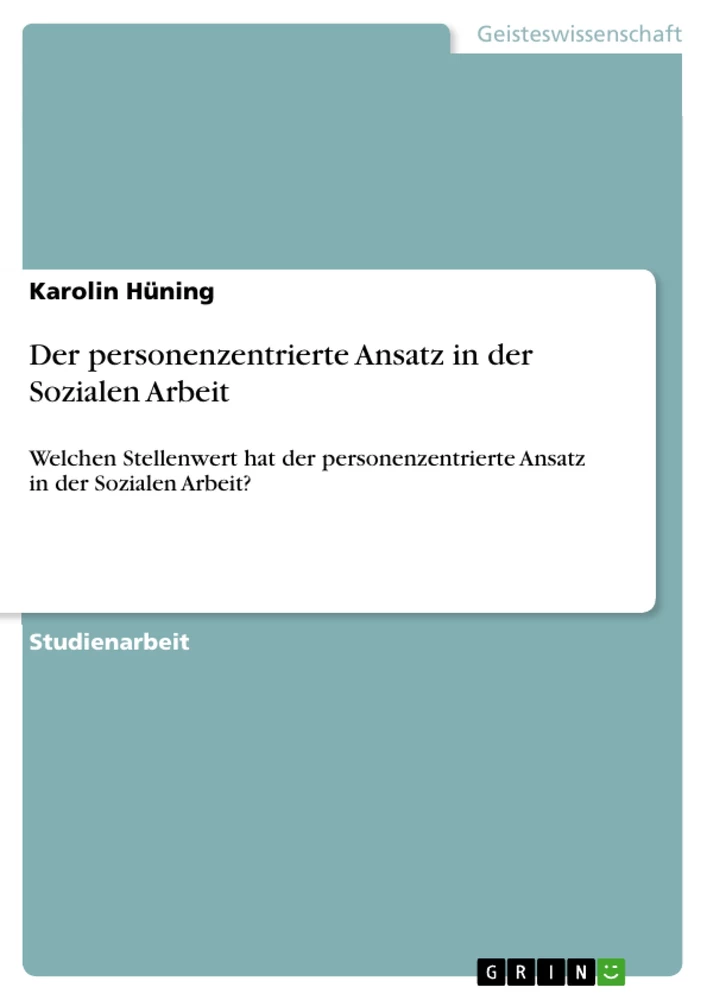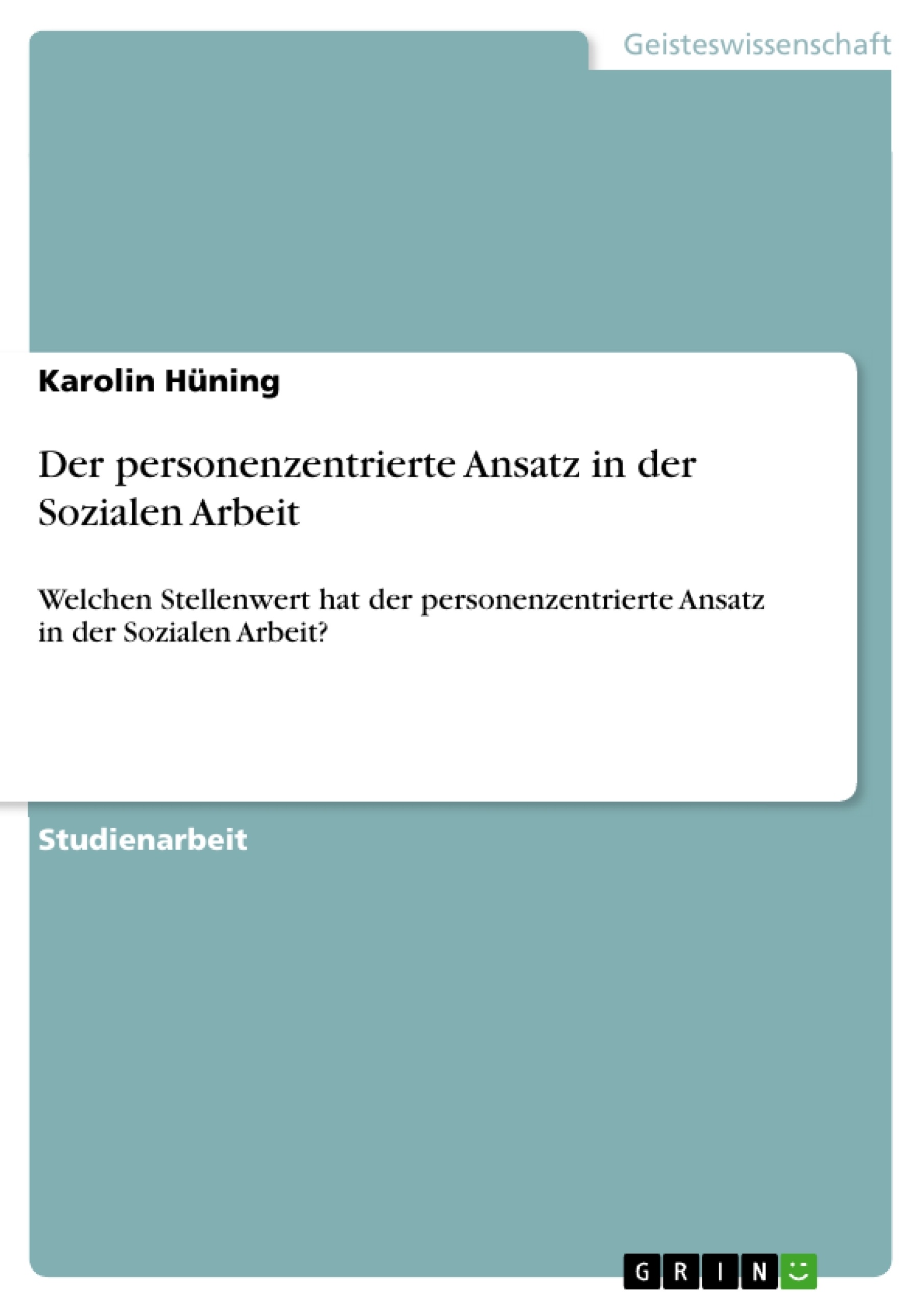„Wenn ich vermeide, mich einzumischen, sorgen die Menschen für sich selber, wenn ich vermeide, Anweisungen zu geben, finden Menschen selbst das rechte Verhalten [...].“ (LAOTSE, 6. Jh. v. Chr.)
Die folgende Hausarbeit untersucht den Stellenwert des personenzentrierten Ansatzes in der Sozialen Arbeit mittels Literaturvergleichs und gibt einen Überblick über die Grundbegriffe und Anwendungsmöglichkeiten.
Einleitung
1. Carl Ransom Rogers
2. Der personenzentrierte Ansatz
2.1 Grundbegriffe
2.1.1 Aktualisierungstendenz
2.1.2 Selbstkonzept
2.1.3 Inkongruenz
2.2 Grundhaltungen
2.2.1 Akzeptanz
2.2.2 Empathie
2.2.3 Kongruenz
3. Soziale Arbeit und personenzentrierte Beratung
3.1 Leitideen
3.2 Kommunikation
3.3 Grenzen
Fazit
Literaturverzeichnis
Eigenständigkeitserklärung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Carl Ransom Rogers
- Der personenzentrierte Ansatz
- Grundbegriffe
- Aktualisierungstendenz
- Selbstkonzept
- Inkongruenz
- Grundhaltungen
- Akzeptanz
- Empathie
- Kongruenz
- Grundbegriffe
- Soziale Arbeit und personenzentrierte Beratung
- Leitideen
- Kommunikation
- Grenzen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den Stellenwert des personenzentrierten Ansatzes in der Sozialen Arbeit. Sie analysiert die Grundbegriffe und Grundhaltungen des Ansatzes und beleuchtet die Anwendungsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit. Darüber hinaus werden die Grenzen des Ansatzes in der Praxis aufgezeigt.
- Der personenzentrierte Ansatz als Therapieform und seine Bedeutung in der Sozialen Arbeit
- Die Grundbegriffe des personenzentrierten Ansatzes: Aktualisierungstendenz, Selbstkonzept und Inkongruenz
- Die Grundhaltungen des personenzentrierten Ansatzes: Akzeptanz, Empathie und Kongruenz
- Die Anwendungsmöglichkeiten des personenzentrierten Ansatzes in der Sozialen Arbeit
- Die Grenzen des personenzentrierten Ansatzes in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Zitat von Laotse vor, welches die Philosophie des personenzentrierten Ansatzes von Carl R. Rogers widerspiegelt. Sie beleuchtet die Bedeutung der professionellen Beratung in der heutigen Gesellschaft und verdeutlicht den Stellenwert des personenzentrierten Ansatzes in der Sozialen Arbeit.
Das Kapitel „Carl Ransom Rogers" gibt einen Überblick über das Leben und Wirken von Carl R. Rogers, dem Begründer des personenzentrierten Ansatzes. Es beleuchtet seine frühen Erfahrungen und seine Entwicklung des Ansatzes.
Im Kapitel „Der personenzentrierte Ansatz" werden die Grundbegriffe des Ansatzes, wie die Aktualisierungstendenz, das Selbstkonzept und die Inkongruenz, erläutert. Die Grundhaltungen, die für eine erfolgreiche Beratung notwendig sind, Akzeptanz, Empathie und Kongruenz, werden ebenfalls beschrieben.
Das Kapitel „Soziale Arbeit und personenzentrierte Beratung" beschäftigt sich mit den Leitideen der Sozialen Arbeit, wie Hilfe zur Selbsthilfe und Empowerment. Es beleuchtet die Bedeutung der personenzentrierten Kommunikation in der Sozialen Arbeit und zeigt anhand einer Tabelle die wichtigsten Beratungsfertigkeiten auf. Abschließend werden die Grenzen des personenzentrierten Ansatzes in der Sozialen Arbeit dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den personenzentrierten Ansatz, die Aktualisierungstendenz, das Selbstkonzept, die Inkongruenz, Akzeptanz, Empathie, Kongruenz, Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment, die personenzentrierte Kommunikation, die Grenzen des Ansatzes in der Sozialen Arbeit und das Doppelte Mandat.
- Arbeit zitieren
- Karolin Hüning (Autor:in), 2013, Der personenzentrierte Ansatz in der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/265938